|
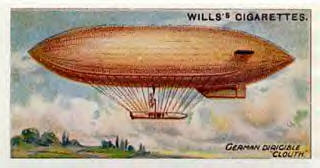
Lenkbares Luftschiff
Clouth
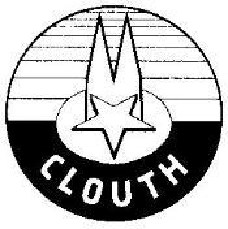
Clouth Firmen Logo

Tiefsee-Kabel

Altreifen
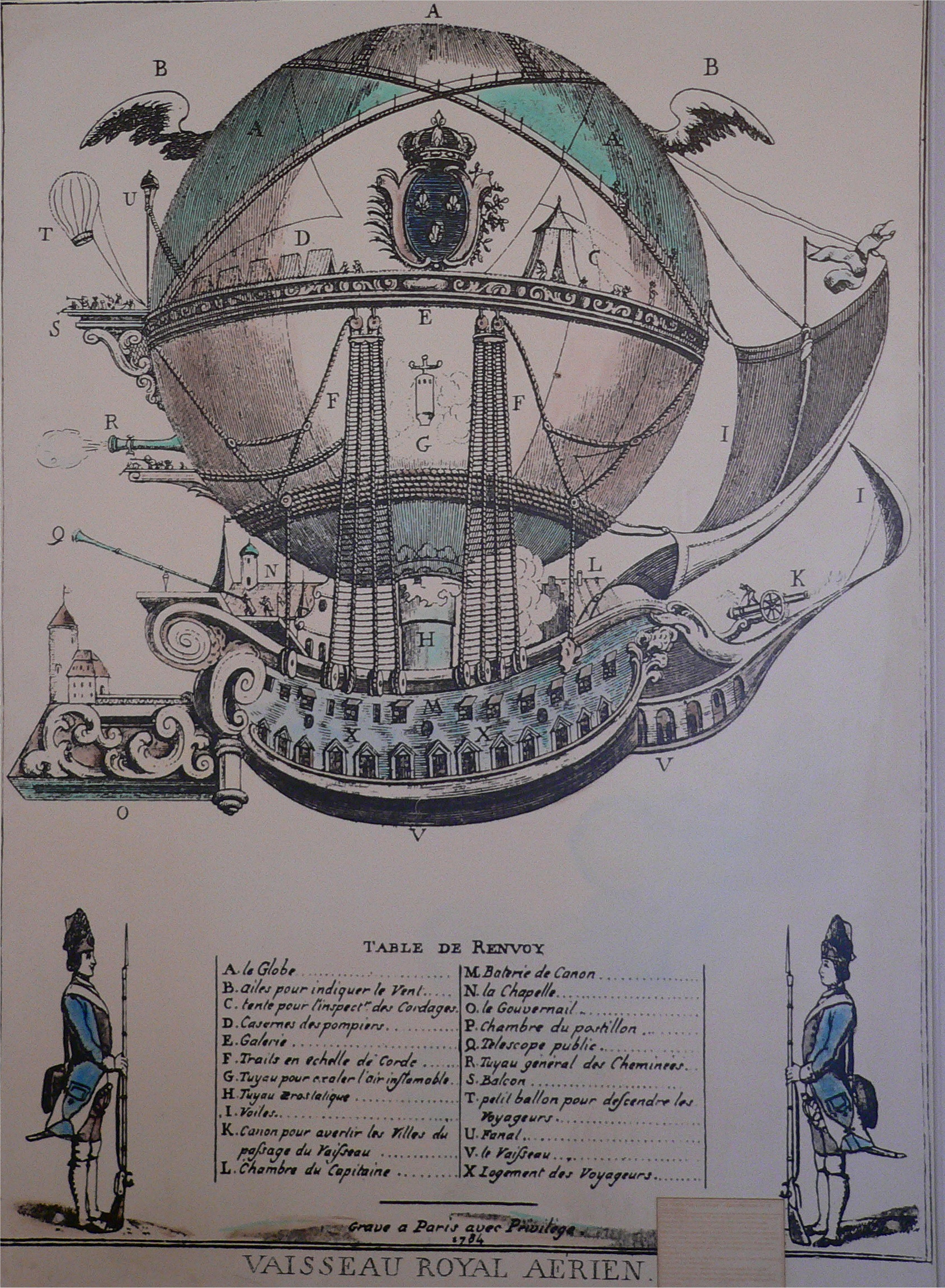
Erste Militärballons

Bakelite Radio
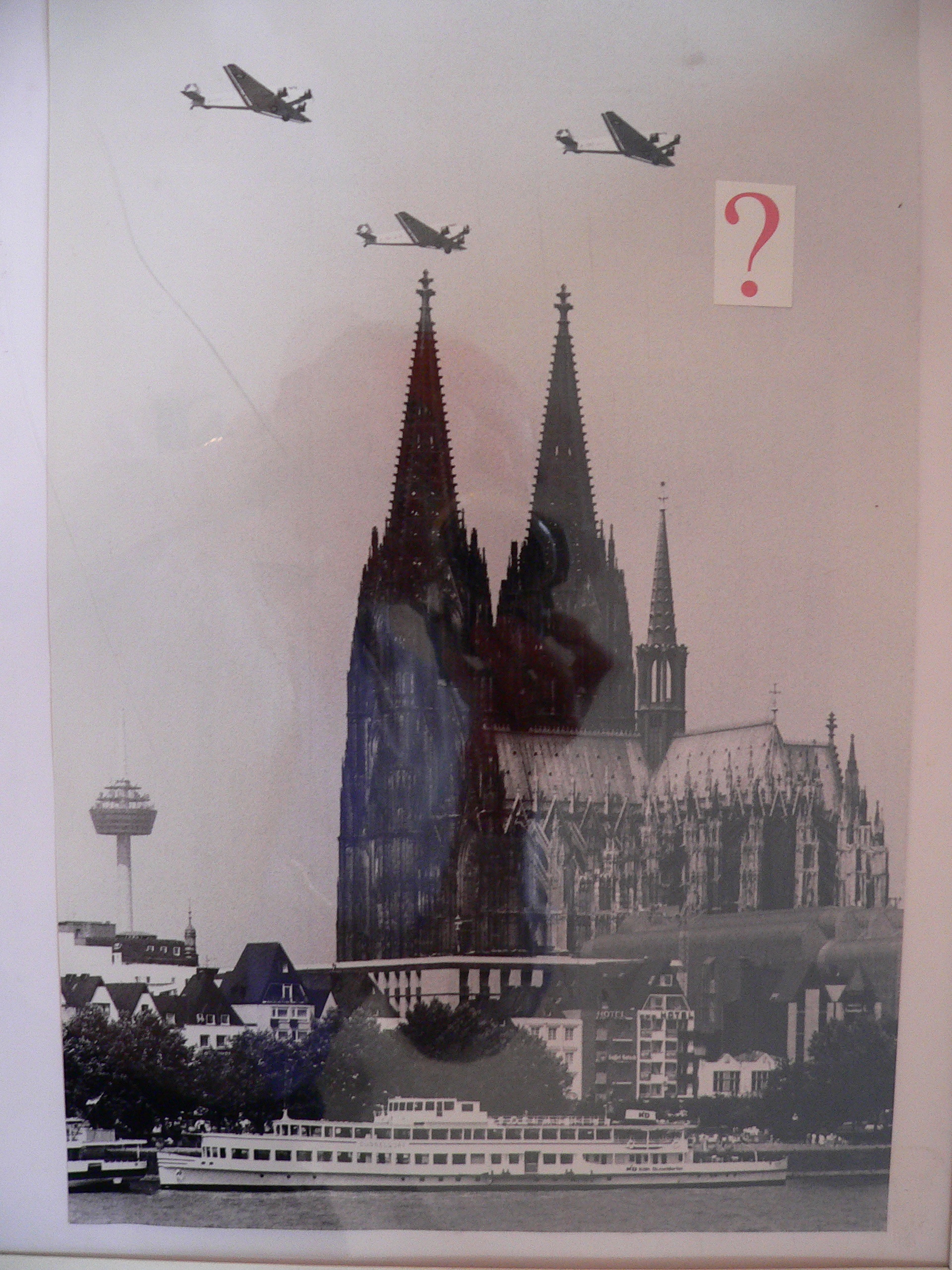
Cöln Anfang 20 Jhdt.
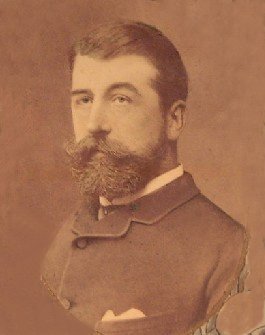
Franz Julius Hubert
Clouth
1862
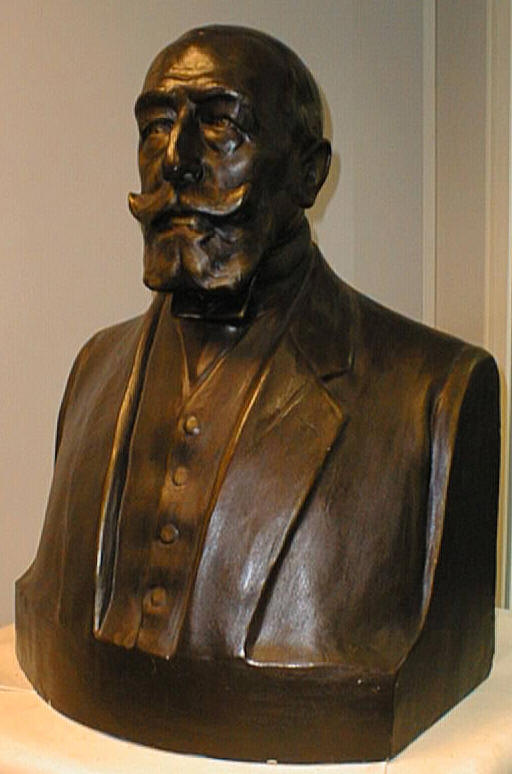
Bronze Büste Franz
Clouth

Franz Clouth 1905
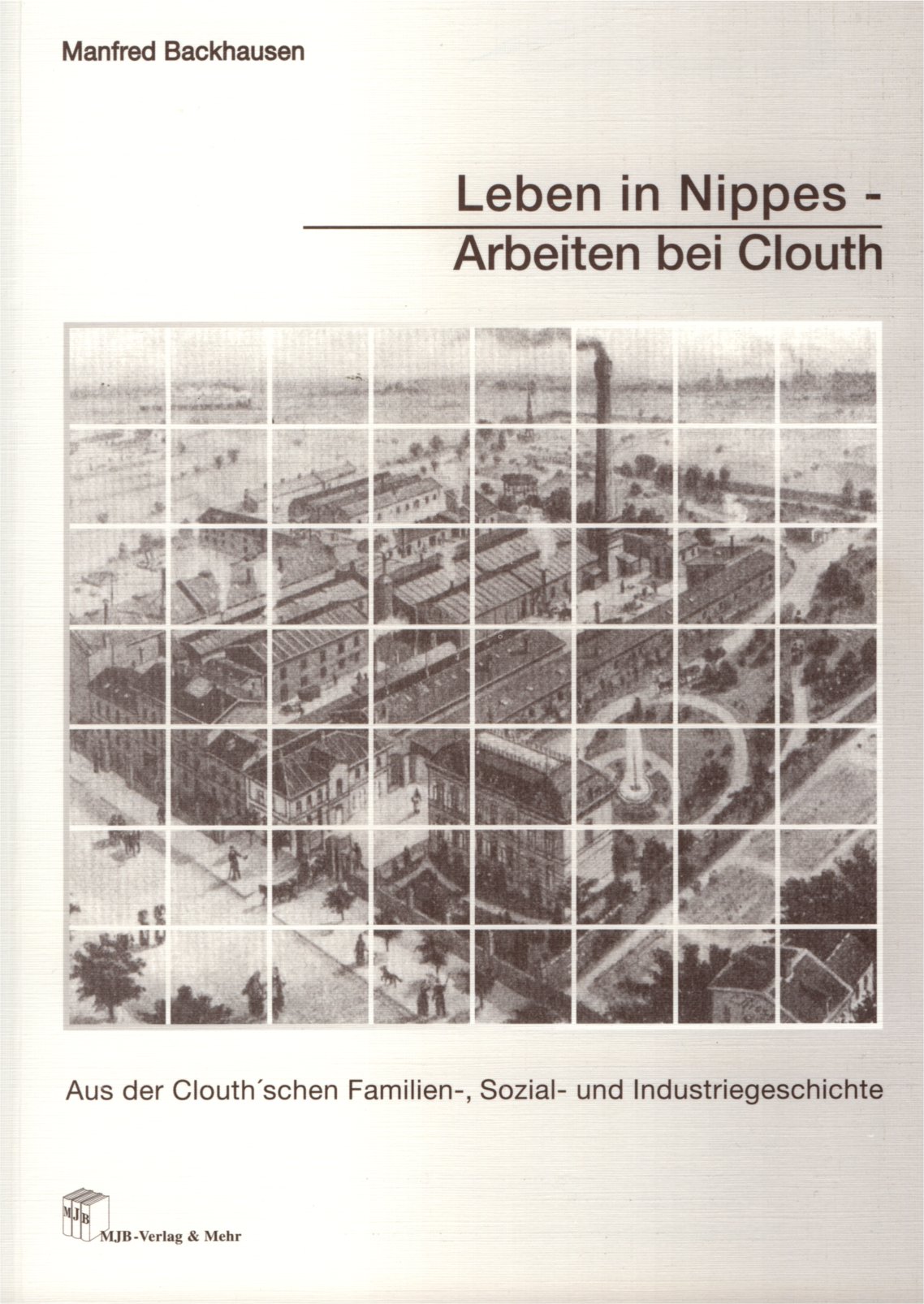
Clouth Book 1st Edition

Tauchhelm Clouth
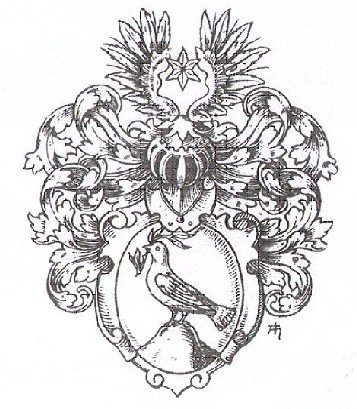
Altwappen Clouth
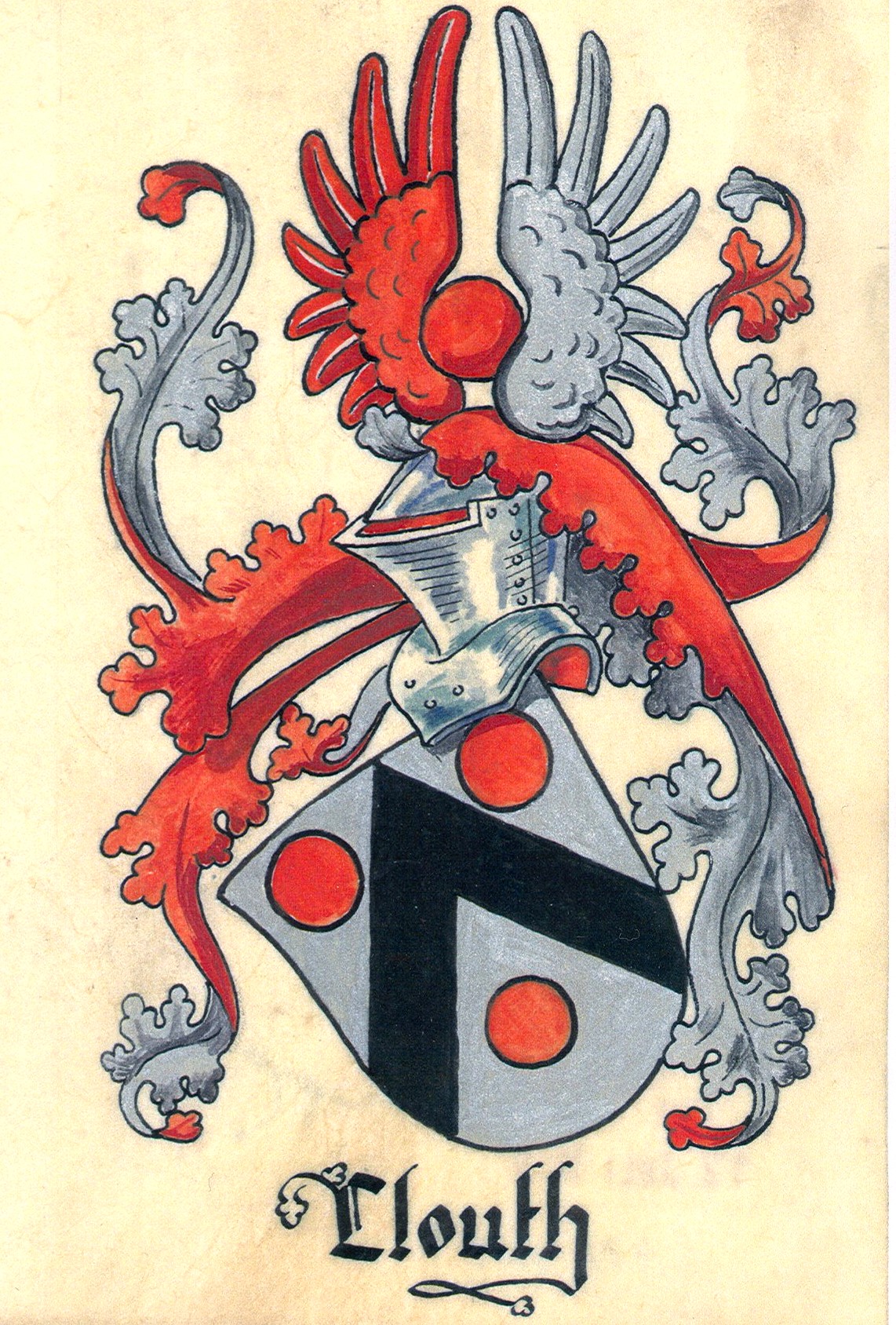
Clouth-Wappen 1923

Max Josef Wilhelm
Clouth
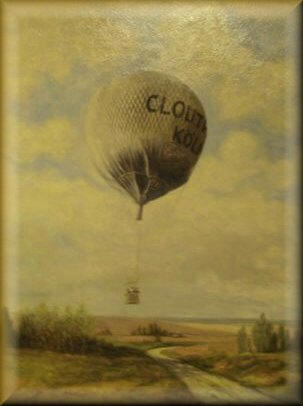
Preisbild
Ballonwettbewerb
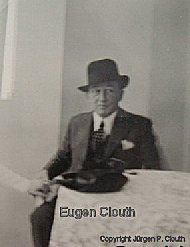
Eugen Clouth

"Anni" Heine Clouth
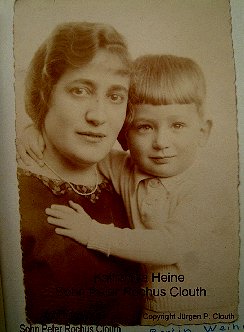
Anni & Peter

Peter Rochus Clouth

Margot Clouth, geb.
Krämer
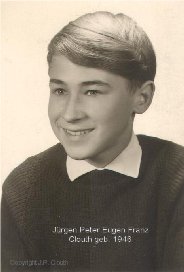
Jürgen Clouth 12

Vettern Peter (l) &
John (r)

Rechtsanwalt J.P.
Clouth

Ehefrau Audrey Clouth
15.1.1950-22.11.2017
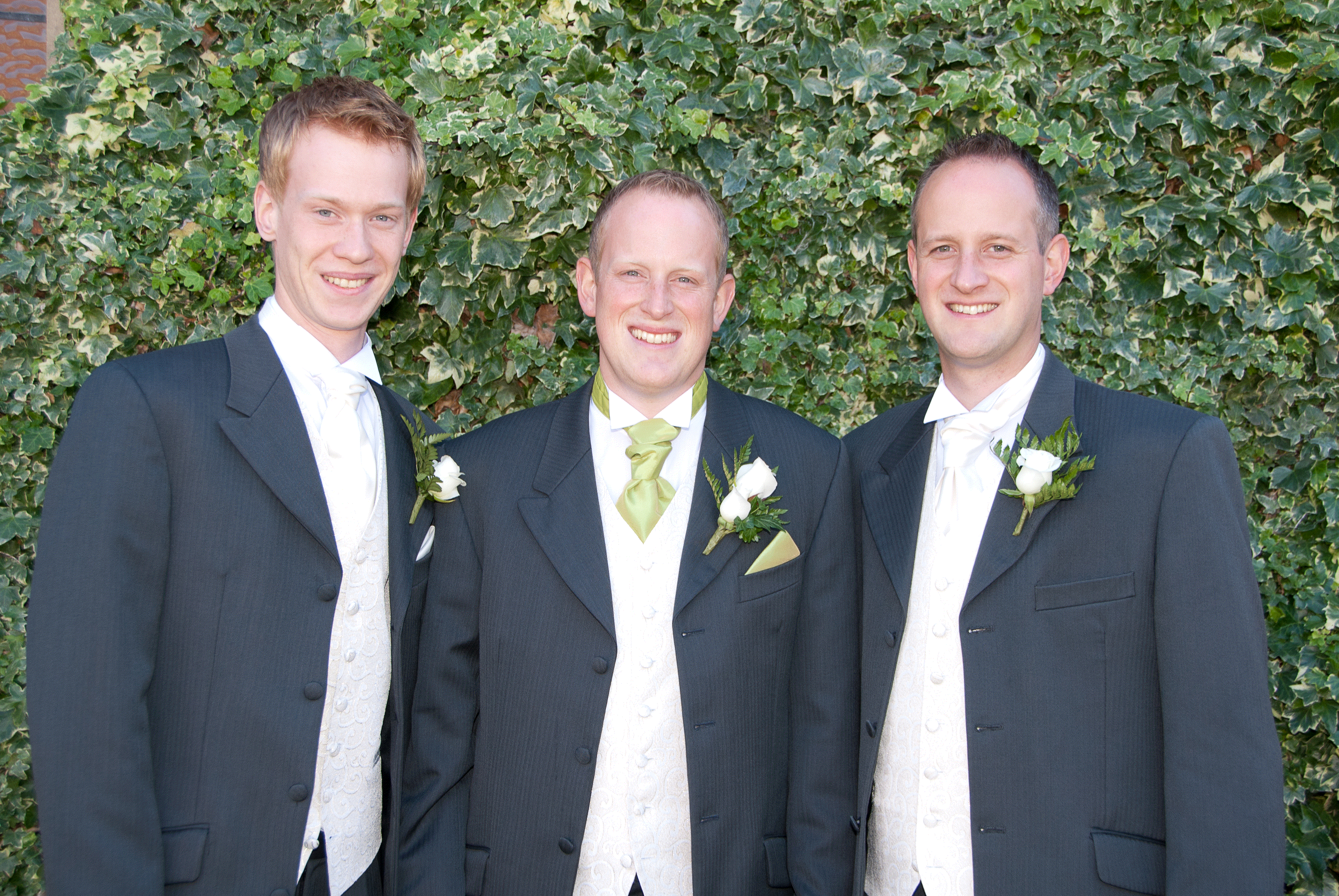
Bryan, Oliver,
Phillip

Jürgen Peter Clouth

Max Clouth
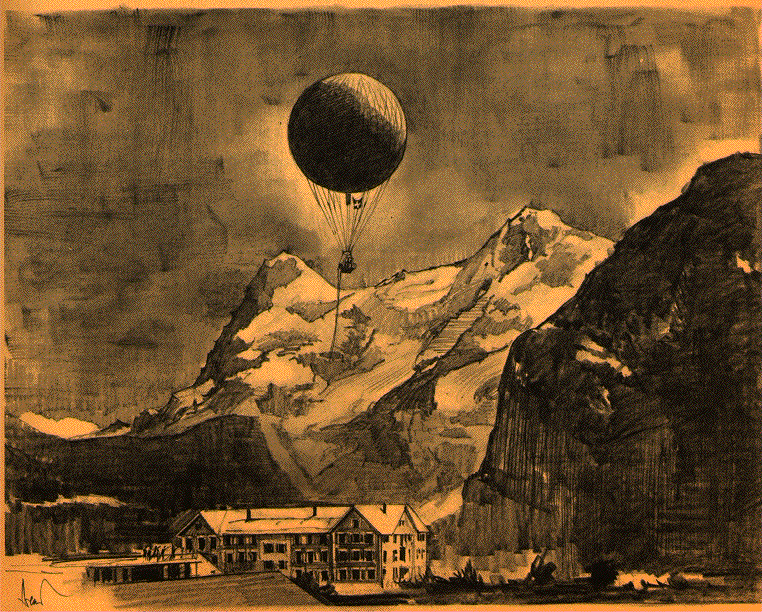
Ballon Sirius
Alpenquerung

Bakelite
Verteilerfinger
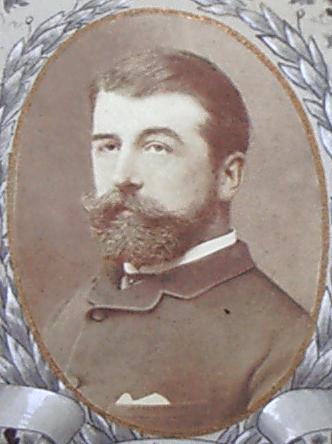
Franz Clouth

Eugen Clouth
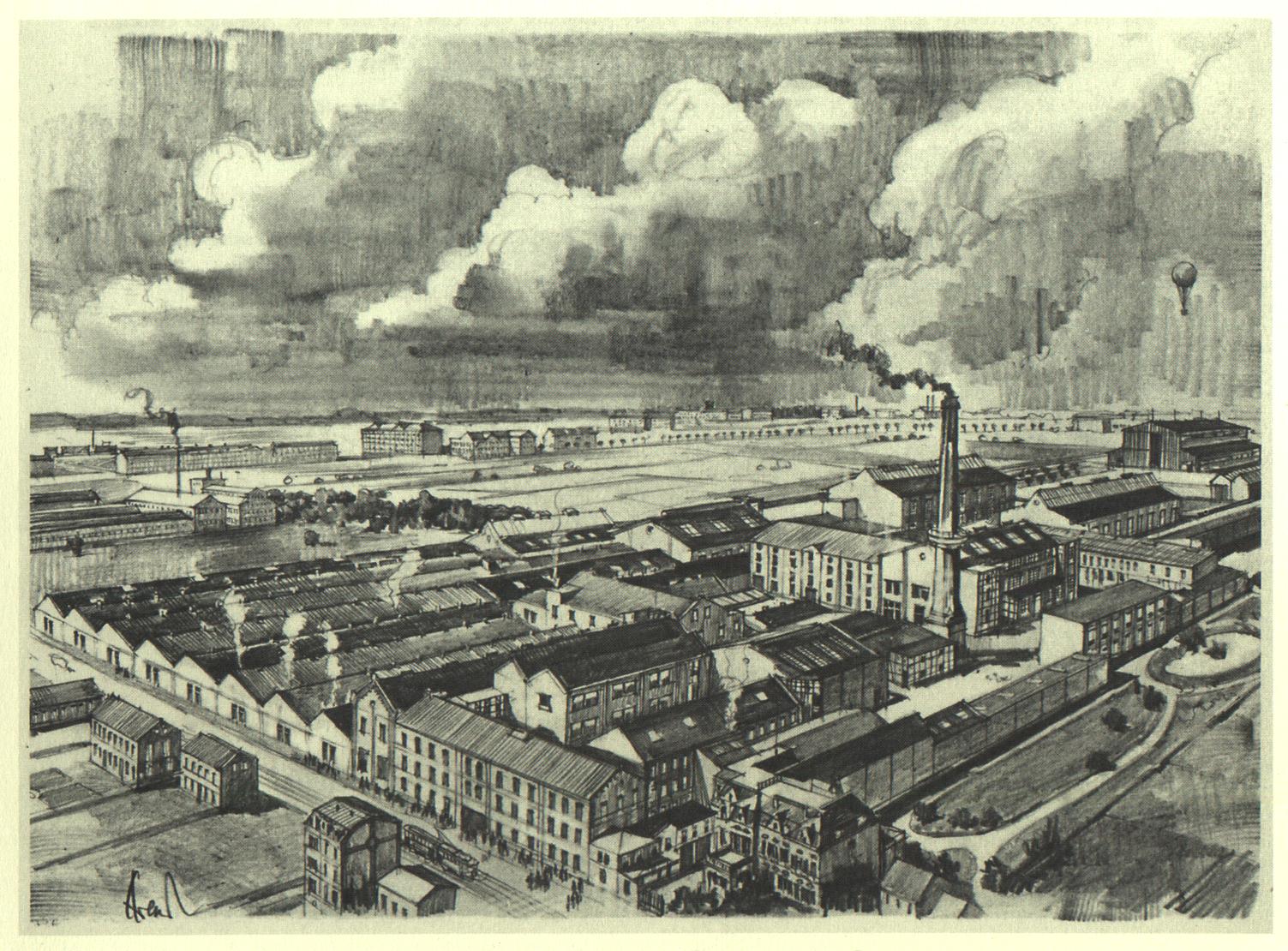
Clouth Werk
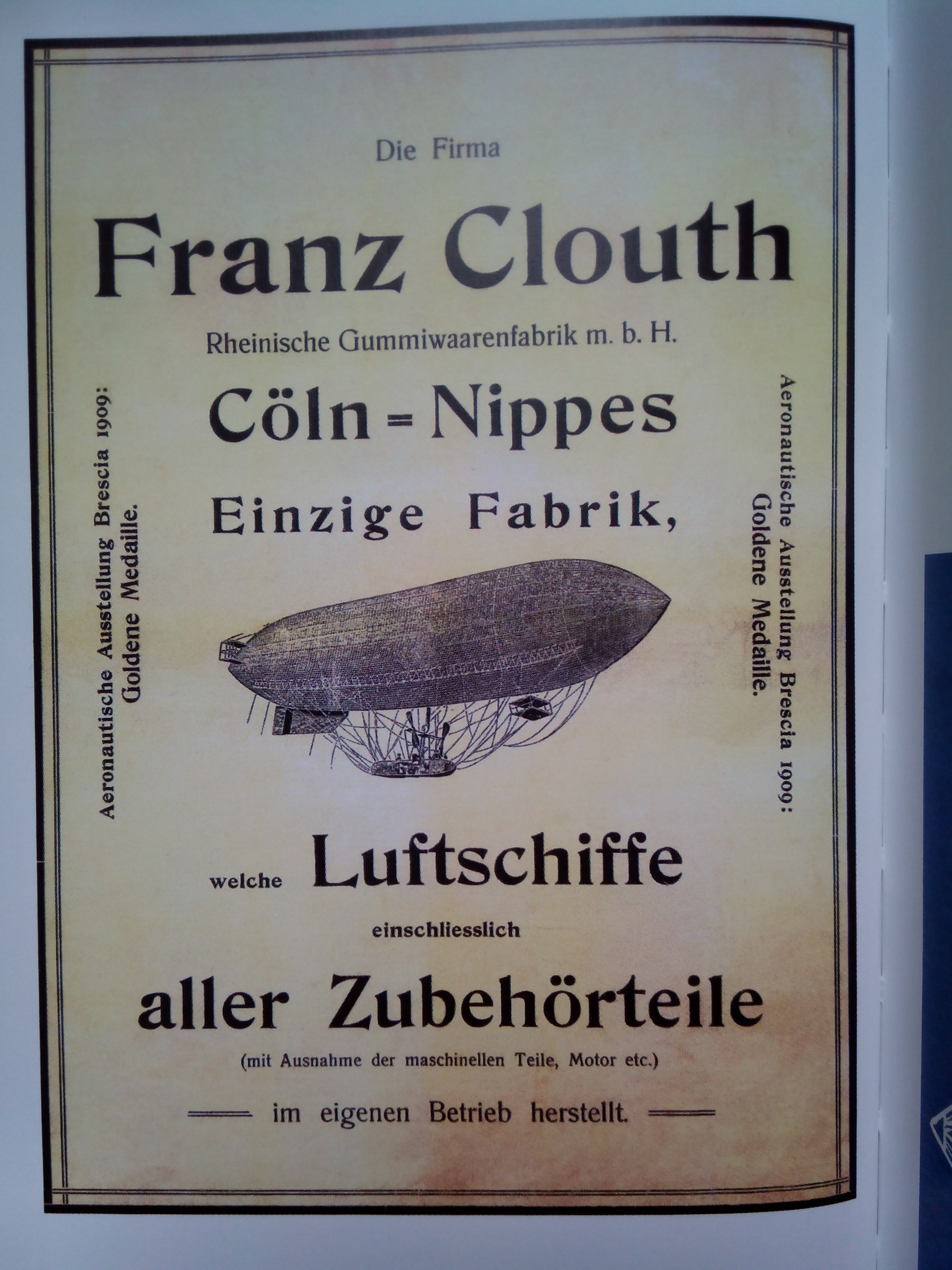
Clouth Werbung
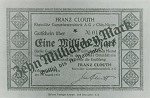
Clouth Notgeld

Clouth Werk

Alt-Autoreifen

Altfahrzeug

Daimler
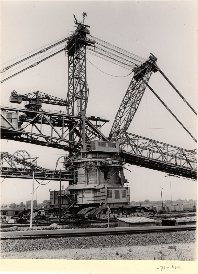
Förderbandkran
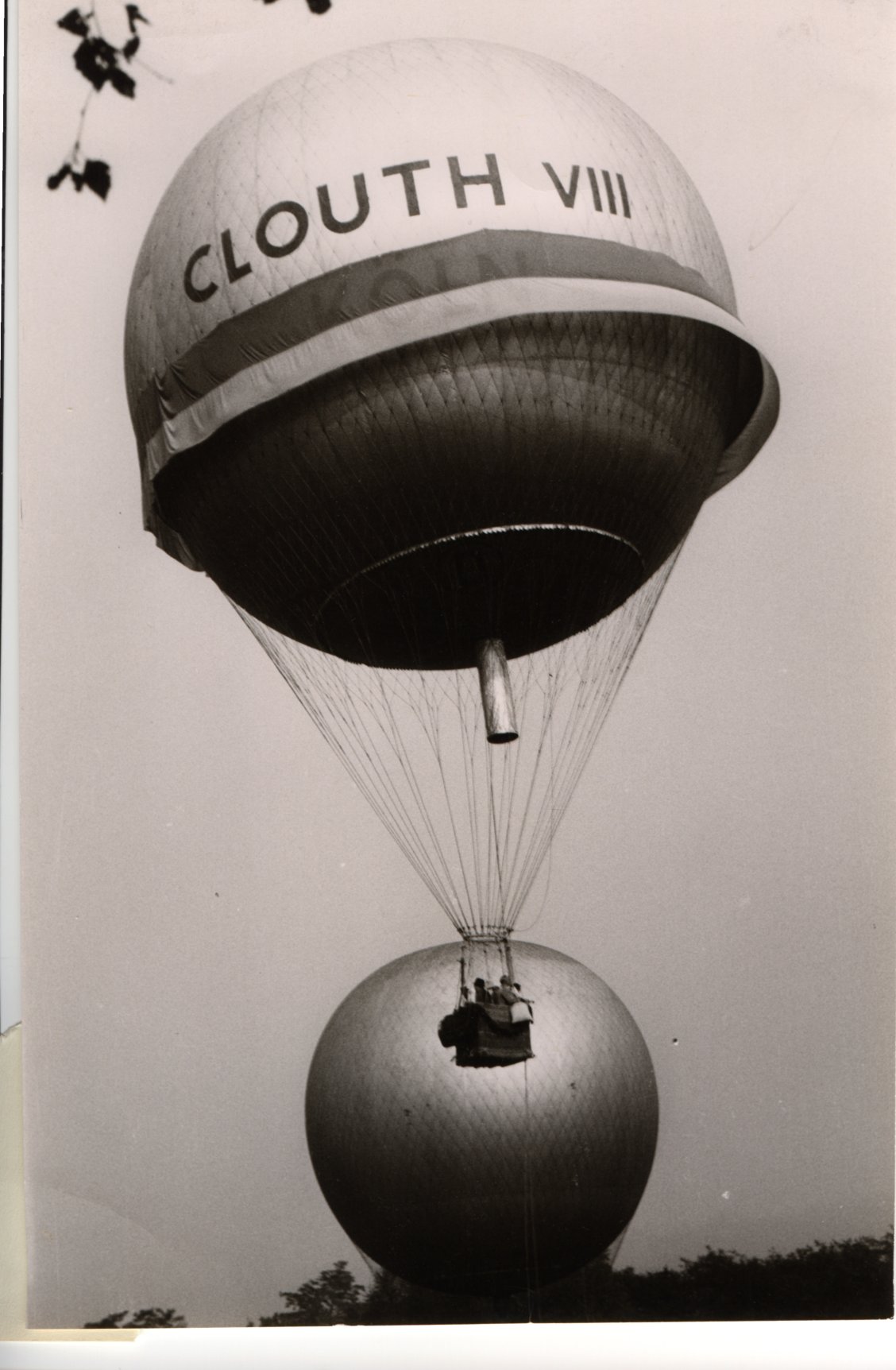
Clouth VIII Ballon

Wilhelm Clouth

Katharina Clouth

Caouchoc Golf Ball
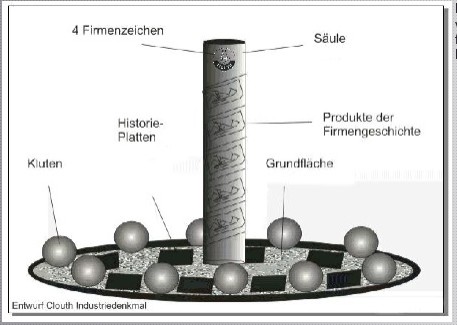
Skizze Clouth Denkmal
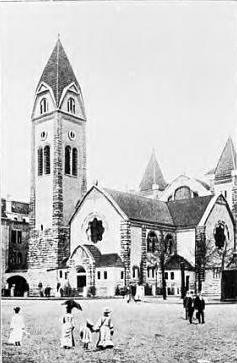
Altkatholische Kirche
Köln

Kabelaufroller
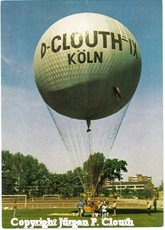
Clouth IX

Flugticket Clouth IX
.jpg)
Ballon Clouth IX über
Alpen
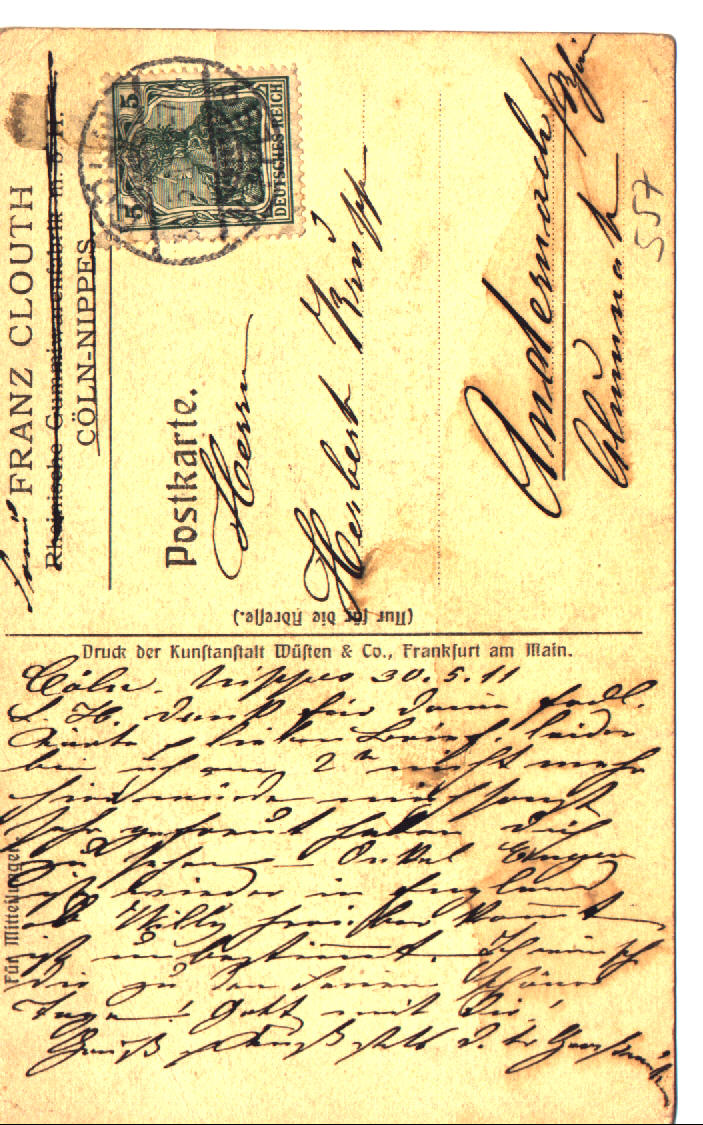
Post-Karte Franz Clouth
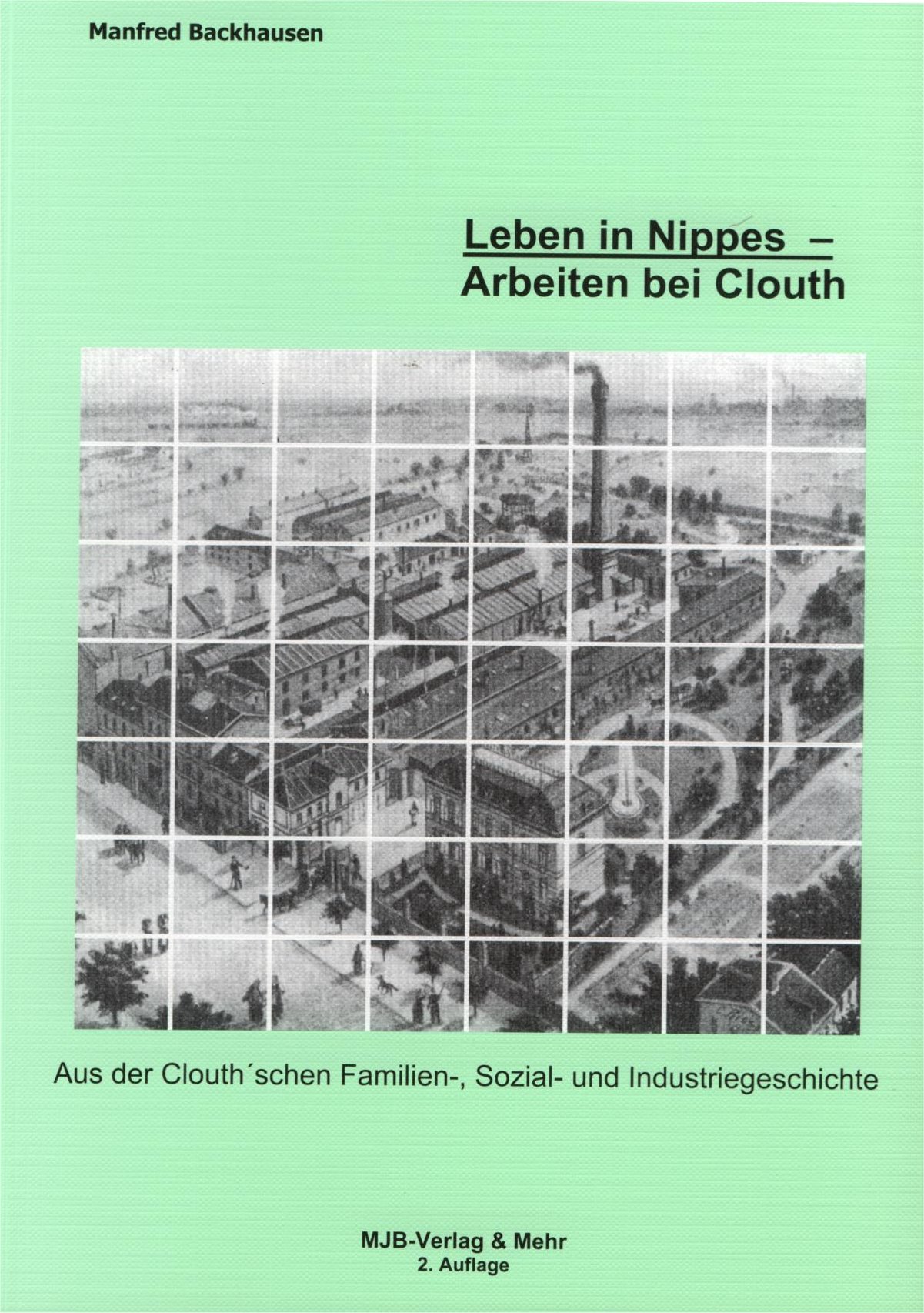
Clouth Buch 2.Ausgabe
.jpg)
Franz Clouth

Ballonkorb

Butzweilerhof Köln

Caouchoc Baum

Caouchoc Trocknung
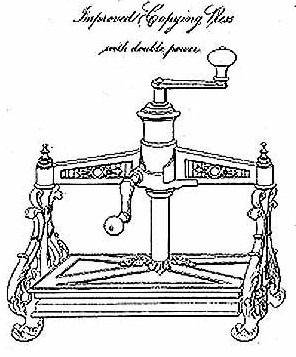
Kautschuk-Kopier System
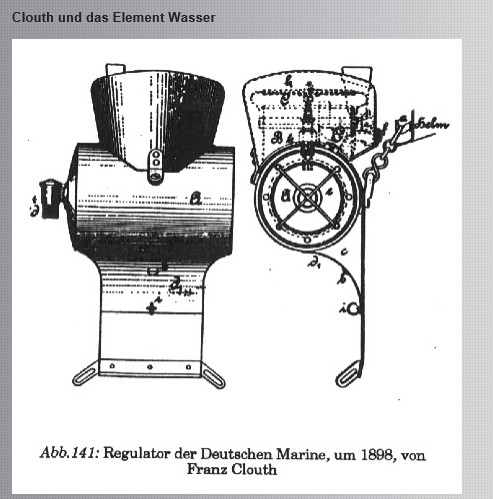
Wasser-Regulator
Clouth

Land & See Altes Logo

Land & See NEULogo
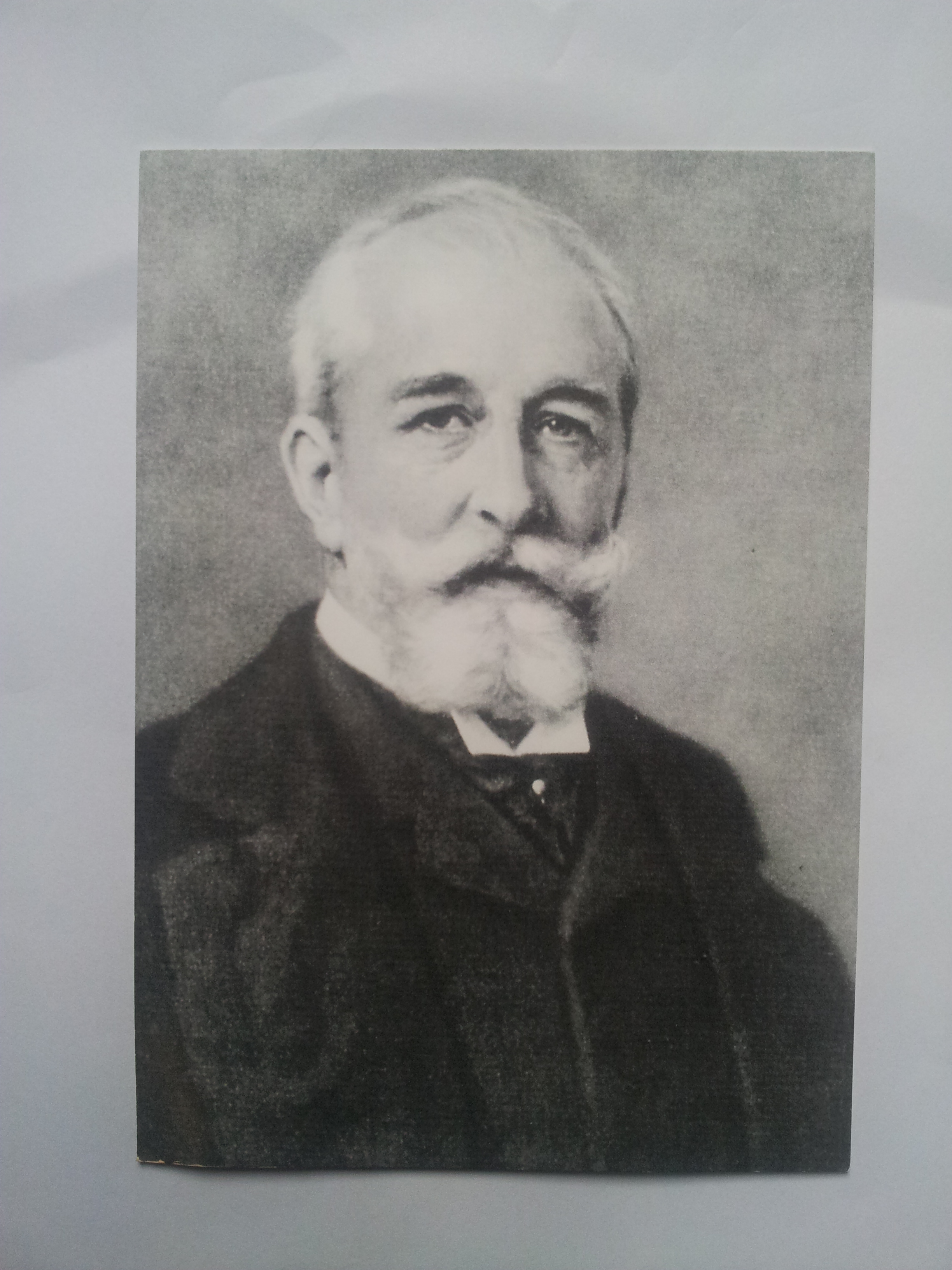
Franz Clouth

Richard Clouth
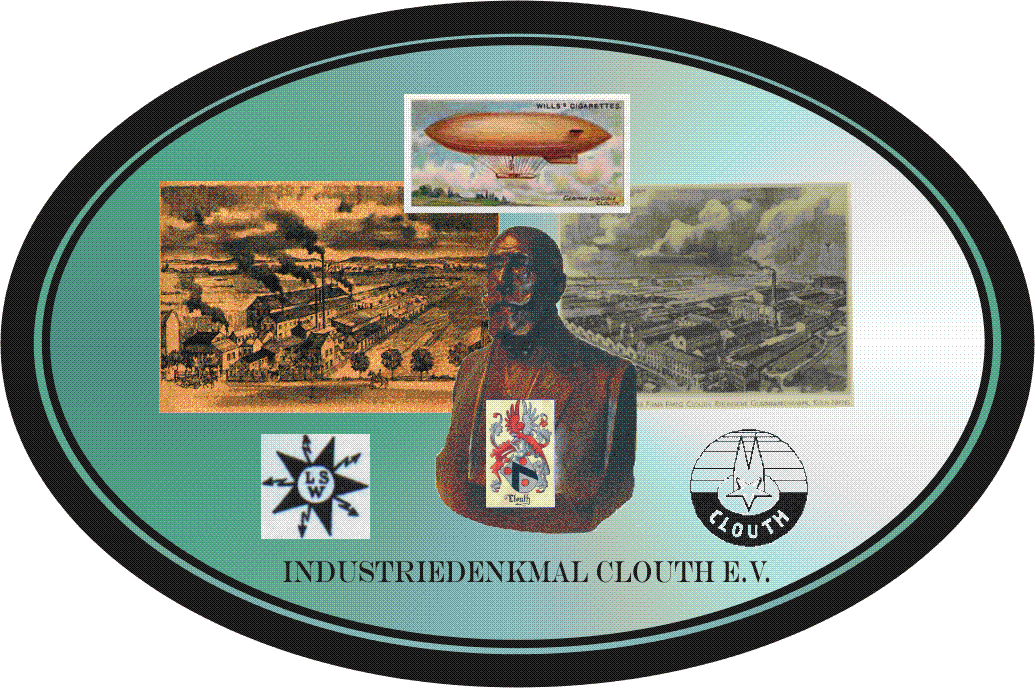
Industrieverein
Altlogo

Tauchergesellschaft
LOGO

Halle Förderband
Produktion

Firmentor 2

Bakelite Telefon

Podbielski
Kabellegeschiff
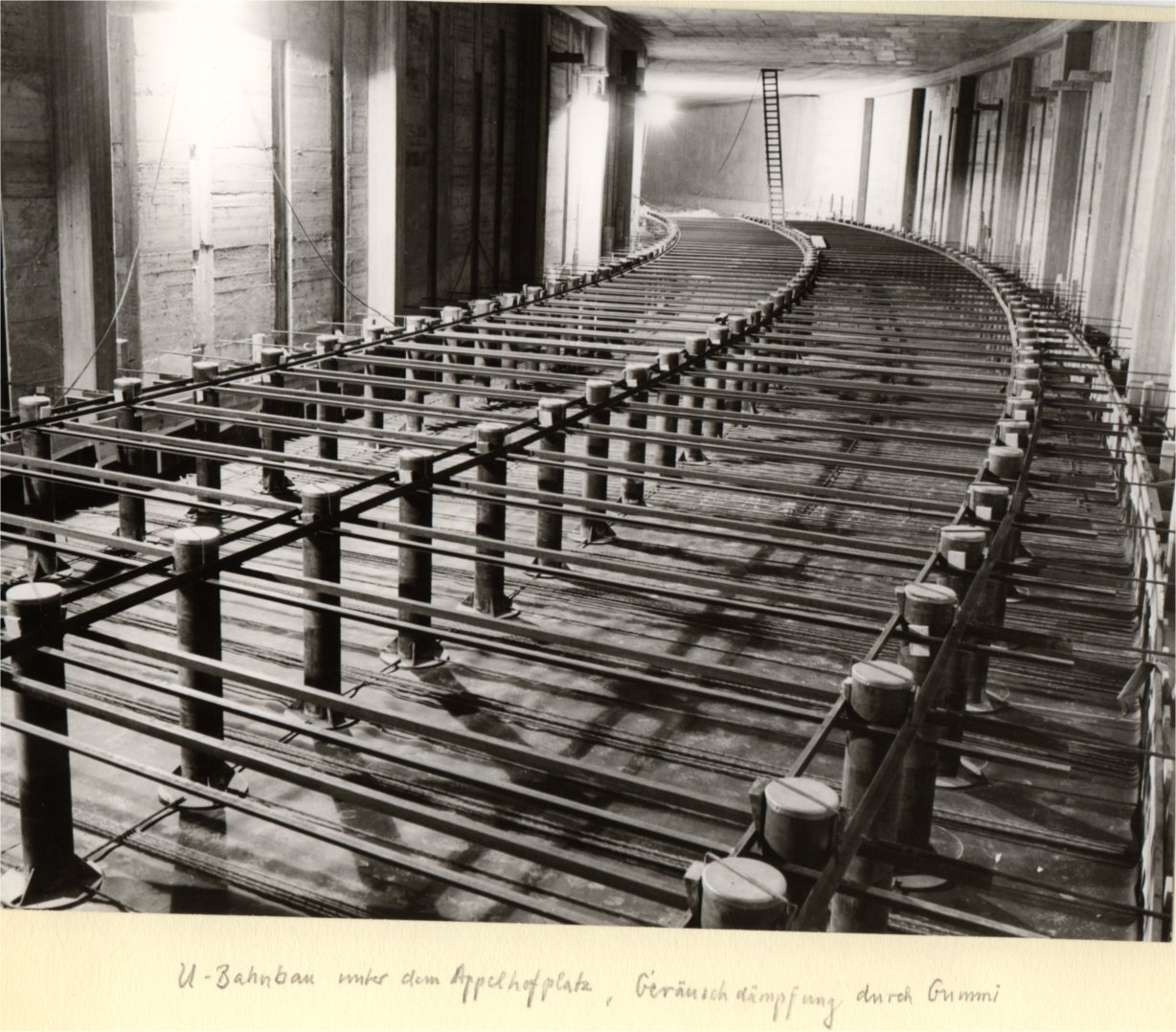
Kölner Ei
Geräuschdämmung
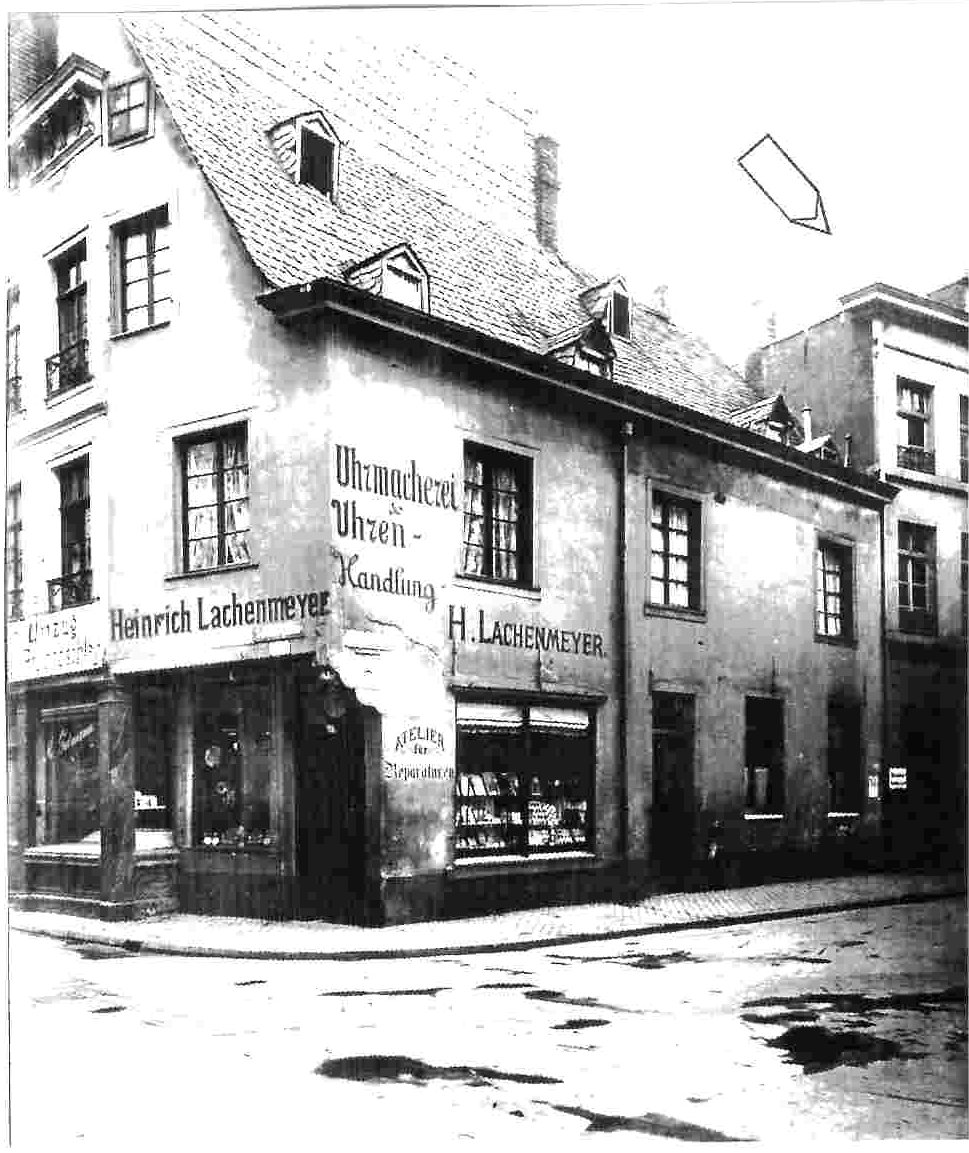
Druckerei Wilhelm
Clouth

Max Clouth ca.1950
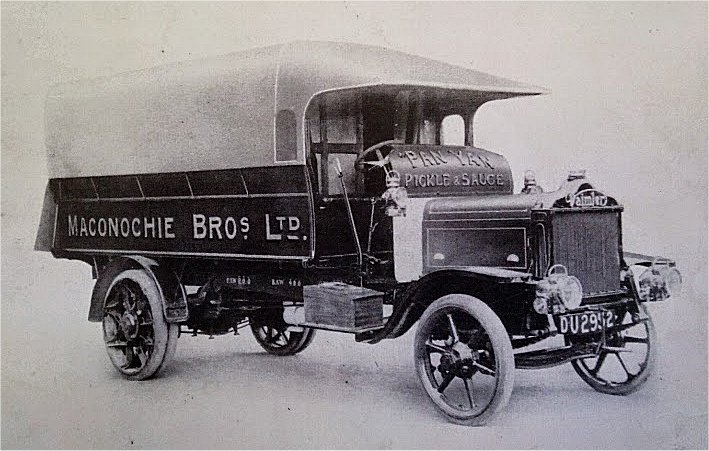
engl. Laster Daimler
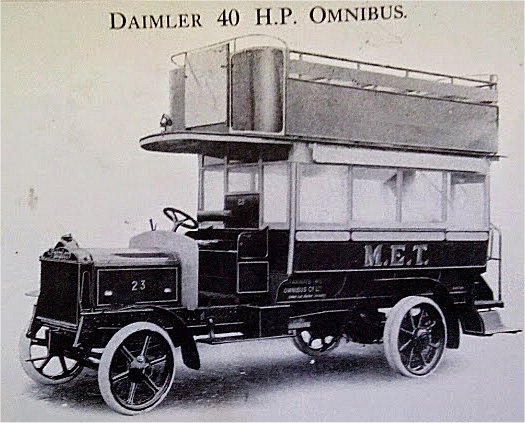
Daimler Bus

Ebonit-Telefon

Dampfmaschinen
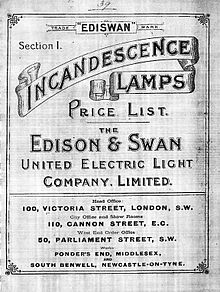
Lampenfortschritt

Bekelit-Radio

KNG Senatspräsident
J.Clouth

Juliane Heine/Hardware

Pfarrer W. Kestermann

Alt-Katholische Kirche
Köln
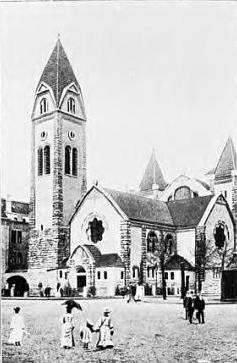
Alte Alt-Kath. Kirche
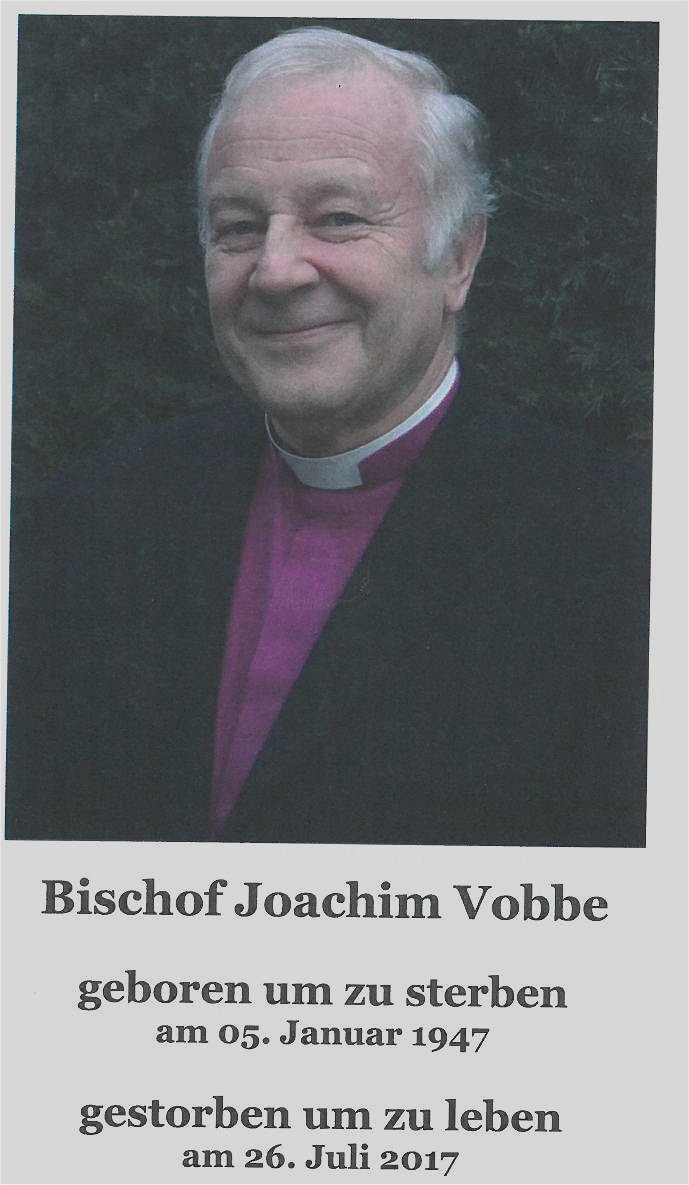
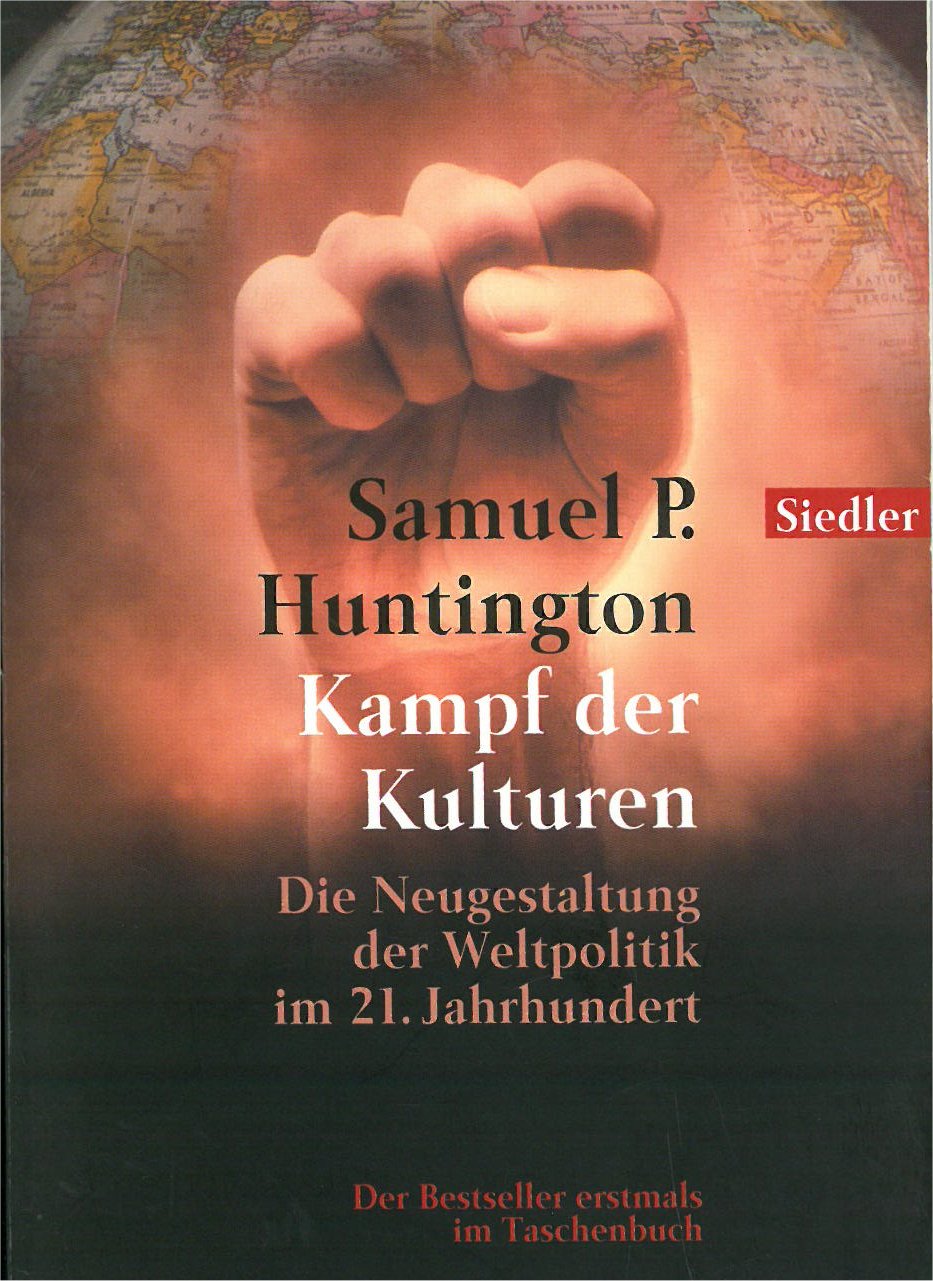
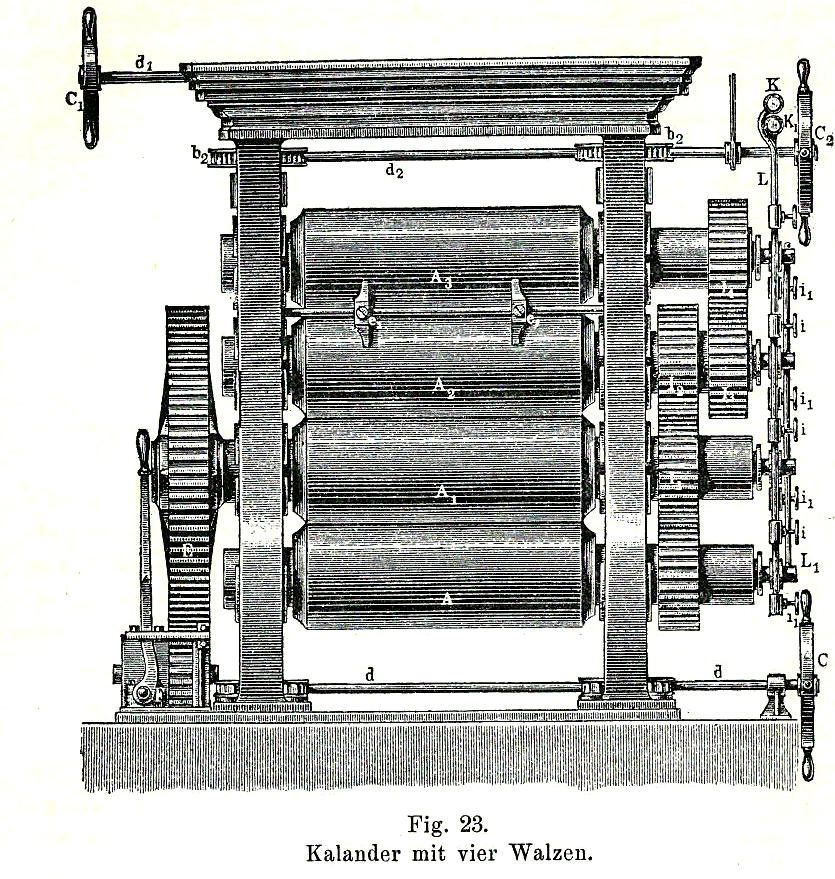
Walzwerk für Gummi
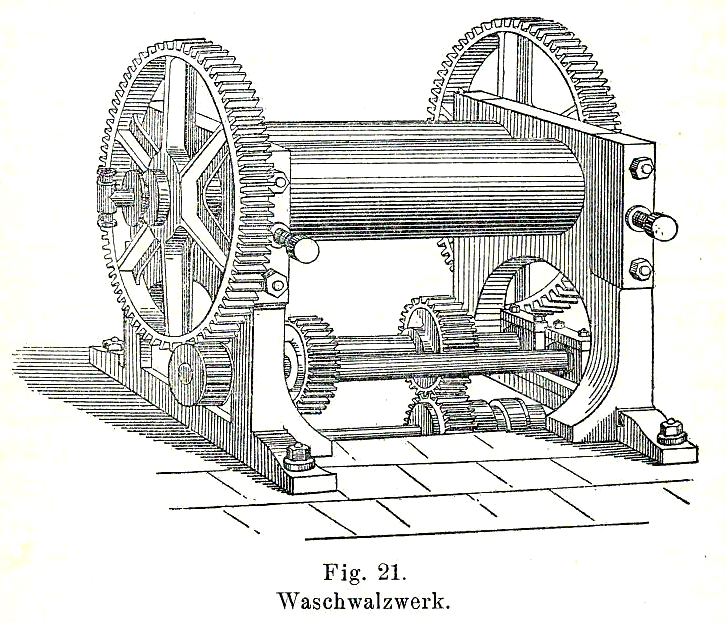
Walzwerk 2

Guttapercha
Pflanze
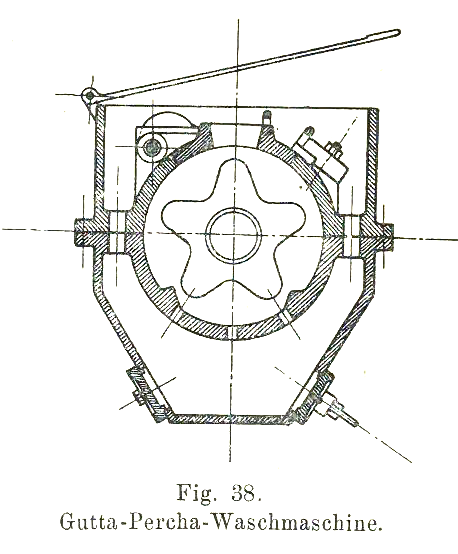
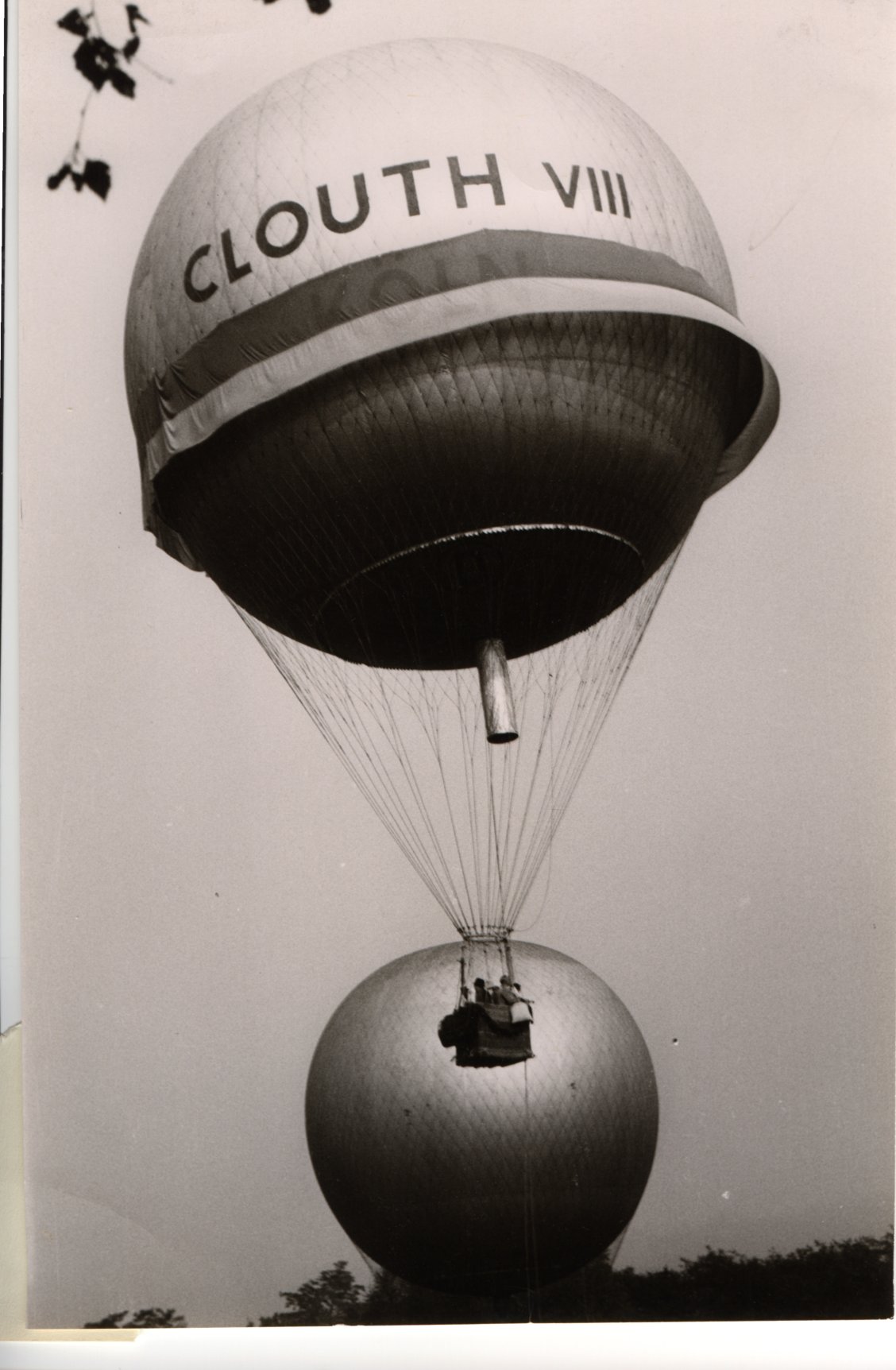
Tauffahrt Clouth VIII

Katharina Clouth
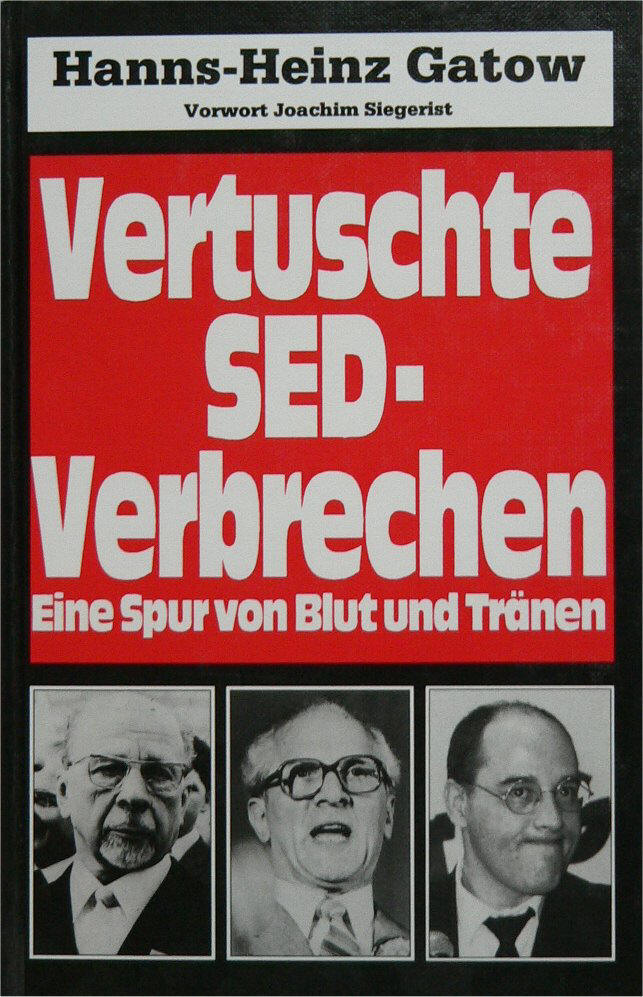
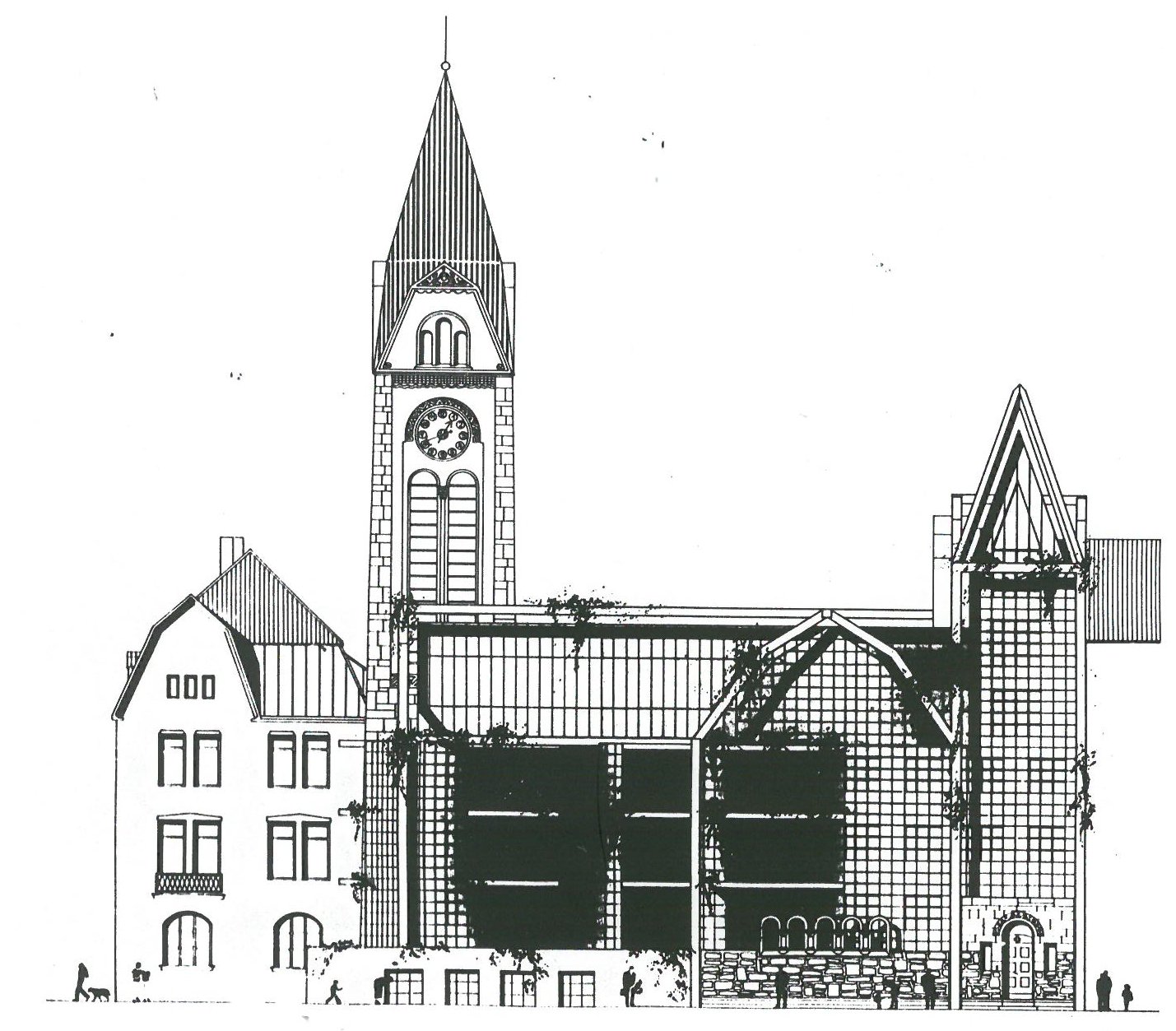
Alt-Katholische Kirche
Köln
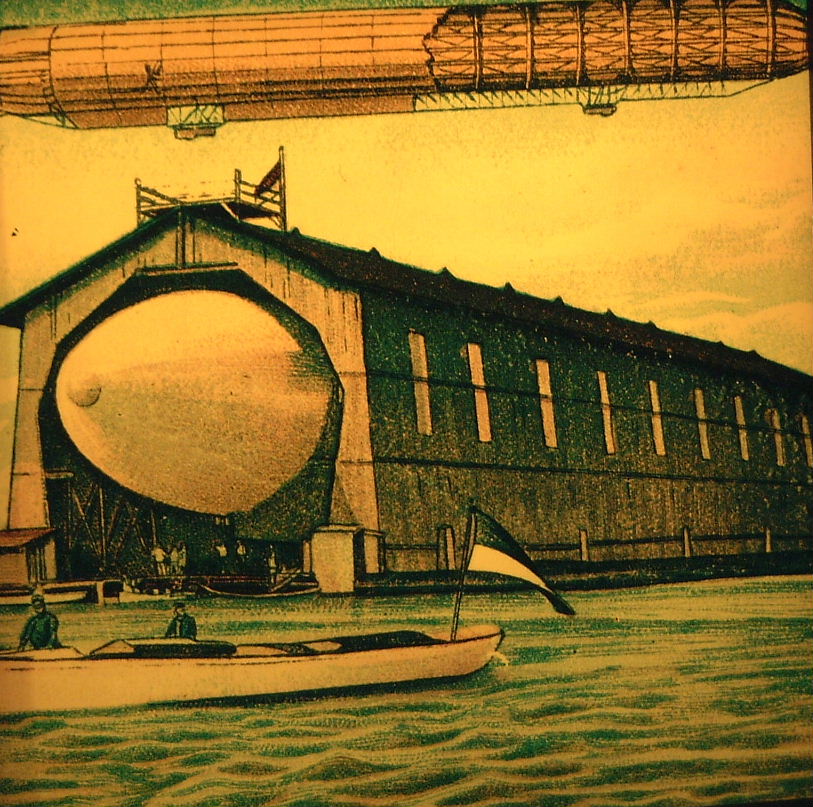
Ballonhalle

Flugobjekt-Wandel ab
1910

Charles Goodyear

Rubber Sheets
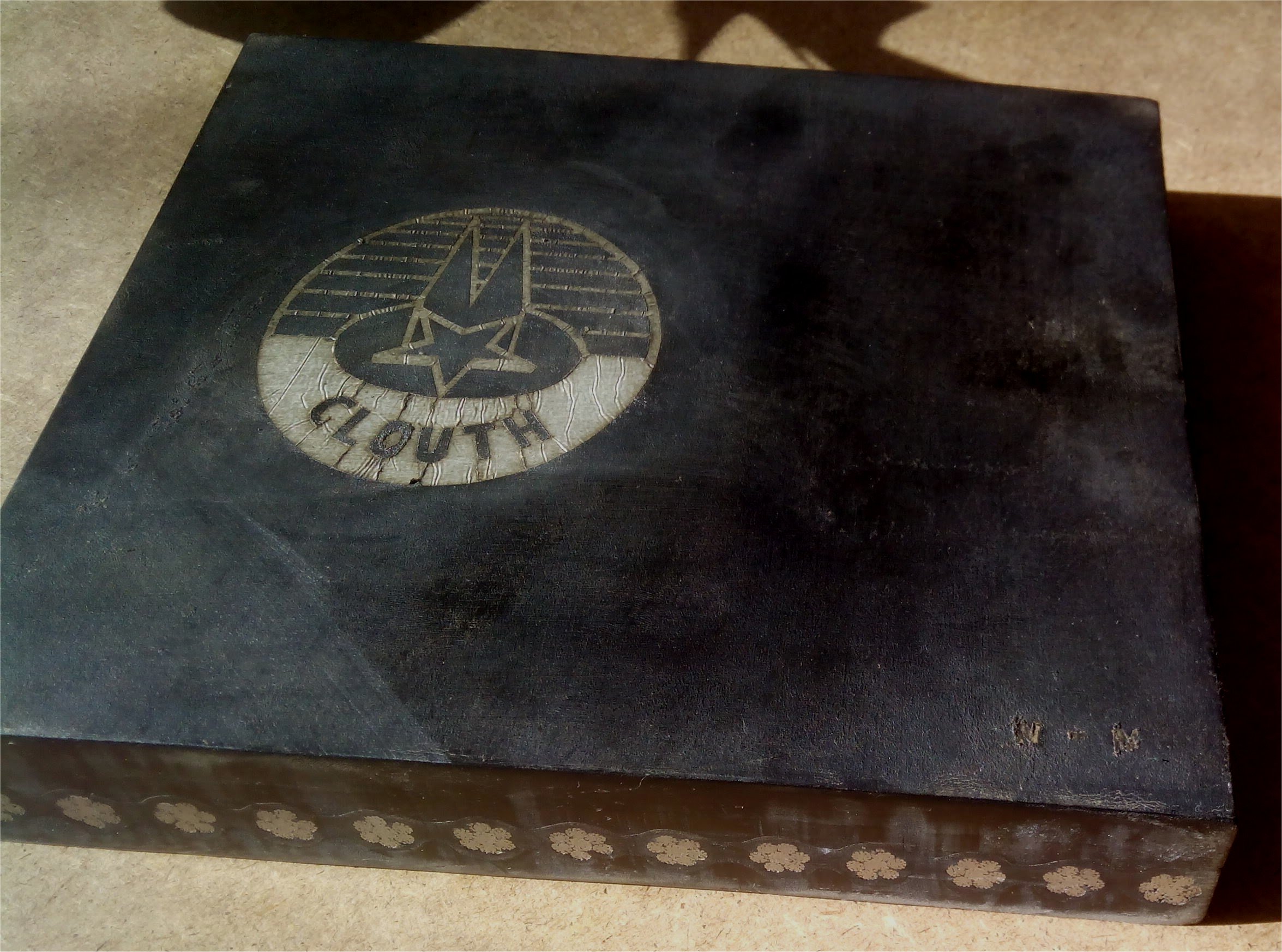
Clouth Förderband

Clouth Pentagon 1899

Audrey Clouth 2017

Rohkautschuk
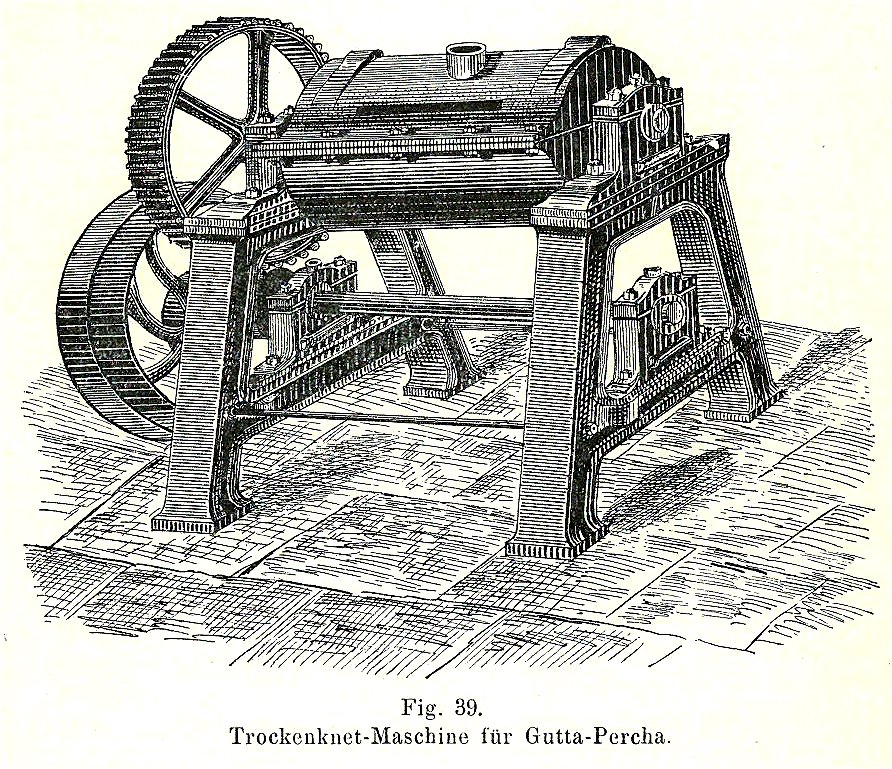
Guttapercha Wäscher
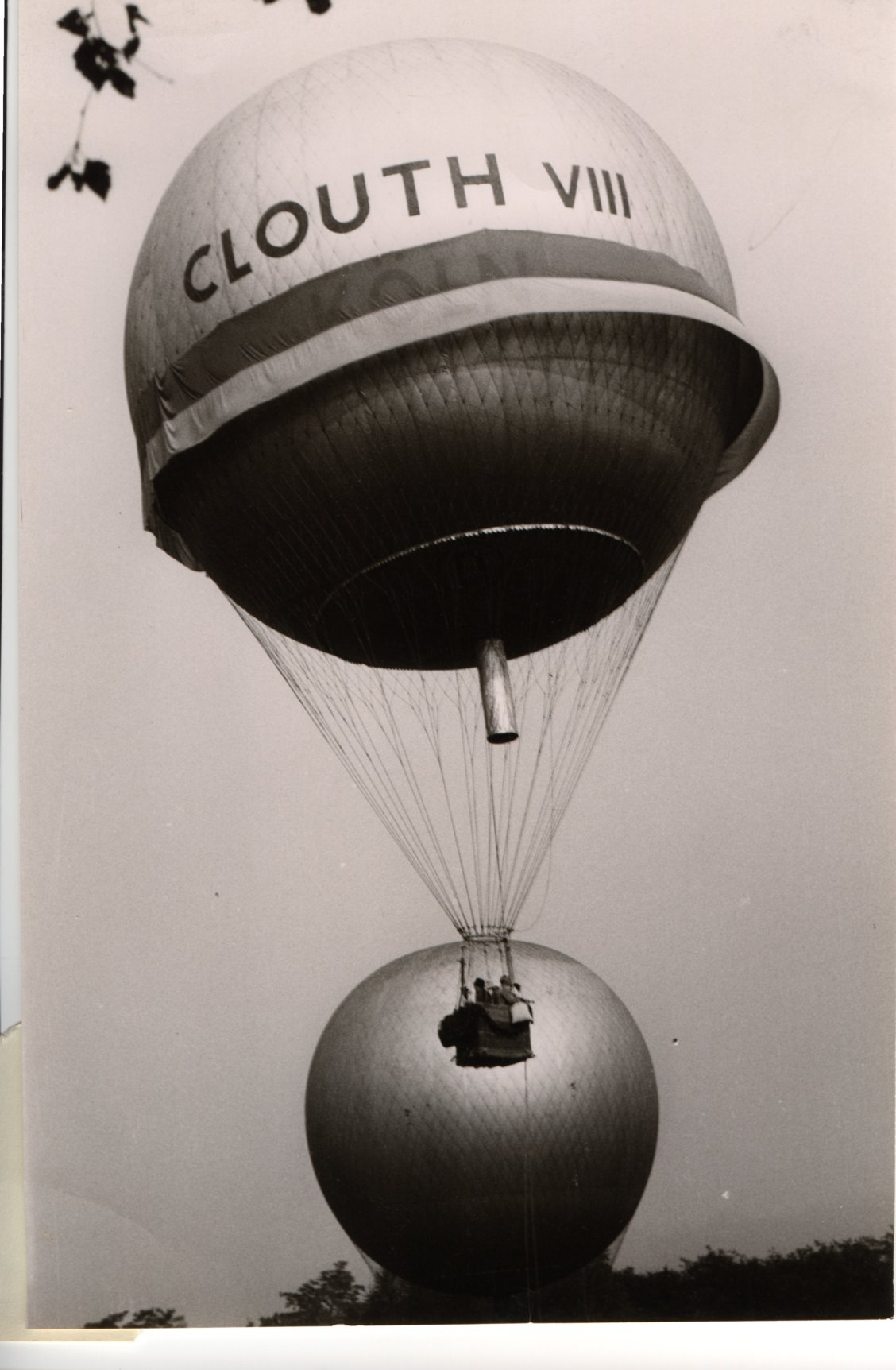
Ballon Clouth VIII

Anni Heine-Clouth
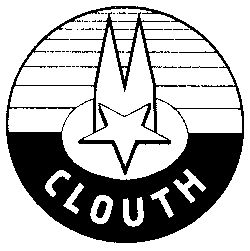
LOGO Sternengasse

J.P. Clouth

Josefine Clouth

Ella Clouth

Altkatholische Kirche
Köln

Köln

Cölner Dom
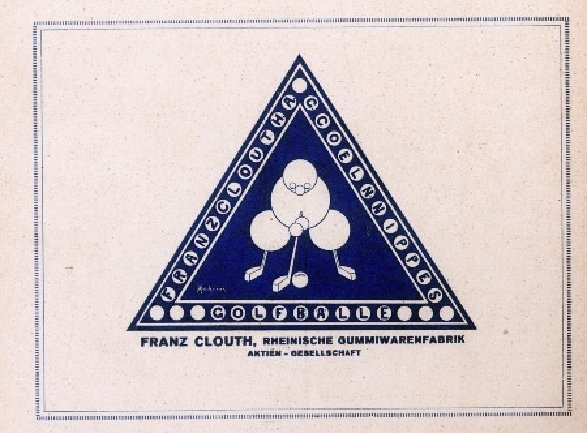
Golfballwerbung

Clouth Tauchhelm

Clouth Taucheranzug
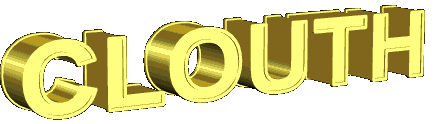
| |
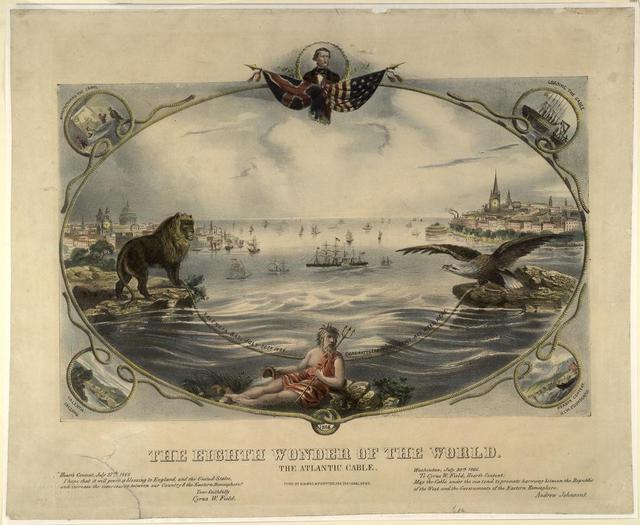

Land & See Kabelwerk,
gegründet von Franz Clouth
Um 1898 planen die Felten & Guilleaume
Carlswerk AG. und die Land- und Seekabelwerke AG., eine Gründung von Franz
Clouth, unabhängig voneinander,
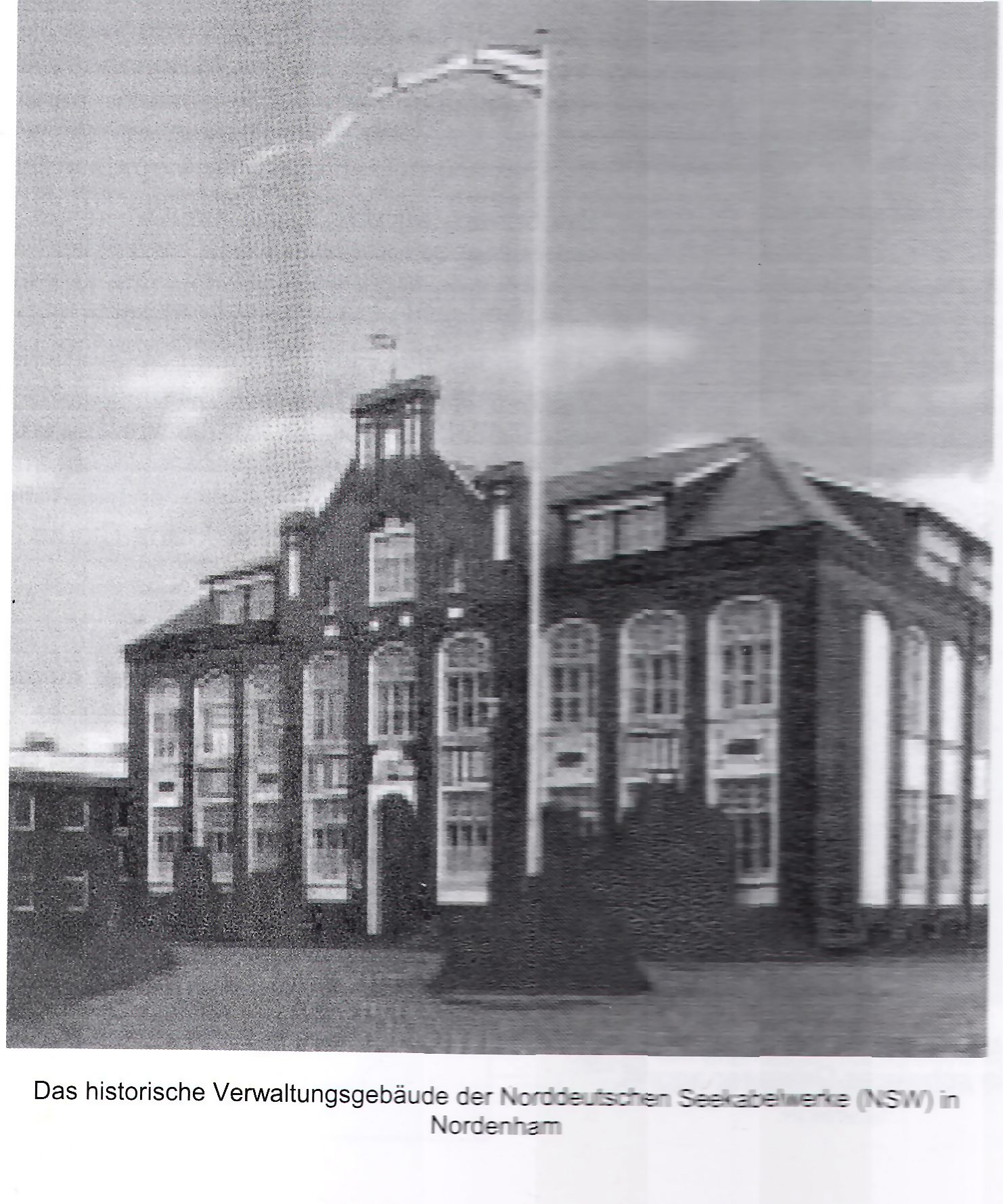
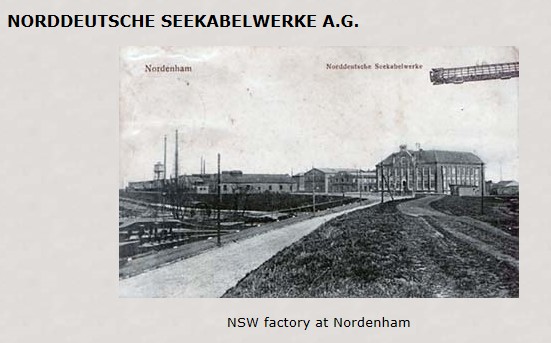
Norddeutsche Kabelwerke GmbH & Co KG;
Nordenham (Unterweser), Kabelstr-9-11
zunächst Franz Clouth, dann Felten &
Guilleaume, dann Siemens, dann Corning, je ein Seekabelwerk an der
deutschen Küste anzulegen. Als
die deutschen Pläne, ein deutsches überseeisches Kabelnetz zu schaffen, ihrer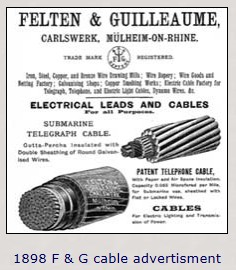 Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-
und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern
Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-
und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern
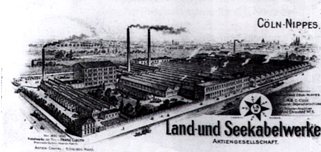 Deutschlands,
die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen
Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der
deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer
auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer
geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel
unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer
verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die
Errichtung einer Kabelfabrik Deutschlands,
die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen
Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der
deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer
auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer
geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel
unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer
verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die
Errichtung einer Kabelfabrik
 Ein transatlantisches
Telefonkabel (TAT) oder Transatlantikkabel ist ein
Unterwasserkabel für den Ein transatlantisches
Telefonkabel (TAT) oder Transatlantikkabel ist ein
Unterwasserkabel für den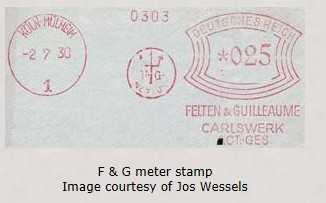 Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des
Atlantischen Ozeans
verlegt ist. Bevor 1956 das erste Transatlantik-Telefonkabel TAT-1 in Betrieb
ging, basierte der seit 1927 bestehende transatlantische Telefondienst auf
Langwellenfunk; dieser Dienst kostete neun britische Pfund pro angefangene drei
Minuten. Auf diese Weise wurden zuletzt 2.000 Telefongespräche pro Jahr
abgewickelt. Zuvor gab es erst seit 1866 eine dauerhafte Transatlantikverbindung
nur für Telegrafie. Seekabel müssen wegen der technisch aufwändigen Wartung
außerordentlich robust gebaut sein. Monopolare Seekabel für die
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung müssen auf
Seekarten markiert sein,
da sie durch ihr Magnetfeld Kompassanlagen von Schiffen beträchtlich stören
können.
Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des
Atlantischen Ozeans
verlegt ist. Bevor 1956 das erste Transatlantik-Telefonkabel TAT-1 in Betrieb
ging, basierte der seit 1927 bestehende transatlantische Telefondienst auf
Langwellenfunk; dieser Dienst kostete neun britische Pfund pro angefangene drei
Minuten. Auf diese Weise wurden zuletzt 2.000 Telefongespräche pro Jahr
abgewickelt. Zuvor gab es erst seit 1866 eine dauerhafte Transatlantikverbindung
nur für Telegrafie. Seekabel müssen wegen der technisch aufwändigen Wartung
außerordentlich robust gebaut sein. Monopolare Seekabel für die
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung müssen auf
Seekarten markiert sein,
da sie durch ihr Magnetfeld Kompassanlagen von Schiffen beträchtlich stören
können.
Der
erste Versuch, zwischen Großbritannien und Amerika ein Kabel zu
verlegen, fand in den Jahren 1857 und 1858 statt. Dabei konnte zwar
auf gute Erfahrungen mit Küstenkabeln zurückgegriffen werden; das
quer über den Atlantik verlegte Kabel wurde jedoch nach wenigen
Betriebswochen unbrauchbar, da
Wildman-Whitehouse
im Betrieb zu hohe Spannungen verwendete. Es wird vermutet, dass das
Kabel aufgrund von Isolationsproblemen, die in der Herstellung und
Handhabung des Kabels begründet waren, keine lange Lebensdauer
gehabt hätte.
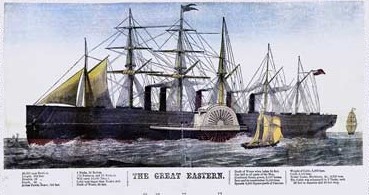 Zehn
Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,
die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden
sogenannte
bespulte Leitungen
in Form von
Seekabeln
verwendet. 1865 wurde durch das Dampfschiff
Great Eastern
eine neue transatlantische Linie verlegt; doch das Kabel riss
600 Meilen vor der Küste
Neufundlands
und konnte nicht geborgen werden. Zwischen dem 13. und 27. Juli 1866
wurde erneut durch die Great Eastern ein weiteres Kabel verlegt und
am folgenden 28. Juli 1866 in Betrieb genommen. Auch das 1865
verlegte Kabelteilstück konnte nachträglich geborgen und um das
fehlende Stück ergänzt werden.[2]
Die
Faraday
verlegte 1874 für die
Siemens-Brüder
Wilhelm und
Werner von Siemens
das erste transatlantische Telegrafenkabel, das bis 1931
funktionstüchtig war. Zehn
Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,
die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden
sogenannte
bespulte Leitungen
in Form von
Seekabeln
verwendet. 1865 wurde durch das Dampfschiff
Great Eastern
eine neue transatlantische Linie verlegt; doch das Kabel riss
600 Meilen vor der Küste
Neufundlands
und konnte nicht geborgen werden. Zwischen dem 13. und 27. Juli 1866
wurde erneut durch die Great Eastern ein weiteres Kabel verlegt und
am folgenden 28. Juli 1866 in Betrieb genommen. Auch das 1865
verlegte Kabelteilstück konnte nachträglich geborgen und um das
fehlende Stück ergänzt werden.[2]
Die
Faraday
verlegte 1874 für die
Siemens-Brüder
Wilhelm und
Werner von Siemens
das erste transatlantische Telegrafenkabel, das bis 1931
funktionstüchtig war.
1900
besaß auch Deutschland nicht nur Linien in Nord- und Ostsee mit
einer Gesamtlänge von 4180 Kilometern, sondern auch ein transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische
See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von
Emden (Ostfriesland)
über die
Azoren-Insel
Faial nach
Coney Island
in
New York
verlief. Im Jahre 1919 war die Anzahl betriebsfähiger
transatlantischer Kabel auf 13 angewachsen, vorwiegend in britischem
Besitz.
transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische
See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von
Emden (Ostfriesland)
über die
Azoren-Insel
Faial nach
Coney Island
in
New York
verlief. Im Jahre 1919 war die Anzahl betriebsfähiger
transatlantischer Kabel auf 13 angewachsen, vorwiegend in britischem
Besitz.
Seekabel zur Energieübertragung sind ab etwa 70 km Länge nicht mehr
für die Übertragung von üblichem
Dreiphasenwechselstrom
geeignet, dann muss die aufwändigere
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
(HGÜ) eingesetzt werden.
(Wikipedia)
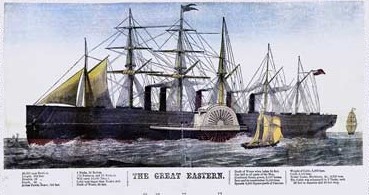 . .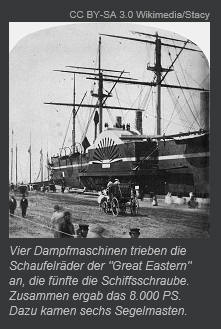 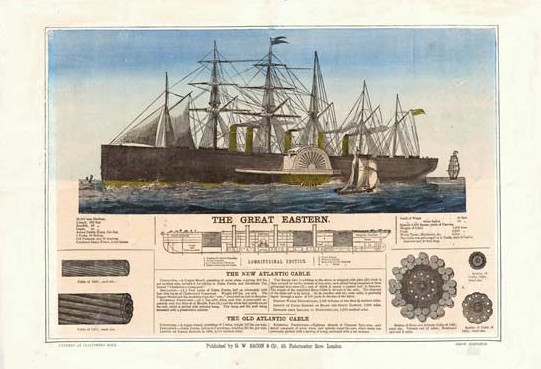
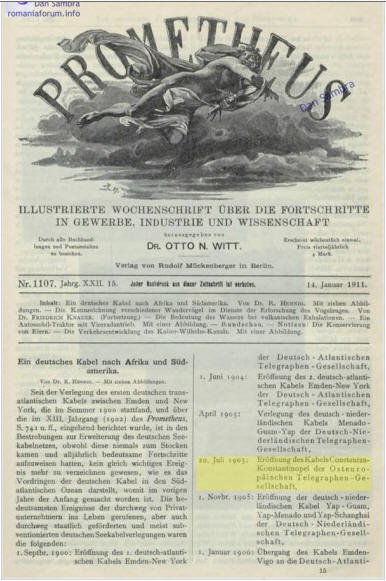 Neben der ursprünglichen Firma Clouth
wurde relativ früh von Franz Clouth die Firma Land und Seekabelwerke AG, Köln,
als eigenständige Firma gegründet. Seit 1890 hatte Franz Clouth bereits eine
eigene Abteilung Kabelwerk für die Bereiche Kupferdrahtzieherei,
Gummierungswerkstatt, Spinnerei zum Beflechten der isolierten Adern sowie eine
Kabelproduktion errichtet und dabei offensichtlich das mögliche
Entwicklungspotential im Rahmen vorangegangener erfolgreicher und erfolgloser
Versuche von Anglo-Amerikanischen Unternehmen ermittelt. Im Rahmen des damals aufstrebenden Weltmarktes,
den der Eingeweihte bereits frühzeitig als „riesiges Geschäft“ auch vor dem
Hintergrund des Erwerbs von Kolonien für Deutschland erkennen konnte,
ging es letztlich um eine weltweite Kabelverlegung zum Vorteil der Wirtschaft
und der einzelnen Staaten zwecks Austausch und Kommunikation. Dies hat Franz Clouth offensichtlich sehr frühzeitig erfasst und sich
auch auf den Ausbau der See-Kabelproduktion mit Guttapercha-Ummantelungen neben
der üblichen Kabelproduktion verlegt, zumal frühzeitig schon von Kabelverlegungen zwischen
Kontinenten die Rede war, was wirtschaftliche Umsätze erwarten ließ und die
Engländer wie Amerikaner bereits intensiv beschäftigte. Neben der ursprünglichen Firma Clouth
wurde relativ früh von Franz Clouth die Firma Land und Seekabelwerke AG, Köln,
als eigenständige Firma gegründet. Seit 1890 hatte Franz Clouth bereits eine
eigene Abteilung Kabelwerk für die Bereiche Kupferdrahtzieherei,
Gummierungswerkstatt, Spinnerei zum Beflechten der isolierten Adern sowie eine
Kabelproduktion errichtet und dabei offensichtlich das mögliche
Entwicklungspotential im Rahmen vorangegangener erfolgreicher und erfolgloser
Versuche von Anglo-Amerikanischen Unternehmen ermittelt. Im Rahmen des damals aufstrebenden Weltmarktes,
den der Eingeweihte bereits frühzeitig als „riesiges Geschäft“ auch vor dem
Hintergrund des Erwerbs von Kolonien für Deutschland erkennen konnte,
ging es letztlich um eine weltweite Kabelverlegung zum Vorteil der Wirtschaft
und der einzelnen Staaten zwecks Austausch und Kommunikation. Dies hat Franz Clouth offensichtlich sehr frühzeitig erfasst und sich
auch auf den Ausbau der See-Kabelproduktion mit Guttapercha-Ummantelungen neben
der üblichen Kabelproduktion verlegt, zumal frühzeitig schon von Kabelverlegungen zwischen
Kontinenten die Rede war, was wirtschaftliche Umsätze erwarten ließ und die
Engländer wie Amerikaner bereits intensiv beschäftigte.
Der Bereich der Groß-Wirtschaft war zum
damaligen Zeitpunkt noch für den Einzelnen unübersehbar. In der Regel kannten sich viele
unternehmerische Größen untereinander, Franz Clouth war Mitglied
von
Rotary , einem Wirtschaftsclub, der damals noch im Vorgründungszustand
war. Er hatte auch dadurch entscheidende Kontakte, aber auch mit Hinsicht auf das
internationale Ausland durch Kongresse, organisierte Treffen in Hausmessen,
weltweiten Messen war die eigene Kontaktbindung zu Größen der Ökonomie gegeben.
Außerdem bestand Familien-Kontakt zum Essener Hause Krupp in Deutschland. Gefahren-Momente aus bestimmten Wirtschaftsbereichen
sprachen sich insoweit schnell herum. Hier tauchte automatisch stets der
Gesichtspunkt der Haftungsbegrenzung in Bezug auf Person und eigene Firma auf,
bei Clouth garantiert mit dem juristischen Rat, den wirtschaftlich riskanten Weg
der Seekabelproduktion durch eine unabhängige Firma zu betreten, um
Haftungsrückschläge und Rückgriffe zu Lasten der Ursprungsfirma Clouth
auszuschließen.
 Die Verlegung eines Transatlantikkabels
kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.
Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu
erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber
Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung
ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das
Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es
aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung
zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte
Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff
tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in
Glasgow/Schottland. Die Verlegung eines Transatlantikkabels
kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.
Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu
erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber
Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung
ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das
Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es
aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung
zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte
Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff
tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in
Glasgow/Schottland.
Mit diesem Kabelschiff
"von Podbielski" legten die Norddeutschen Seekabelwerke, hervorgegangen aus der
"Land- und Seekabelwerk AG" 1904 ein fast 8.000 km langes
Kommunikationskabel von Borkum über die Azoren nach New York.
|
1904 |
Azores
- New York
Norddeutsche Seekabelwerke
German
Schiff: Stephan
Submarine
von Podbielski
Telegraph Company
Diverted into HALIFAX, Nova Scotia 1917 by Colonia; operated by the
GPO until 1929 then Cable&Wireless |
Daß Franz Clouth daran gedacht hat beweist
insoweit seine vorausgehend unternehmerische Strategie in Köln.1889 hatte er den notwendigen
Grunderwerb zur Erweiterun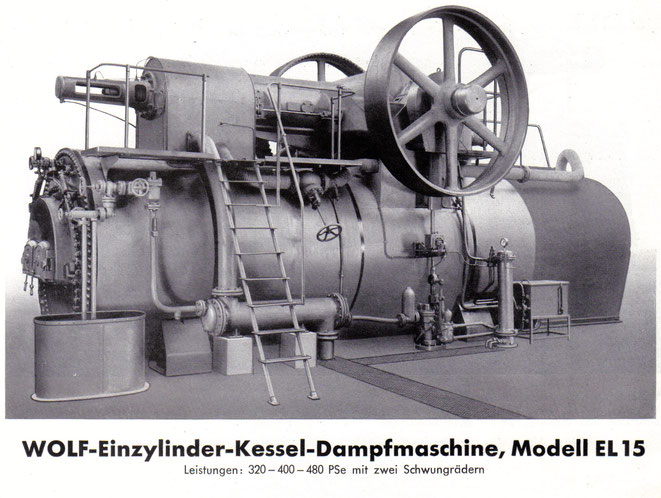 g des Werksgeländes zum Zwecke der Kabelherstellung
getätigt. Zwischen Mai und Juli 1890 erfolgten die Ankäufe einer Transmission,
einer
Wollfschen Lokomobile (Eine
Lokomobile (sing./fem.,
vgl.
Lokomotive, von
lateinisch locus:
Ort und mobilis: beweglich), heute manchmal auch als Lokomobil (neutr.)
bezeichnet, ist eine g des Werksgeländes zum Zwecke der Kabelherstellung
getätigt. Zwischen Mai und Juli 1890 erfolgten die Ankäufe einer Transmission,
einer
Wollfschen Lokomobile (Eine
Lokomobile (sing./fem.,
vgl.
Lokomotive, von
lateinisch locus:
Ort und mobilis: beweglich), heute manchmal auch als Lokomobil (neutr.)
bezeichnet, ist eine
 Dampfmaschinenanlage in
geschlossener Bauform, bei der alle zum Betrieb der Anlage erforderlichen
Baugruppen (Feuerung,
Dampfkessel, Steuerung
sowie die gesamte Antriebseinheit, bestehend aus Zylinder(n), Kolben,
Kurbelwelle und
Schwungrad mit Riemenscheibe) auf einer gemeinsamen Plattform montiert sind))
sowie einer
Seilschlagmaschine. Anfang Juni 1890 trat der Kabelmeister Lukas der
Siemens Brothers, London, in die Dienste von Franz Clouth. Etwas später wurden
ein Ingenieur, ein Prüfer sowie Arbeiter eingestellt. Außerdem
ein spezieller Konstruktionsingenieur. Dieser baute eine dringend benötigte
Bleipresse. Im November 1890 schließlich konnten die ersten Leitungsdrähte
gefertigt werden.(Nach M. Backhausen/"Leben in Nippes, arbeiten bei Clouth) Dampfmaschinenanlage in
geschlossener Bauform, bei der alle zum Betrieb der Anlage erforderlichen
Baugruppen (Feuerung,
Dampfkessel, Steuerung
sowie die gesamte Antriebseinheit, bestehend aus Zylinder(n), Kolben,
Kurbelwelle und
Schwungrad mit Riemenscheibe) auf einer gemeinsamen Plattform montiert sind))
sowie einer
Seilschlagmaschine. Anfang Juni 1890 trat der Kabelmeister Lukas der
Siemens Brothers, London, in die Dienste von Franz Clouth. Etwas später wurden
ein Ingenieur, ein Prüfer sowie Arbeiter eingestellt. Außerdem
ein spezieller Konstruktionsingenieur. Dieser baute eine dringend benötigte
Bleipresse. Im November 1890 schließlich konnten die ersten Leitungsdrähte
gefertigt werden.(Nach M. Backhausen/"Leben in Nippes, arbeiten bei Clouth)
Was Backhausen (Seite 127) mit „seltsamen
Blüten einer Vermischung Clouth und Kabelwerke“ bezeichnet, stellte also einen
gewollten juristischen Spagat dar, der die beiden Firmen jedenfalls nach außen damals so stellen
sollte und mußte, dass sie haftungsrechtlich nicht als gleiche juristische Person gewertet werden
konnten.
Wer als Mitarbeiter einigermaßen den Durchblick hatte, kam zu dem von Backhausen
bezeichneten „Bewusstsein“ das Clouth und Land & Seekabel intern eigentlich der
gleiche Betriebsbereich waren, aus Haftungsgründen nach außen aber unterteilt in die
beiden verschiedenen Firmen. Heutzutage wäre eine solch unsaubere Trennung
rechtlich fraglich, wenn die tatsächlichen Firmen-Verhältnisse dem juristischen
Konstrukt faktisch entgegenstehen.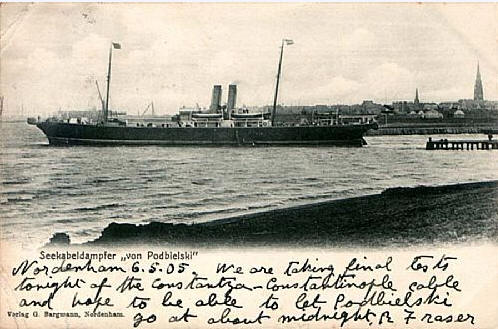
Wichtig ist der Hinweis im vorbezeichneten
Buch auf den „leitenden Ingenieur“ zu dem im September 1891 Georg Zapf berufen
wurde. Zapf war zuvor Assistent von Oskar von Miller (1855-1934) einem der
Pioniere der deutschen Elektrizitätswirtschaft. Er war Mitbegründer der AEG und
gründete 1903 in seiner Heimatstadt München das Deutsche Museum. Ob Franz Clouth
tatsächlich Zapf auf der elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt, Main erst
kennengelernt hatte, schließt vorangegangene Kontakte nicht aus. Franz Clouth war
nämlich selbst auch im elektrotechnischen Bereich maßgeblich international mit
integriert. Die Erforschung der Elektrizität und ihre praktische Anwendung war
damals für Firmeninhaber, wollten sie mit der rasanten wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Entwicklung Schritt halten, eine Existenzfrage.
Verlegeschiff von Clouth: "von
Podbielski"
___________________________________________________
Transatlantikkabel
"Wie
eine Leiter zum Mond"
Im
Sommer 1866 verkabeln private Unternehmer den Atlantik zwischen Europa und
Amerika und beschleunigen Handel und Kommunikation. Es ist der Beginn einer
neuen Epoche, in der die Welt radikal umgestaltet wird.
27.
Juli 2016 DIE ZEIT Nr. 31/2016, 21. Juli 2016
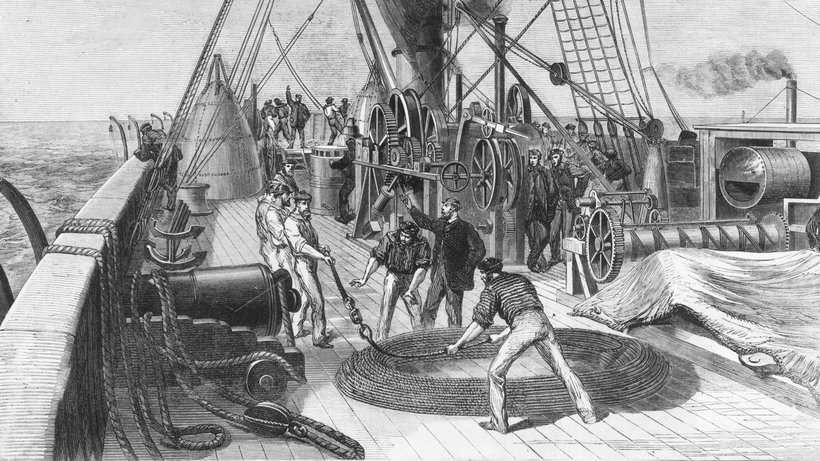
Seeleute an Bord der "Great Eastern" verlegen im September 1865 Teile des
Atlantikkabels. © Rischgitz/Getty Images
Der
amerikanische Unternehmer Cyrus W. Field verfällt 1854 einer mehr als nur
ambitionierten Idee: Er will ein Telegrafenkabel quer durch den Nordatlantik
verlegen, zwischen der Westküste Irlands und dem kanadischen Neufundland. Damit
sollen die Kommunikation, der Handel und der politische Austausch zwischen
Europa und Nordamerika radikal beschleunigt werden. Dem Millionär zur Seite
stehen einige seiner reichen Nachbarn aus Gramercy Park, einem Stadtteil New
Yorks. Mit Samuel F. B. Morse gewinnt Field einen der Erfinder der Telegrafie
als Berater. Zusammen etablieren sie die New York, Newfoundland and London
Telegraph Company.
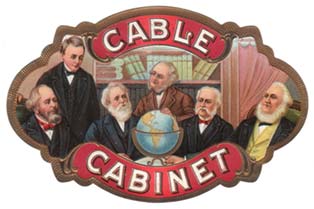 Lange
Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und
wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein
Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so
erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint
vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der
Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das
Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus
technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes
Unterfangen. Lange
Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und
wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein
Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so
erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint
vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der
Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das
Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus
technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes
Unterfangen.
Über
den Meeresboden und die dort vorkommenden Strömungen ist wenig bekannt. Die
Kabelverleger verlassen sich auf die umstrittenen Aussagen des amerikanischen
Ozeanografen Matthew F. Maury, der 1853 ein transatlantisches Plateau zwischen
Irland und Neufundland entdeckt haben will: nur zwei Seemeilen tief, ohne
signifikante Gräben und zudem strömungsarm. Dieses Plateau, schreibt Maury in
einem Brief an Field, sei "geradezu dafür vorgesehen, dort ein Tiefseekabel zu
verlegen".
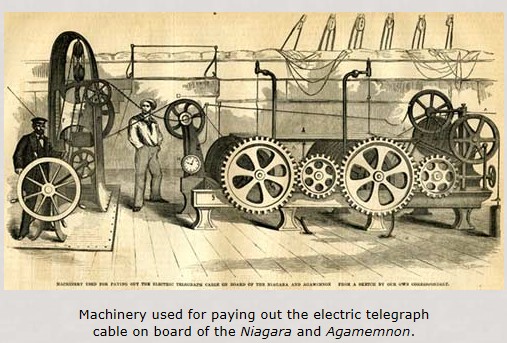 Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.
Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural
Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press
erschienen. Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.
Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural
Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press
erschienen.
Die
britische und die amerikanische Regierung sagen zögerlich ihre Unterstützung des
Projekts zu. Marine-Einheiten der beiden Länder unternehmen in den Jahren 1856
und 1857 mehrere Messfahrten. Gewissheit über die Ergebnisse von Maury liefern
sie nicht.
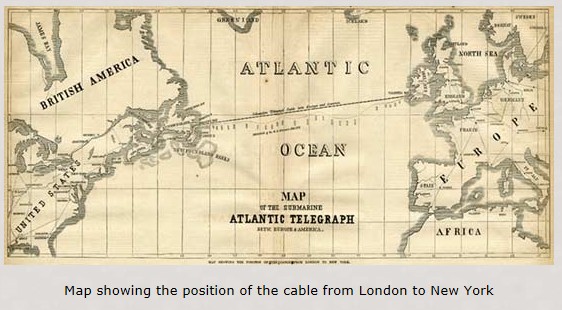 Hinzu
kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln
über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,
Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich
überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,
haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller
Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln. Hinzu
kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln
über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,
Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich
überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,
haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller
Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln.
Zwischen 1857 und 1866 ist das Projekt eine kostspielige Aneinanderreihung von
gescheiterten Versuchen. Die Unternehmungen können nur innerhalb der kurzen Zeit
zwischen Frühjahrs- und Herbststürmen sicher durchgeführt werden. Beim ersten
Versuch 1857 bricht das Kabel noch am Tag der Abfahrt vom westirischen Valentia
Island. Obgleich zunächst gehoben, versinkt es wenige Tage später
unwiederbringlich.
 1858
gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,
dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum
Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen
durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem
Ozeanboden zurückbleibt. 1858
gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,
dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum
Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen
durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem
Ozeanboden zurückbleibt.
Zwischen 1861 und 1864 verhindern die Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs
weitere Unternehmungen. Dringend notwendige Neuinvestoren schreckt die bisherige
Misserfolgsquote. Retter in der Not ist der Textilunternehmer John Pender aus
Nordengland, der 1865 einen Großteil seines Privatvermögens in das Atlantikkabel
steckt und wichtige Unternehmensreformen einleitet. Aber Glück ist zunächst auch
ihm nicht beschieden. 1865 bricht das Kabel erneut auf hoher See. Mit jedem
Fehlversuch versenkt die Kabel-Crew knapp 200.000 Pfund, nach heutigem Maßstab
eine Summe im mehrstelligen Millionenbereich, auf dem Grunde des Meeres.
Ans
Aufgeben denken sie dennoch nicht. Wie viele ihrer Zeitgenossen sind sie
überzeugt von der Beherrschbarkeit der Natur und beseelt von einem profunden
Technik- und Fortschrittsglauben. einem profunden
Technik- und Fortschrittsglauben.
Am
27. Juli 1866, vor genau 150 Jahren, ist es so weit. "Erdrückende Stille. Und
plötzlich brach er los, der Sturm des Jubels. Alle waren außer sich vor Freude.
Sie sprangen ins Wasser und schrien ihr Glück und ihre Erleichterung so laut aus
sich heraus, als ob sie wünschten, dass es noch in Washington vernommen würde.
Unsere Seeleute hielten das Kabel in die Höhe und tanzten wild darum herum.
Einer von ihnen steckte es sich sogar in den Mund! Ich empfand nicht anders;
schrie laut jubelnd wie sie. Und wollte doch nur leise weinen. Wir hatten es
geschafft."
Mit
diesen Zeilen erinnert Sir Daniel Gooch, britischer Eisenbahn- und
Telegrafeningenieur, in seinen Tagebuchaufzeichnungen an den 27. Juli 1866. Den
Tag, als er nach fast vier Wochen auf See mitten im Nirgendwo neufundländischer
Küstenkargheit mit einer Crew aus englischen, irischen und amerikanischen
Ingenieuren, Elektrikern und Seeleuten an Land gegangen ist.
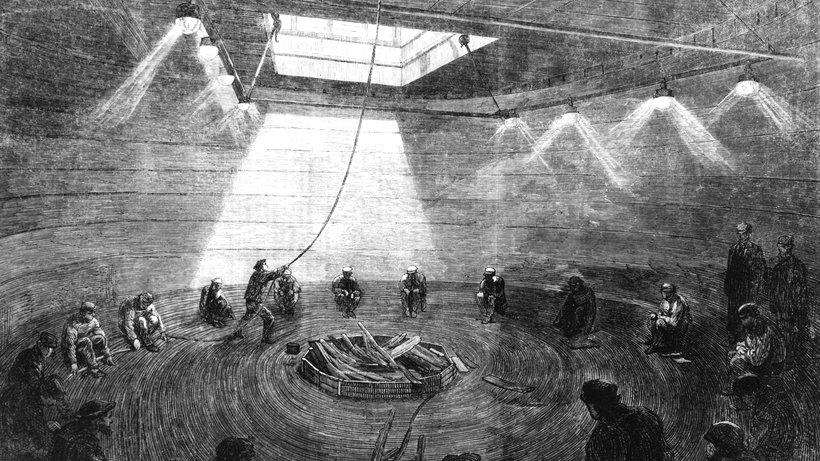
3,3
Zentimeter dick und 1865 schön eingerollt im Innern der "Great Eastern": Das
atlantische Telegrafenkabel. © Hulton Archive/Getty Images
Die
Zeitungen überschlagen sich im Enthusiasmus über den Erfolg. "Das achte
Weltwunder", "Ein Pfand der Liebe zwischen Alter und Neuer Welt", "Ein Anker der
Hoffnung", lauten die Schlagzeilen.
 Manch
einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes Manch
einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes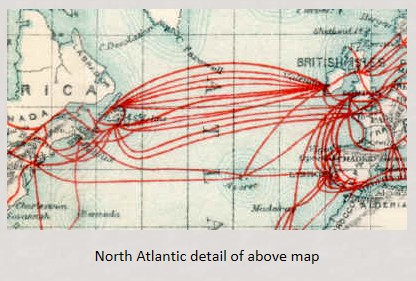 Seekabelnetzwerk
aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum
Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser
Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen. Seekabelnetzwerk
aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum
Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser
Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen.
Man
sieht in dem Ereignis den "Beginn eines neuen Zeitalters". Der Schriftsteller
Stefan Zweig feiert die Atlantikverkabelung später in seiner Sammlung der
Sternstunden der Menschheit, die "leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht
der Vergänglichkeit überglänzen". Auch Generationen von Geschichtsschreibern
sprechen laut der britischen Historikerin Gillian Cookson im Rückblick vom
"Kabel, das die Welt veränderte".
Bald
erstrecken sich weitere Kabel krakenähnlich von Europa aus nach Indien,
Südostasien, Australien, Lateinamerika und Südafrika. Zeitgleich bauen die
Regierungen die Landtelegrafie weiter aus. Ende der 1870er Jahre kann so gut wie
jedes Handelszentrum von Europa aus per Telegraferreicht werden. Das
Seekabelnetzwerk umfasst zwischen 70.000 und 100.000 Kilometer.
Transatlantikkabel
Das Kabel

Im
Inneren sind meist Kupferdrähte verflochten worden, die durch eine
Guttapercha-Isolierung und eine zusätzliche Ummantelung geschützt wurden. Der
Durchmesser des Kabels beträgt 3,3 Zentimeter und mehr.
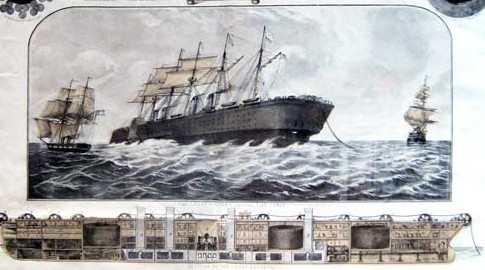 In
den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach
verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische
Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das
gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des
Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche
gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten
täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein
Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten
multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen. In
den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach
verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische
Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das
gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des
Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche
gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten
täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein
Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten
multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen.
Die
Seetelegrafie verändert die damalige Welt von Grund auf. Information wird
dematerialisiert. Sie ist in der Schnelligkeit ihrer Übermittlung nicht mehr an
die Geschwindigkeit des Überbringers gebunden. Zeitgenossen schwärmen von einer
"Auflösung von Zeit und Raum": Brauchte ein Brief per Dampfschiff knapp zwei
Wochen für den Weg über den Atlantik, lassen sich nun die entscheidenden
Informationen in wenigen Minuten übermitteln. Die Welt ist 1866 auf dem direkten
Wege zum globalen Dorf.
 In
den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen
vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt
kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches
Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines
einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die
Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt
die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der
drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr
kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,
Unternehmern, Journalisten und Politikern. In
den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen
vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt
kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches
Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines
einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die
Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt
die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der
drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr
kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,
Unternehmern, Journalisten und Politikern.
Diese
Elite nutzt die Seetelegrafie geschickt für die stete Ausbildung zunächst
wirtschaftlicher und politischer, später auch kultureller und sozialer Netzwerke
rund um den gesamten Globus. Netzwerke
rund um den gesamten Globus.
Politisch entwickeln sich die Seekabel zu wichtigen Machtinstrumenten, eng
verquickt mit und gleichzeitig unabhängig von staatlichen Institutionen. Im
Gegensatz zu den Landtelegrafen bleiben die Seekabel unter der Hoheit einiger
weniger Privatunternehmen: Die Anglo-American Telegraph Company, die Great
Northern Telegraph Company oder die Eastern and Associated Telegraph Companies
teilen die Welt monopolartig unter sich auf. Nur der Nordatlantik bleibt bis zur
Jahrhundertwende heiß umkämpft. Mehr und mehr Unternehmer, darunter der
amerikanische Eisenbahnmagnat Jay Gould und die Gebrüder Werner, William und
Carl Siemens, drängen in den lukrativsten Kommunikationsmarkt.
Ein
Kabel wird zur Basis des modernen Kapitalismus
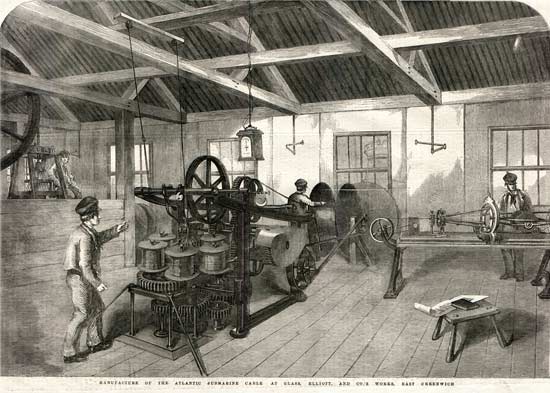 Als
Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet
lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und
Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.
Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung
und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus
dem britischen Imperium. Als
Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet
lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und
Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.
Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung
und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus
dem britischen Imperium.
Imperiale Mächte nutzen die Seekabel, um zumindest das Gefühl stärkerer
Kontrolle über ihre Kolonien herzustellen. Aus gutem Grund: Der indische
Aufstand von 1857 gegen die britische Kolonialherrschaft hat die Erinnerung von
Ohnmacht hinterlassen. Der Hilferuf des Generals Sir Henry Lawrence, alle
Europäer "so schnell wie möglich" vom Subkontinent zu evakuieren, hat
geschlagene 40 Tage gebraucht, um London zu erreichen.
Gleichzeitig trachten die Gegner des Empire danach, das Telegrafennetz gegen das
politische Establishment zu verwenden. Irische Nationalisten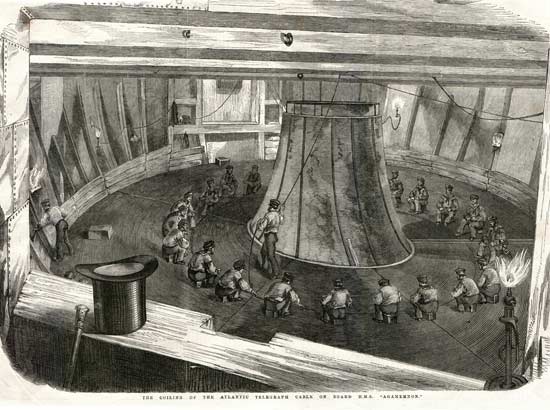 versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen
Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die
Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt
die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba
nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein
Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom
Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.
versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen
Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die
Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt
die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba
nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein
Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom
Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.
Neben
der Politik verändert die Seetelegrafie vor allem die Wirtschaftsabläufe. Im
internationalen Handel eliminieren die Kabel beispielsweise den Mittelsmann. Ein
Händler kann seine Ware nun auch nach dem Verlassen des Hafens verfolgen. Das
ermöglicht ihm, Entscheidungen über Preis und Menge im An- und Verkauf selbst zu
treffen.
Ökonomen wie John Maynard Keynes und John Hobson erkennen im globalen
Kommunikationsnetz der Seekabel die Basis des modernen Kapitalismus. Gerade zu
Beginn der Seetelegrafie erfährt das Kabel seine größte Auslastung in den
Stunden, wenn die Börsen der Welt zeitgleich geöffnet sind. Informationen über
Aktienkurse und Verkaufs- und Ankaufszahlen bilden den überwiegenden Teil
globaler Kommunikation der Anfangsjahre. Dabei entstehen neue Handelsformen, die
sich die Schnelligkeit der Telegrafie zu eigen machen, etwa der Handel mit
Futures.
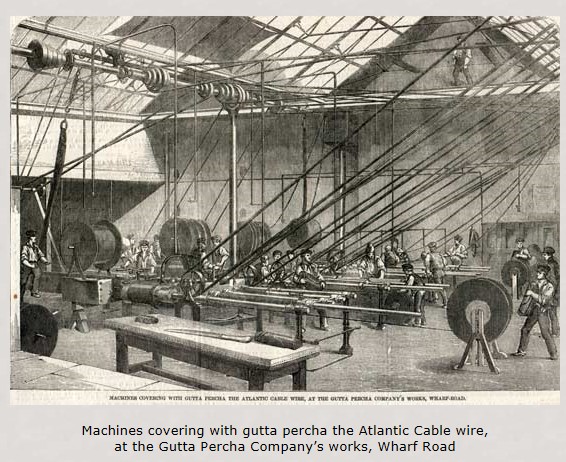 Journalisten
treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant
erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste
Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch
interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen
Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren
informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die
Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die
Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so
weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz
John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt
werden können. Journalisten
treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant
erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste
Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch
interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen
Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren
informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die
Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die
Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so
weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz
John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt
werden können.
Bedingt durch die Kosten, etabliert sich ein Telegrammstil, der sogar in die
Literatur einwandert. Der schwedische Schriftsteller August Strindberg schreibt
in seinem Aufsatz Was ist die "Moderne"? im Jahr 1894: "Die Kunst, Briefe von
drei Seiten zu schreiben, entfällt. (...) Und das Telegramm ist das Ideal. Nur
einmal der Name, und ohne Titel. Die nackten Tatsachen, ohne Phrasen, bilden den
Text: Frage und Antwort. Schluss mit 'Seien Sie, sehr geehrter Herr, meiner
ausgezeichneten Ergebenheit versichert' (...)."
Kurz
und gut: Das vor 150 Jahren verlegte Atlantikkabel war das erste Puzzleteil
eines weltweiten Kommunikationsnetzwerks und ebnete dem Welthandel, der
Weltpolitik und der globalen Öffentlichkeit den Weg. Auch heute laufen im
Übrigen trotz Satellitentechnik mehr als 90 Prozent des Internetverkehrs über
die Verbindungen am Boden der Weltmeere. Die Kabel mögen neu sein, die Routen
sind alt.

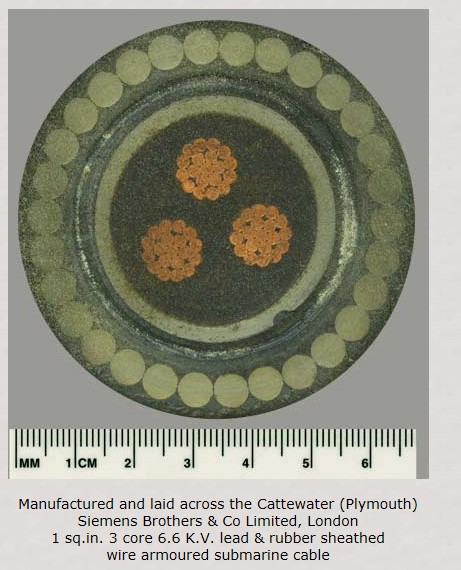
Moderne Telefonie
und Datenverkehr Wikipedia
 Das
erste Transatlantikkabel war 1858 von
Cyrus West Field
gelegt worden. Nach nur einmonatiger Betriebszeit
wurde es 1866 ersetzt. Mit diesen Kabeln waren aber
nur telegrafische Verbindungen möglich. Die
Telefonverbindung über Funk wurde 1927 in Betrieb
genommen. Die Gesprächsgebühr für drei Minuten
betrug neun Pfund (nach heutiger
Kaufkraft
etwa 533 Euro). Die Technologie für ein derart
langes Unterseetelefonkabel (Elektronenröhren
für die Verstärker,
Polyethylen
statt
Guttapercha
für die Isolierung,
Trägerfrequenzverfahren)
stand erst in den 1940er Jahren zur Verfügung. Die
Kosten von 120 Millionen britischen Pfund wurden von
der britischen Postbehörde,
AT&T,
sowie zu zehn Prozent von VSNL Canada getragen.Das
Kabel wurde 1978 außer Betrieb genommen. Das
erste Transatlantikkabel war 1858 von
Cyrus West Field
gelegt worden. Nach nur einmonatiger Betriebszeit
wurde es 1866 ersetzt. Mit diesen Kabeln waren aber
nur telegrafische Verbindungen möglich. Die
Telefonverbindung über Funk wurde 1927 in Betrieb
genommen. Die Gesprächsgebühr für drei Minuten
betrug neun Pfund (nach heutiger
Kaufkraft
etwa 533 Euro). Die Technologie für ein derart
langes Unterseetelefonkabel (Elektronenröhren
für die Verstärker,
Polyethylen
statt
Guttapercha
für die Isolierung,
Trägerfrequenzverfahren)
stand erst in den 1940er Jahren zur Verfügung. Die
Kosten von 120 Millionen britischen Pfund wurden von
der britischen Postbehörde,
AT&T,
sowie zu zehn Prozent von VSNL Canada getragen.Das
Kabel wurde 1978 außer Betrieb genommen.
Ein
3.600 km langees
Kabel, genannt "TAT-1", wurde am 25. September 1956 zwischen
Oban (Schottland)
und
Clarenville (Neufundland)
in Betrieb genommen. Die Verbindung verfügte über 36
Fernsprechkanäle, je eine Ader für jede Sprechrichtung, sowie 51
Verstärker, die im Abstand von jeweils 70 Kilometern am Kabel
angebracht waren. Betrieb genommen. Die Verbindung verfügte über 36
Fernsprechkanäle, je eine Ader für jede Sprechrichtung, sowie 51
Verstärker, die im Abstand von jeweils 70 Kilometern am Kabel
angebracht waren.
In
den ersten 24 Einsatzstunden wurden 588 Anrufe zwischen London und
den USA übertragen, sowie 119 von London nach
Kanada. Die
Kapazität des Kabels wurde daher bald auf 48 Kanäle erweitert. TAT-1
wurde 1978 endgültig abgeschaltet.
Das
zweite transatlantische Telefonkabel TAT-2 wurde am
22. September 1959 in Betrieb genommen; die Anzahl der Sprechkanäle
wurde dabei durch das Verfahren der
zeitzugeordneten Sprachinterpolation
(time-assigned speech interpolation, TASI) auf 87 erhöht; bei
diesem Verfahren wird einem Teilnehmer nur dann ein Kanal
zugeordnet, wenn er auch tatsächlich spricht. Ab 1963 konnte über
TAT-2 ein
halbautomatischer
Telefondienst zwischen der
Bundesrepublik Deutschland
und den
USA angeboten
werden.
 Das
mit
Koaxialkabeln
aufgebaute TAT-3 wurde zwischen 1963 und 1965 verlegt; es
reichte von
Großbritannien
bis
New Jersey
und verfügte über eine Kapazität von 138 Sprachkanälen mit maximal
276 Sprechverbindungen und einem Verstärkerabstand von 37
Kilometern. Das
mit
Koaxialkabeln
aufgebaute TAT-3 wurde zwischen 1963 und 1965 verlegt; es
reichte von
Großbritannien
bis
New Jersey
und verfügte über eine Kapazität von 138 Sprachkanälen mit maximal
276 Sprechverbindungen und einem Verstärkerabstand von 37
Kilometern.
TAT-4 wurde 1965 zwischen
Frankreich
und New Jersey mit einer Kapazität von 345 Sprechverbindungen
verlegt; zwei Sprechkreise dienten der Verbindung
Österreichs
mit den USA. Ab 1968 konnten Österreicher über CANTAT auch Kanada
erreichen.
Das 6300 km
lange TAT-6 folgte 1976 zwischen Frankreich und den USA; es
verfügte über 4200 Sprechkreise und benötigte 693 Zwischenverstärker
im Abstand von 9 Kilometern.
Tiefseekabel ermöglichen Datenkommunikation über große Distanzen und
können Datenmengen transportieren, welche größer sind als die der
stärksten
Kommunikationssatelliten.
Ein weiterer Vorteil gegenüber Satellitenverbindungen ist die
deutlich geringere
Laufzeit der
Signale. Einen großen Nachteil teilen sie allerdings mit Satelliten:
Tiefseekabel können ebenso wie Satelliten nur mit großem Aufwand
modifiziert, gewartet, erweitert oder auf sonst eine Weise im
Nachhinein bearbeitet werden.
Vor
allem wegen des hohen Datenaufkommens werden Tiefseekabel besonders
häufig im
Atlantik
zwischen Nordamerika und Europa eingesetzt. Es gibt nur noch wenige
Länder, die noch keinen Anschluss an ein
Hochleistungsnachrichtenkabel haben.
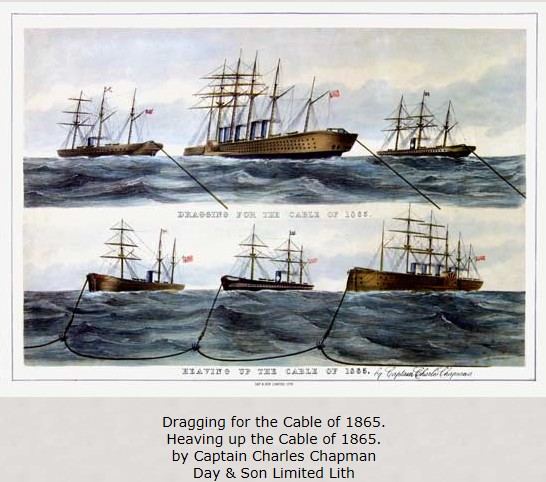 Zu
Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.
Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von
Glasfaserkabeln.
Ein Glasfaserkabel enthält mehrere Faserpaare, das im Nordatlantik
verlegte
TAT-14
beispielsweise vier. Über ein Faserpaar können durch das sogenannte
„Multiplexing“
viele Datenströme auf einmal fließen. Neueste Faserpaare können gut
ein
Terabit Daten
pro Sekunde übertragen. Die Glasfaserkabel liegen in einem
Kupferrohr, welches mit wasserabweisendem Verbundstoff ausgegossen
ist. Um dieses Kupferrohr liegt noch eine Röhre aus Aluminium zum
Schutz vor dem Salzwasser, es folgen
Stahlseile
und, je nach Stärke des Schutzes, mehrere Schichten
Kunststoff.
Das Kupferrohr dient gleichzeitig als elektrischer Leiter, um die in
Abständen (bei modernen Kabeln 50–80 km) erforderlichen ins Kabel
eingeschleiften
optischen Verstärker
mit Strom zu versorgen. Als
Rückleiter
zum Betrieb der Verstärker dient das Meerwasser. Die
Betriebsspannung erreicht die Größenordnung von 10 kV. Vor den
Küsten werden wegen des ansteigenden Meeresbodens und der damit
verbundenen Gefahr von Beschädigung durch Schiffsanker oder
Fischtrawler
stärker armierte Kabel verwendet. Allerdings helfen auch diese
Vorkehrungen nicht immer. Am 28. Februar 2012 kappte ein auf einen
Liegeplatz im
Hafen von Mombasa
wartendes Schiff ein Unterseekabel mit seinem Anker und legte damit
einen wesentlichen Teil der Internetanbindung
Ostafrikas
lahm. Zu
Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.
Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von
Glasfaserkabeln.
Ein Glasfaserkabel enthält mehrere Faserpaare, das im Nordatlantik
verlegte
TAT-14
beispielsweise vier. Über ein Faserpaar können durch das sogenannte
„Multiplexing“
viele Datenströme auf einmal fließen. Neueste Faserpaare können gut
ein
Terabit Daten
pro Sekunde übertragen. Die Glasfaserkabel liegen in einem
Kupferrohr, welches mit wasserabweisendem Verbundstoff ausgegossen
ist. Um dieses Kupferrohr liegt noch eine Röhre aus Aluminium zum
Schutz vor dem Salzwasser, es folgen
Stahlseile
und, je nach Stärke des Schutzes, mehrere Schichten
Kunststoff.
Das Kupferrohr dient gleichzeitig als elektrischer Leiter, um die in
Abständen (bei modernen Kabeln 50–80 km) erforderlichen ins Kabel
eingeschleiften
optischen Verstärker
mit Strom zu versorgen. Als
Rückleiter
zum Betrieb der Verstärker dient das Meerwasser. Die
Betriebsspannung erreicht die Größenordnung von 10 kV. Vor den
Küsten werden wegen des ansteigenden Meeresbodens und der damit
verbundenen Gefahr von Beschädigung durch Schiffsanker oder
Fischtrawler
stärker armierte Kabel verwendet. Allerdings helfen auch diese
Vorkehrungen nicht immer. Am 28. Februar 2012 kappte ein auf einen
Liegeplatz im
Hafen von Mombasa
wartendes Schiff ein Unterseekabel mit seinem Anker und legte damit
einen wesentlichen Teil der Internetanbindung
Ostafrikas
lahm.
Technische Prüfungen
durch staatliche oder halbstaatliche Behörden/Einrichtungen/Vereine
Bei aller Liberalität
ging es damals auch schon nicht mehr um einfache Herstellung ohne
genauere technische Überprüfung, ob also produzierte Waren auch
tatsächlich den beabsichtigten Zweck erfüllen konnten und auch
erfüllen würden. Dies betraf bei Clouth nicht nur die Frage der
Isolation von elektrischen Drähten, vielmehr auch die
Dauerhaftigkeit des Materials, mit dem Ballone und Zeppeline gebaut
wurden. Zu diesem Zweck gab es damals auch bereits den Verein "
Vereinigung der Fabrikanten isolierter Leitungsdrähte", mit
denen Franz Clouth mit Sicherheit ebenfalls zu tun hatte, ob als
Kunde oder Mitarbeiter, ist nicht überliefert. Um was es dabei in
etwa ging, lässt sich aus nachfolgendem ersehen:
Die
Tätigkeit des Königlichen Materialprüfungsamtes der
Technischen Hochschule zu Berlin im Betriebsjahre 1909.
Der uns
vorliegende Bericht zeigt, wie das Amt auch in dem
Berichtsjahre 1909 bestrebt gewesen ist, die vorhandenen
staatlichen Einrichtungen möglichst nutzbringend in den
Dienst der Technik und zwar sowohl der erzeugenden als
auch der verbrauchenden zu stellen und auszubauen, daß
es hierbei nicht in bureaukratischer Weise seine eigenen
Wege geht, sondern gern gewillt ist, den berechtigten
Wünschen der Industrie Rechnung zu tragen und auch den
ihm von außen zugehenden Anregungen Folge zu geben. Als
Beispiele für den Erfolg dieser Bestrebung seien
angeführt die bereits im vorjährigen Bericht (s. D. p.
J. 1910, Bd. 325, S. 73) erwähnten Verhandlungen mit den
Vereinigten Fabriken für
isolierte Leitungen über Mittel und Wege, um eine
wirksame chemische Kontrolle der Gummihüllen für
isolierte Leitungsdrähte herbeizuführen. Sie kamen in
einem Vertrage mit dem genannten Verein zum Abschluß,
wonach vereinbart wurde, daß das Amt die Kautschukmasse
auf ihre Zusammensetzung, insbesondere darauf prüfen
soll, ob sie den von den Fabrikanten aufgestellten
Bedingungen entspricht. Die Prüfungsanträge können von
jedem Käufer an das Amt gerichtet werden. Wenn die
Leitungen mit den Kennfäden der
Vereinigten Fabriken
versehen sind, so zahlt die Vereinigung ⅓ der
Prüfungsgebühren, während der Rest dem Antragsteller zur
Last fällt.
Ferner sind zu
nennen die Verhandlungen mit dem
Deutschen
Elektrotechniker-Verband, die zur Aufstellung
eines großen Planes für eingehende Versuche mit
Isoliermaterialien für Spannungen bis zu 500 Volt
geführt haben. Eine Reihe von Fabriken hat die
erheblichen Mittel zur Durchführung der Versuche
bewilligt, die unter anderem auch bezwecken, die
Ersatzstoffe für Hartgummi in ihren Eigenschaften zu
erforschen und ihren Gebrauchswert gegenüber den
Kautschukprodukten festzulegen. Demgemäß soll geprüft
werden, die Bearbeitungsfähigkeit in der Werkstatt, die
Festigkeit und Sprödigkeit bei Zug-, Druck- und
Biege-Beanspruchung, sowie die Härte, (alles bei
verschiedenen Wärmegraden) sowie die Wetterbeständigkeit
und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse.
Das elektrische
Verhalten, insbesondere die Oberflächen-Isolation in der
Abhängigkeit von den vorgenannten Einflüssen soll
festgestellt werden. Diese Aufgabe ist der
Physikalisch-technischen
Reichsanstalt übertragen.
Schließlich mögen
erwähnt sein die Bestrebungen, die Prüfung von
Luftballonstoffen auf Widerstand gegen Zerplatzen,
Gasdurchlässigkeit, Wärmedurchlässigkeit, Faserart,
Festigkeit, Wetterbeständigkeit und Verhalten gegen
Sonnenlicht und Feuchtigkeit auf einheitliche Grundlage
zu stellen.
Durch die mit den
Luftschifferkreisen lebhaft geführten Verhandlungen
wurde der Plan für eine große Untersuchung von
Ballonstofftypen festgelegt, so daß die Eigenschaften
der neuen Stoffe übersichtlich ermittelt werden und es
möglich wird, durch spätere Nachprüfungen die
Eigenschaften des lange Zeit im Betriebe gewesenen
Stoffes, d.h. den Einfluß des Alterns unter der Wirkung
von Wetter und mechanischen Beanspruchungen während der
Fahrt und beim Landen, zu erforschen. Es steht zu
hoffen, daß die interessierten Kreise die immerhin
bedeutenden Summen für die genannten Versuche aufbringen
werden, um schließlich aus den Ergebnissen dieser
Untersuchungen einen Plan für kurze und zweckmäßige
Prüfungen von Ballonstoffen entwickeln zu können.
Polytechnisches Journal
|
Notwendige Normalien auch für isolierte
Leitungen in Starkstromanlagen
Die
Entstehung der Normalien für isolierte
Leitungen fiel in das Jahr 1900, also der
Zeit Franz Clouth's.
Auf der damaligen Jahres Versammlung des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker zu Kiel
stellte Herr Dr. Passavant folgenden Antrag:
„Die Generalversammlung wolle
beschließen, eine besondere
Kommission mit der Feststellung
allgemeiner Grundsätze zu betrauen,
nach denen Leitungsdrähte und Kabel zu
prüfen und bezüglich ihrer
Verwendbarkeit bei der Installation
elektrischer Anlagen zu beurteilen sind.
Der Vorstand wird ermächtigt, eine
vorläufige Kommission, bestehend aus
Berliner Mitgliedern, zu ernennen,
welche die vorbereitenden Arbeiten
übernimmt.”
Zur
Begründung dieses Antrages brachte der
Antragsteller unter anderem vor, daß Drähte und
Kabel, die bei Installationen Verwendung fänden,
nicht immer den Grad von Güte besitzen, der den
Sicherheitsvorschriften entspräche. Die führte
zur Verfestigung
des Königlichen Materialprüfungsamtes der
Technischen Hochschule zu Berlin, welches mit
den entsprechenden Aufgaben befaßt wurde
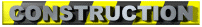
- Guttapercha
- Seekabelkonstruktion
- Kabelverlegung
|
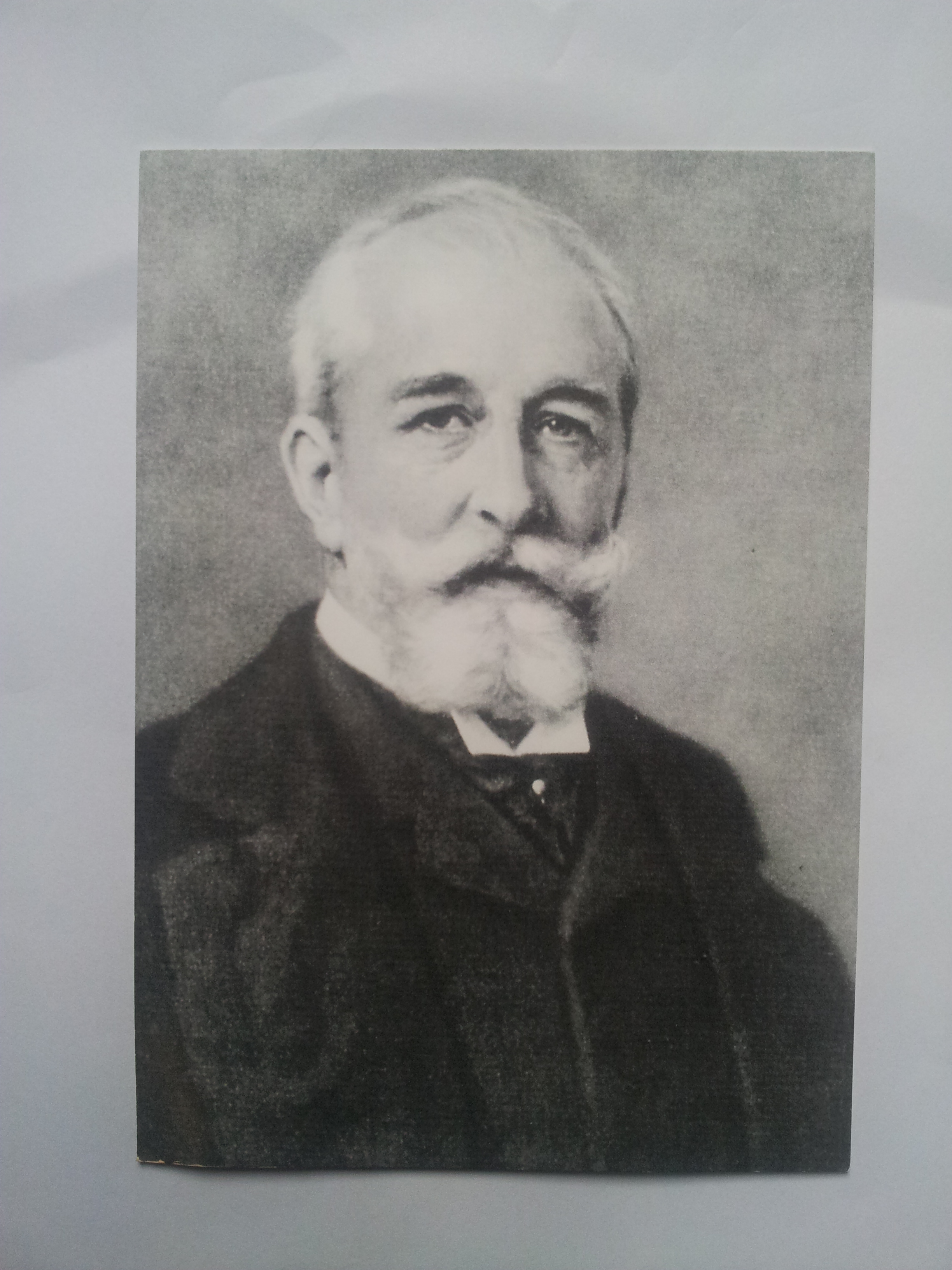

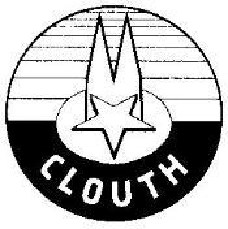

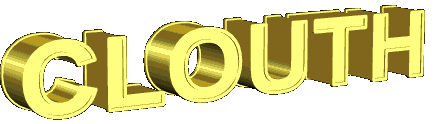


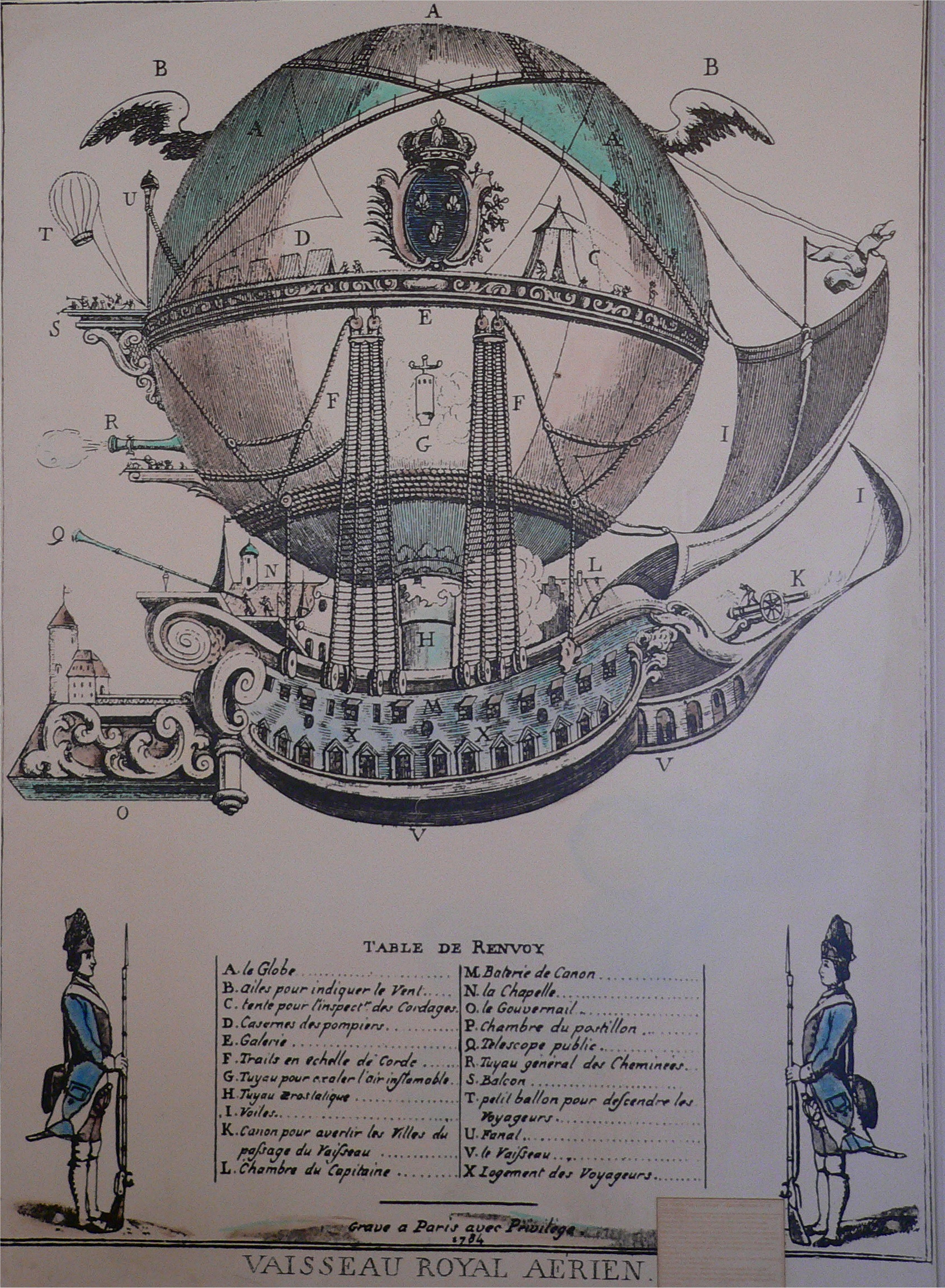

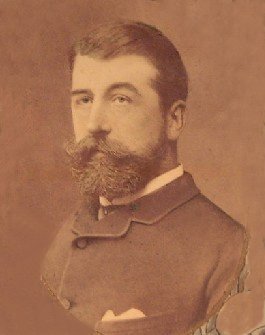
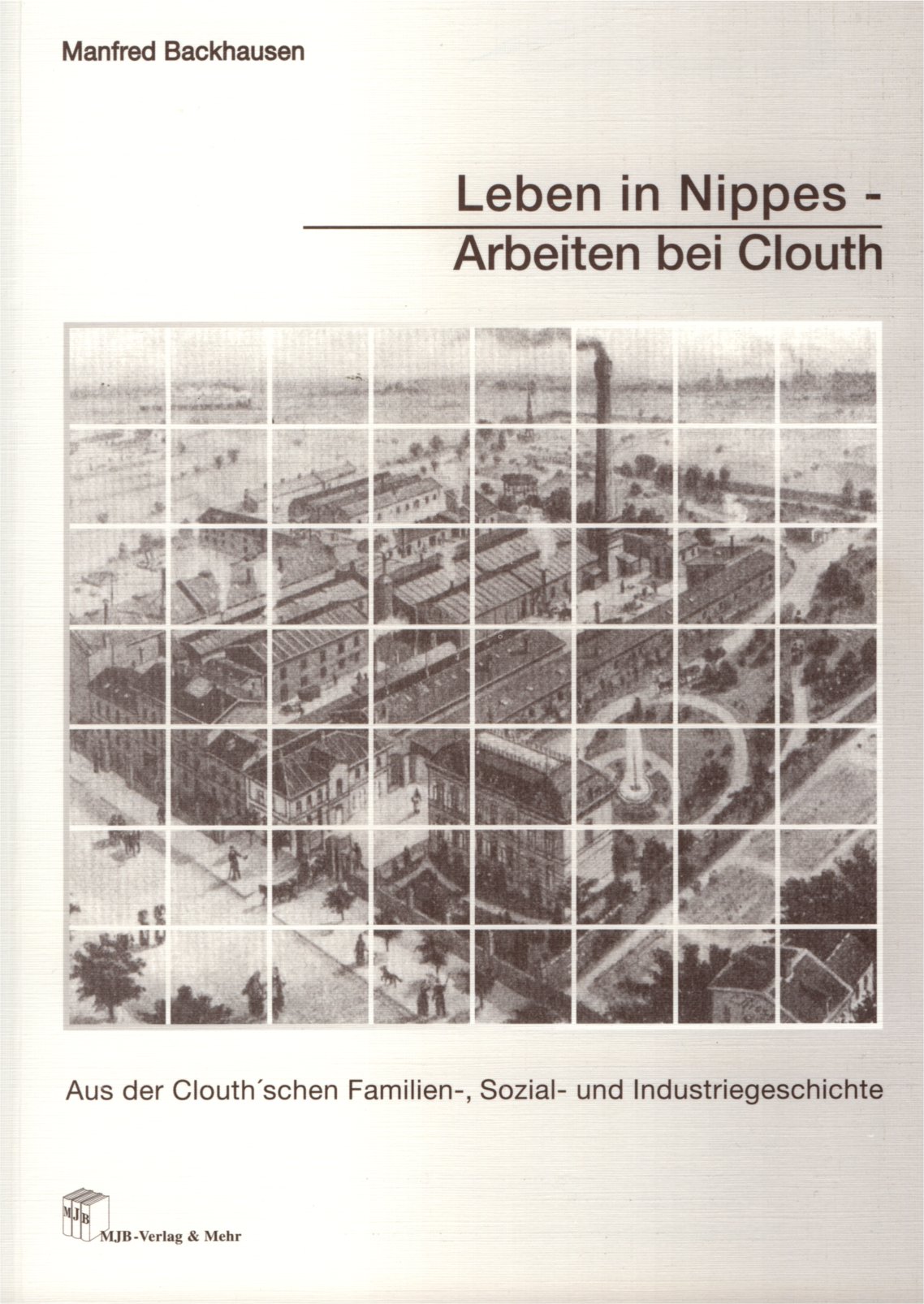

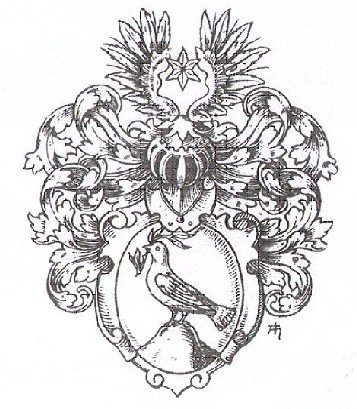
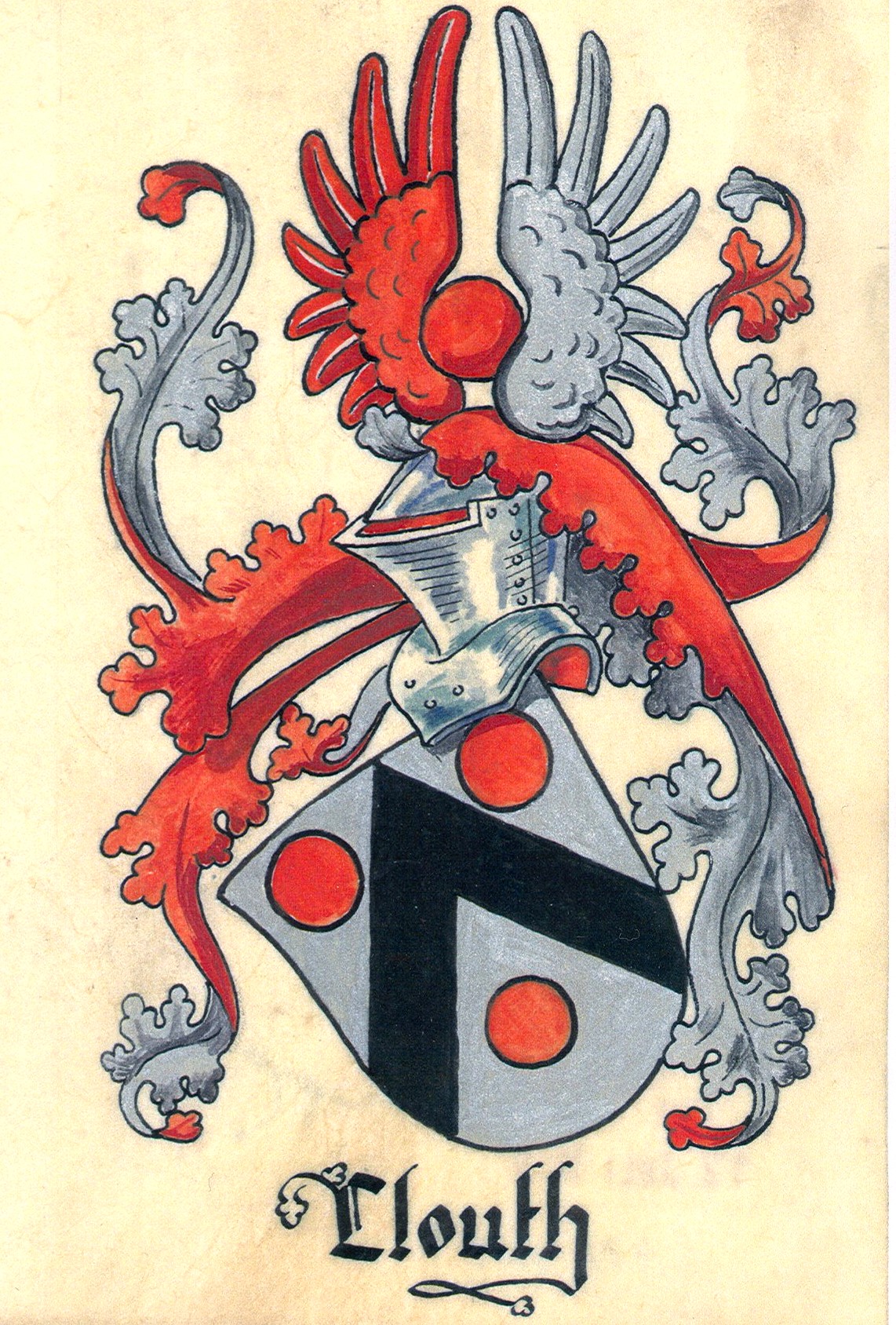

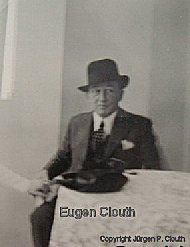
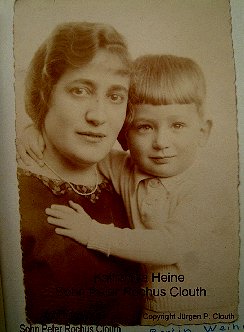


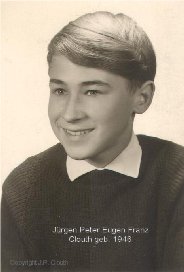



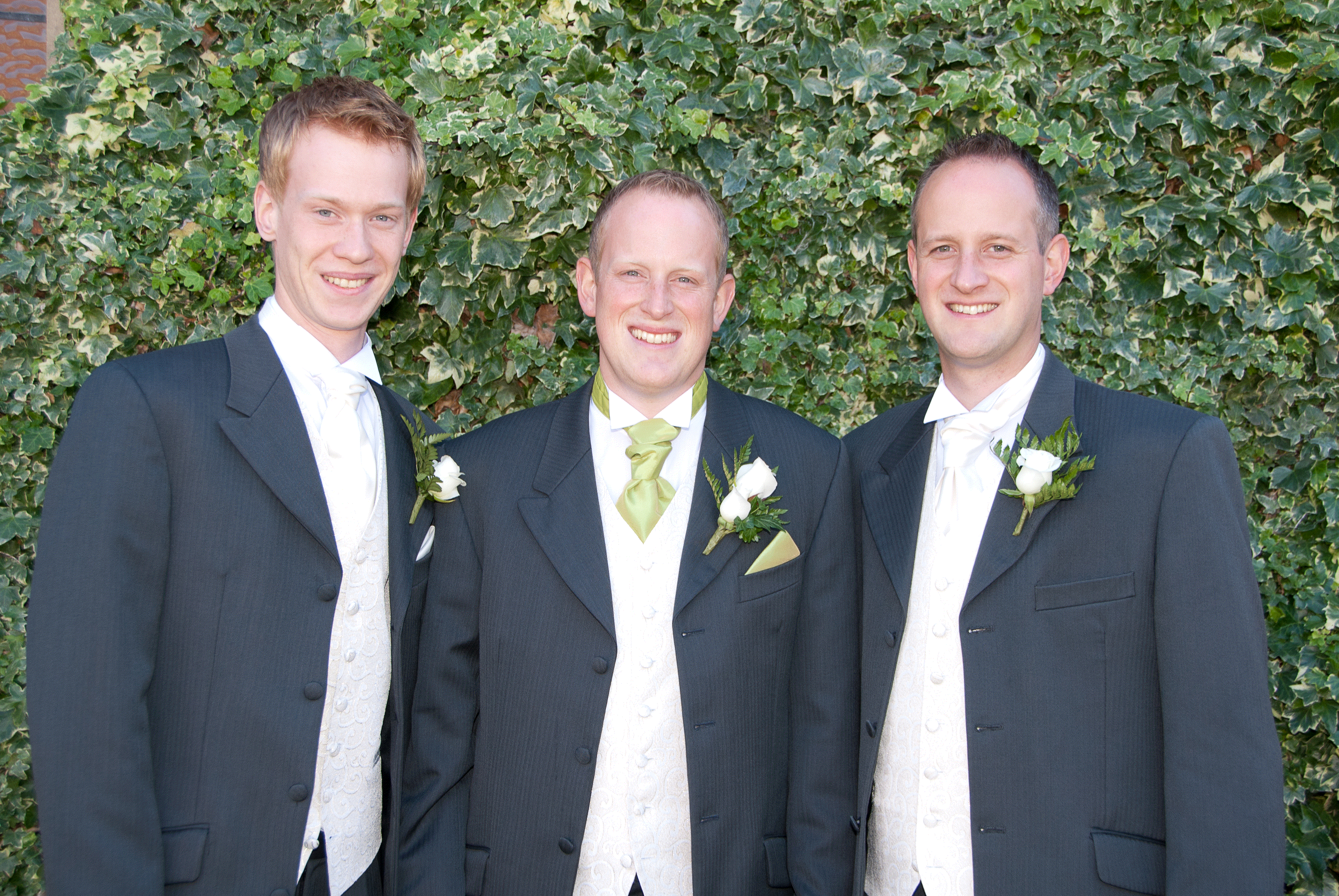


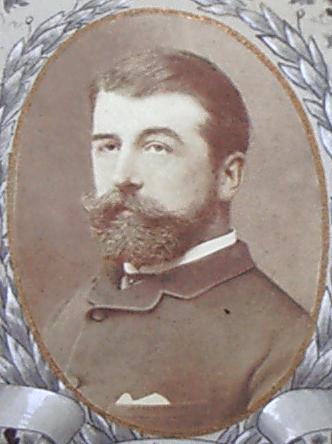

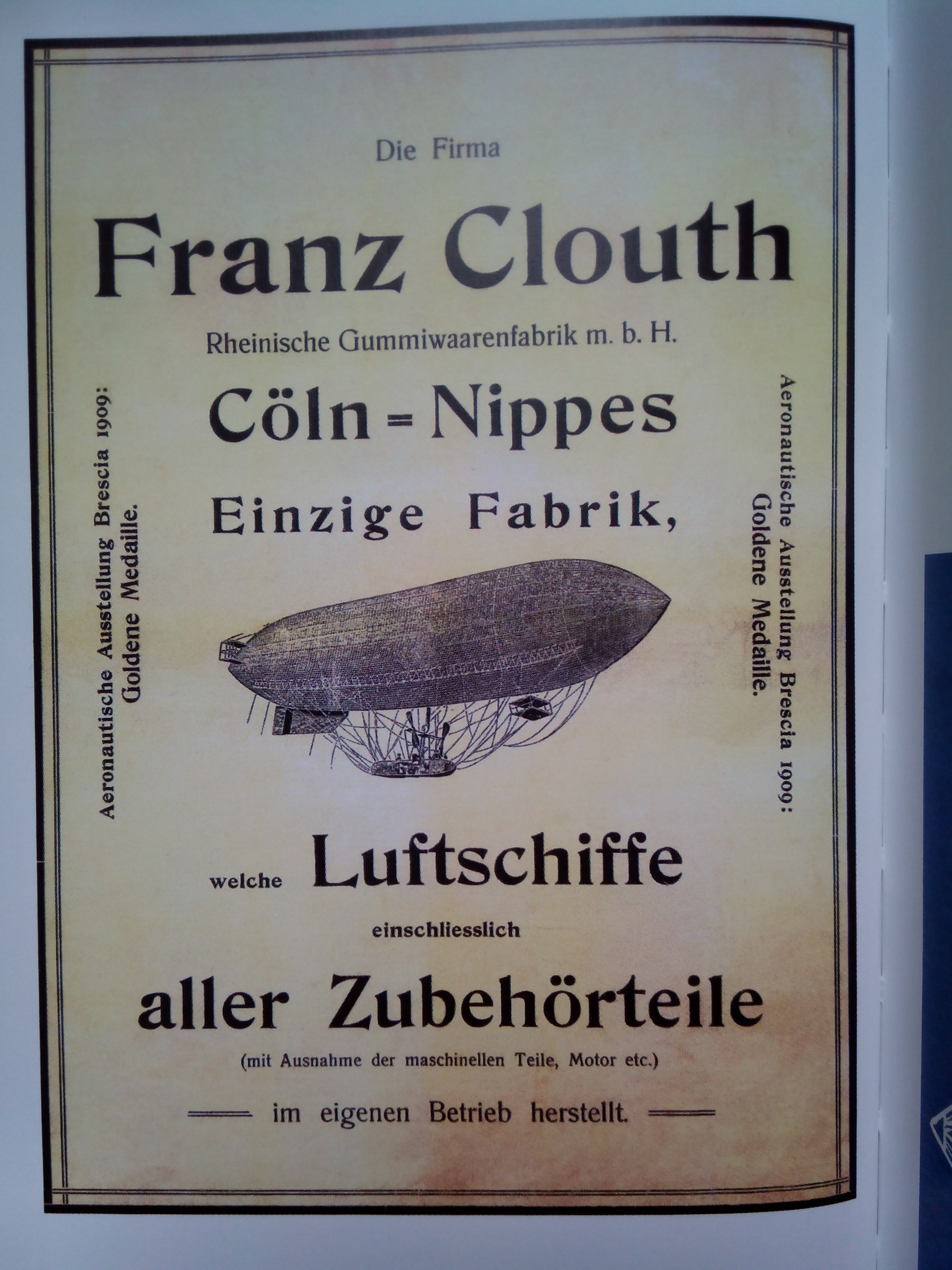
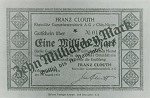




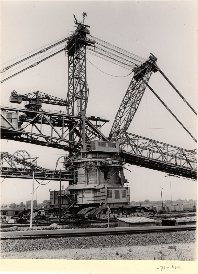
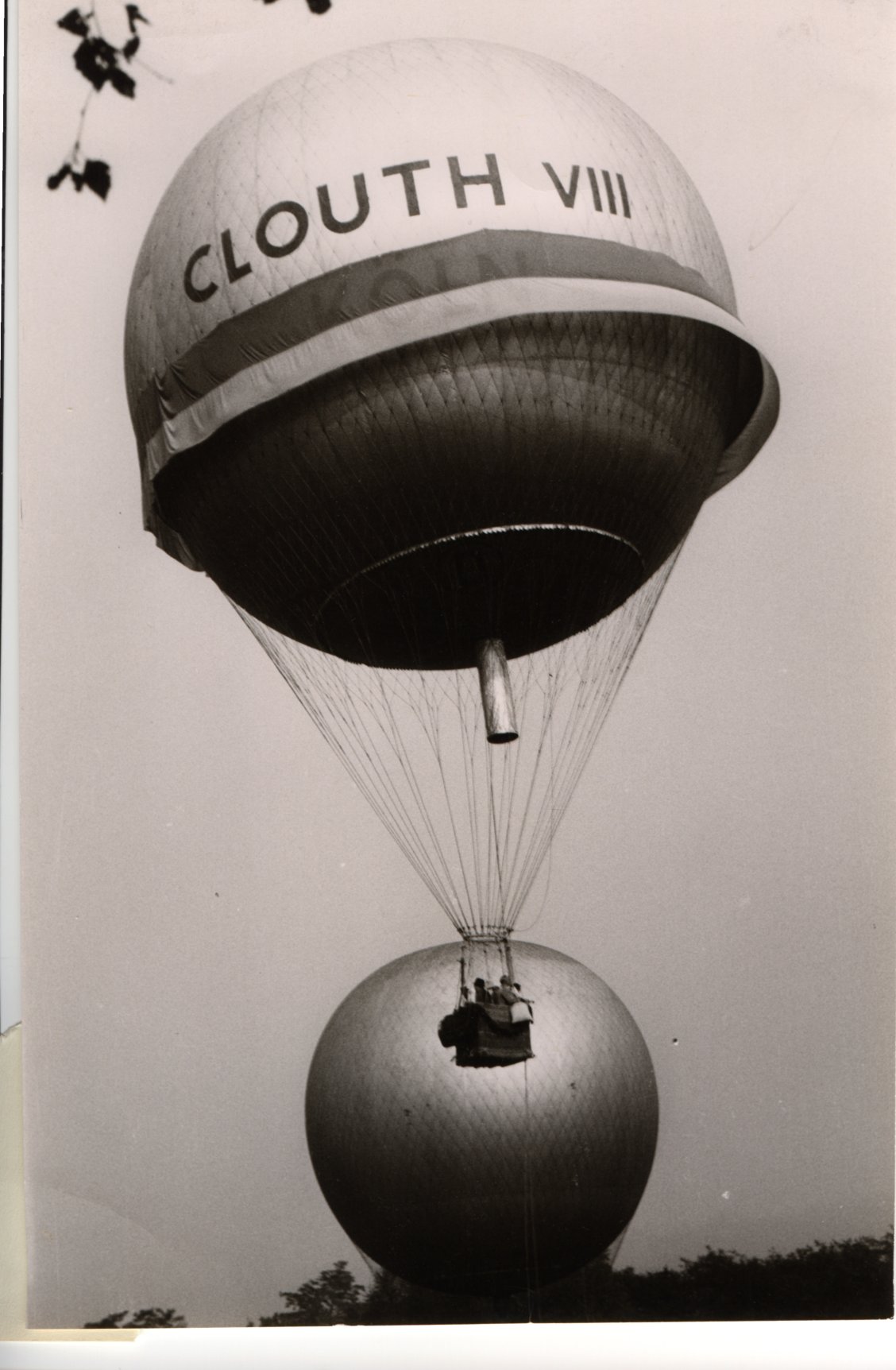



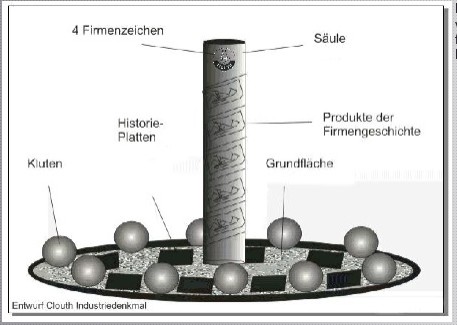
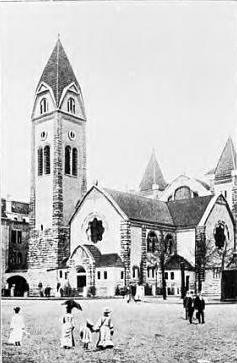

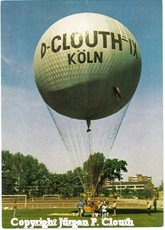

.jpg)
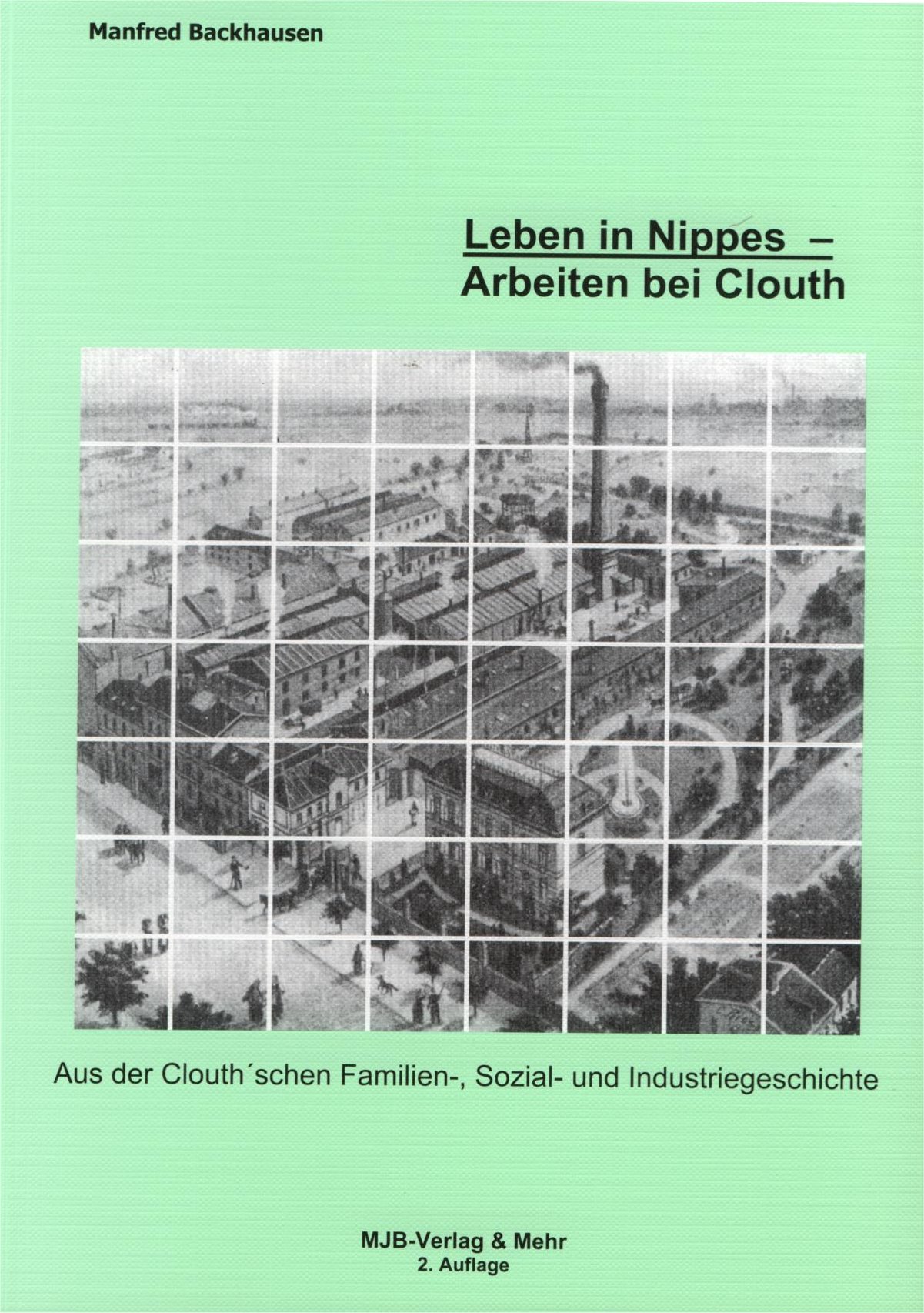
.jpg)



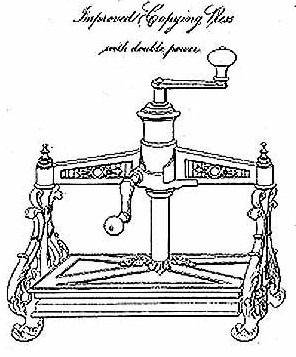
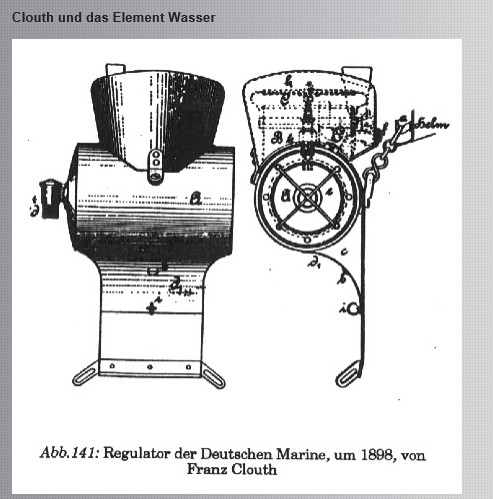



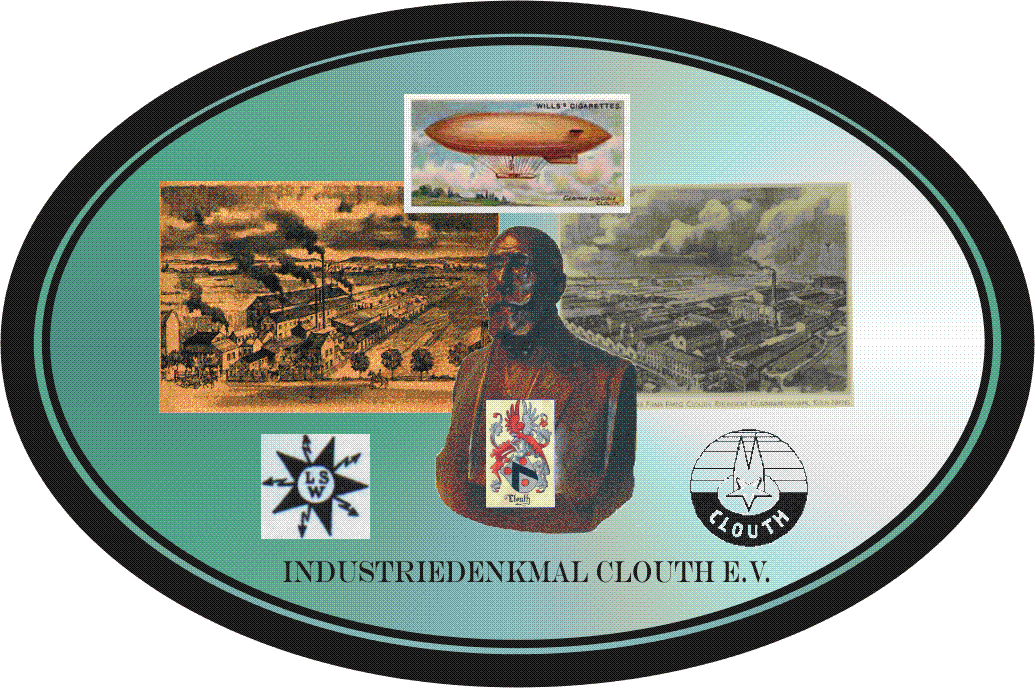




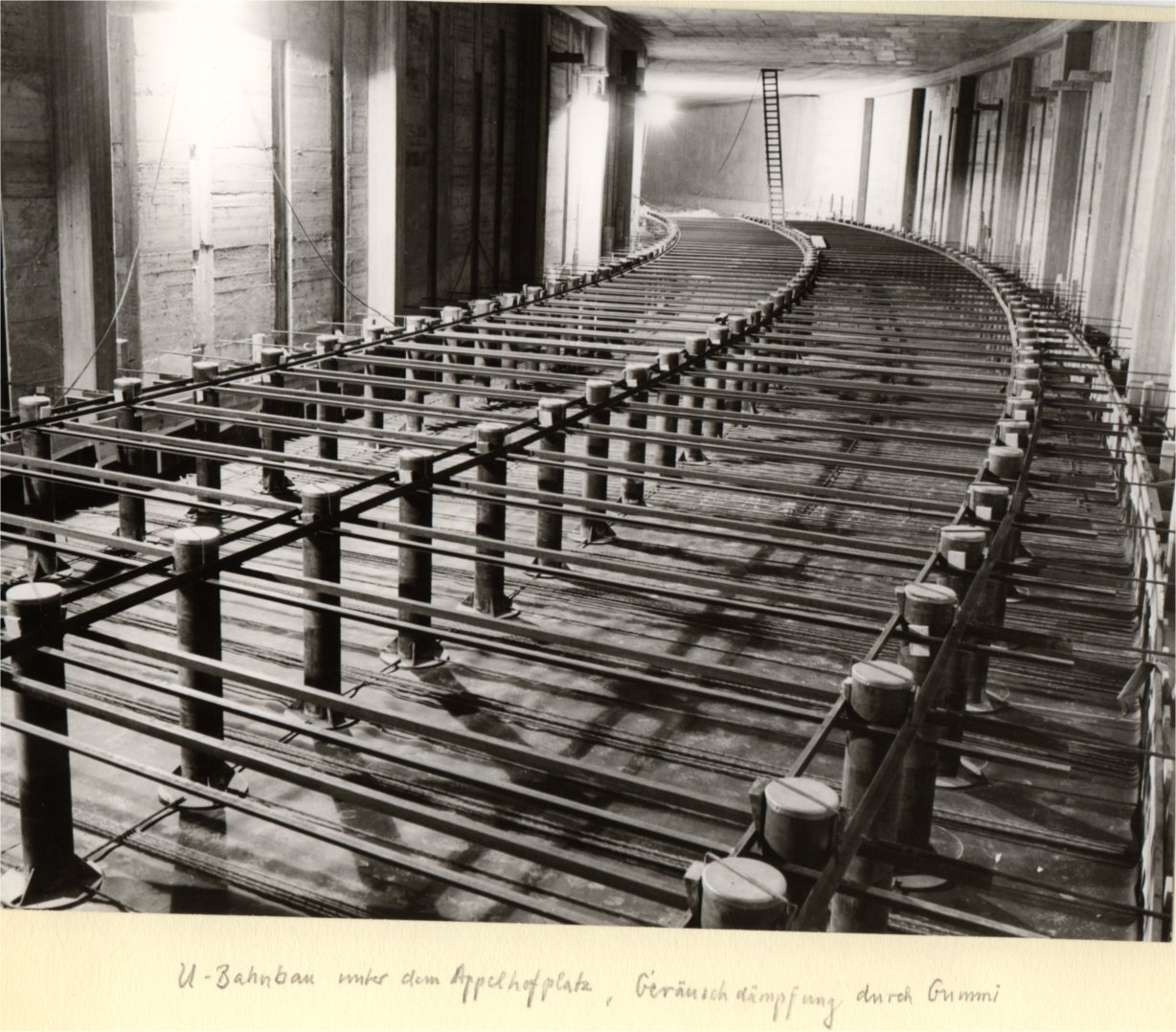
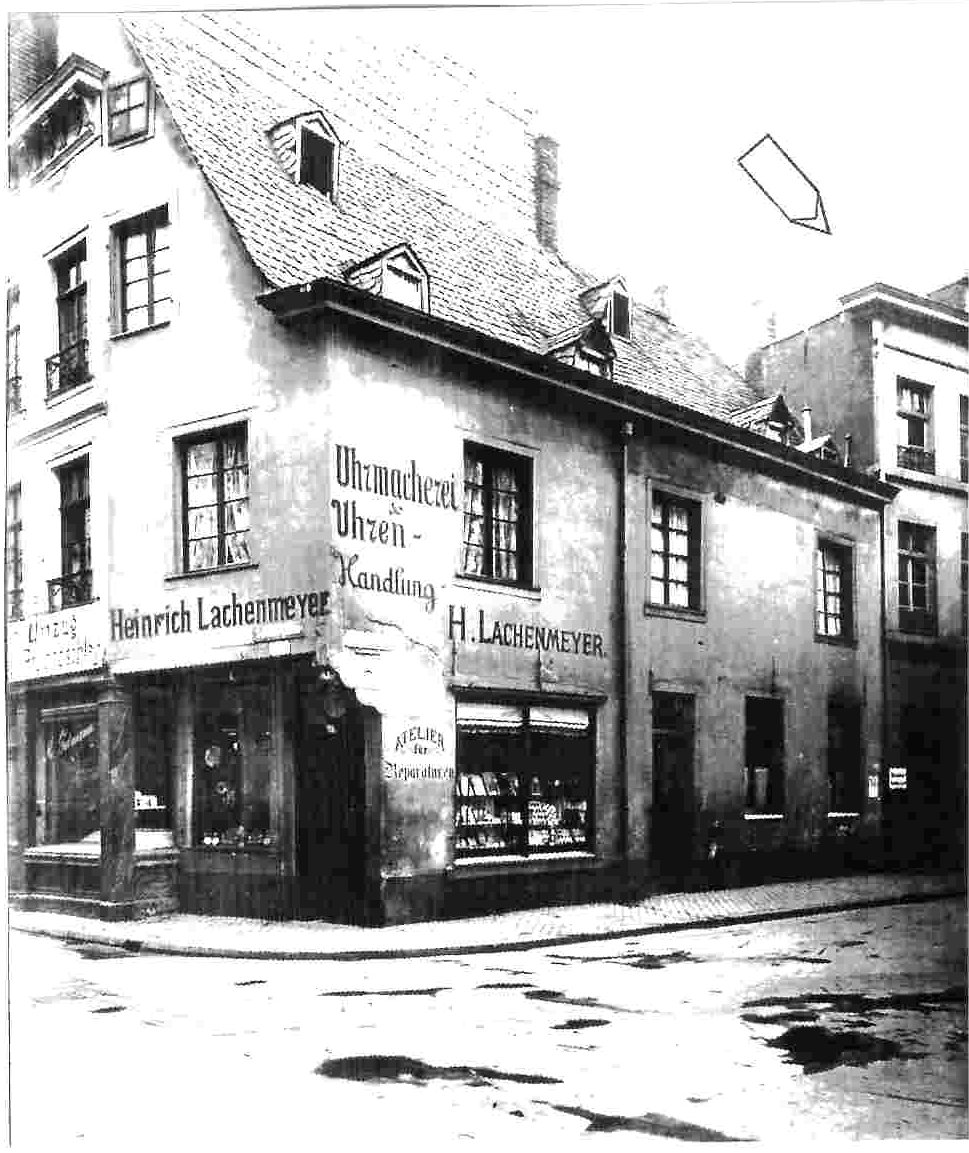

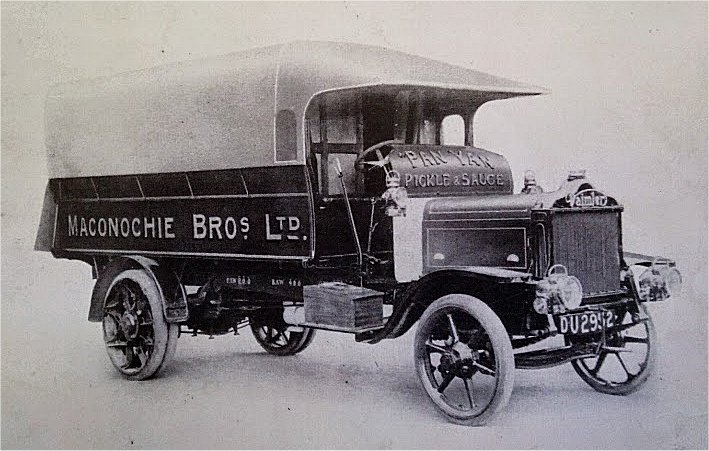
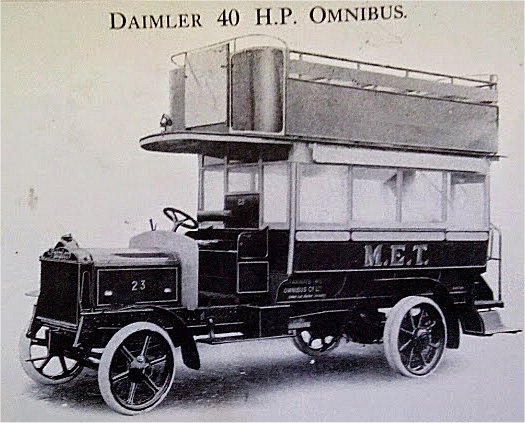


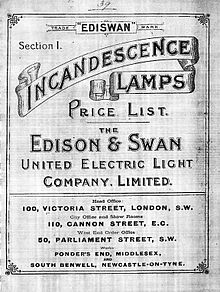




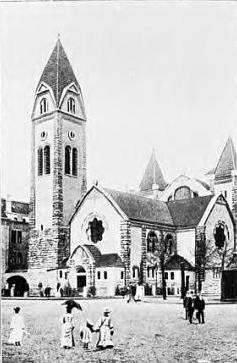
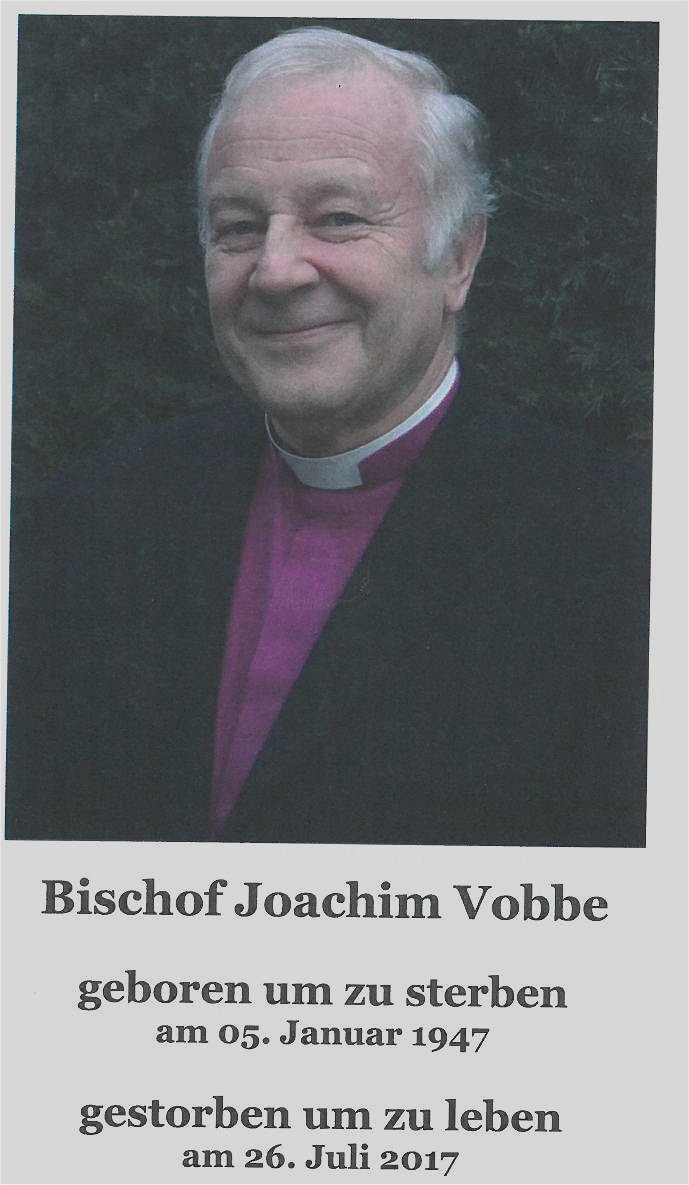
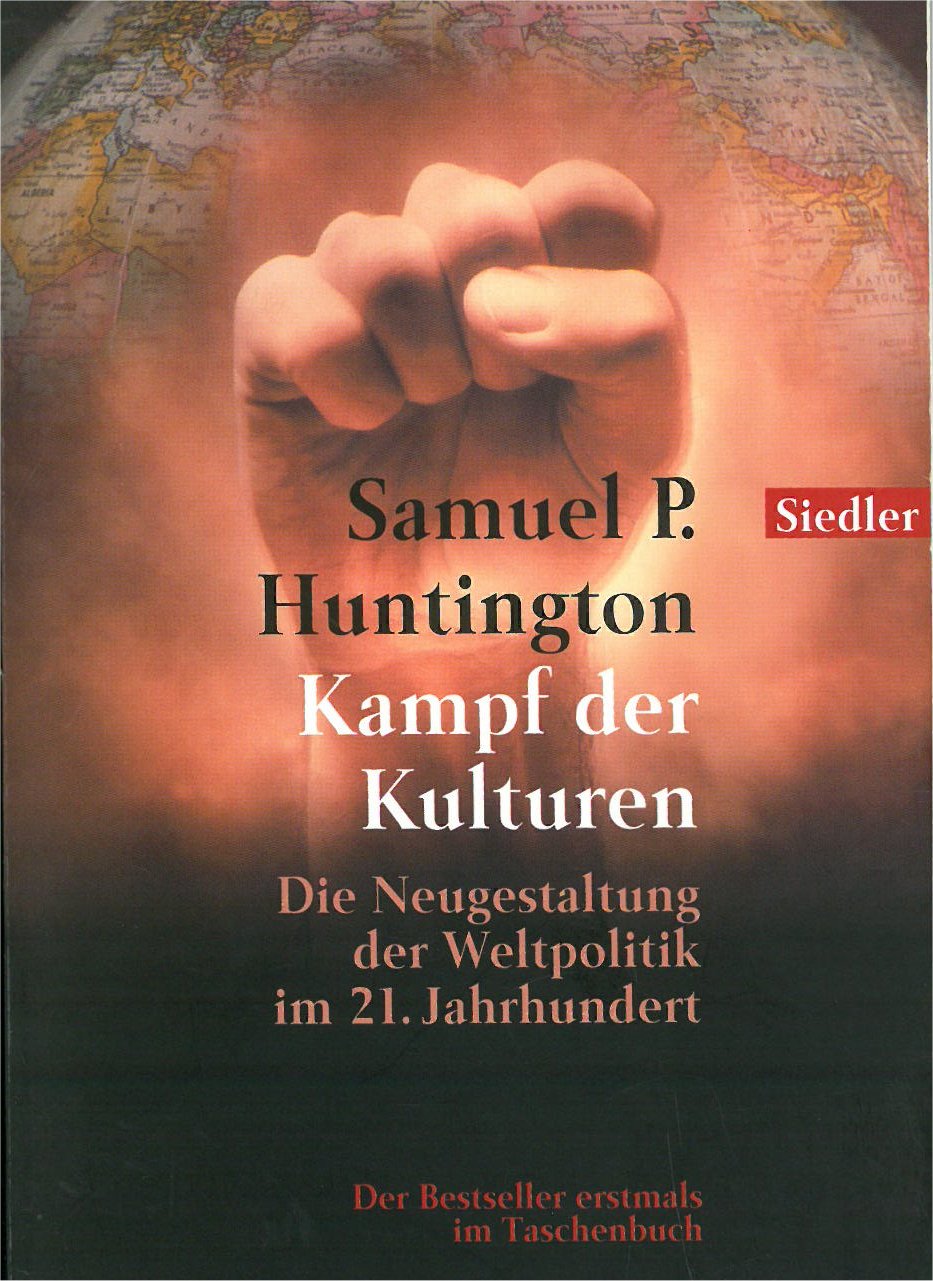
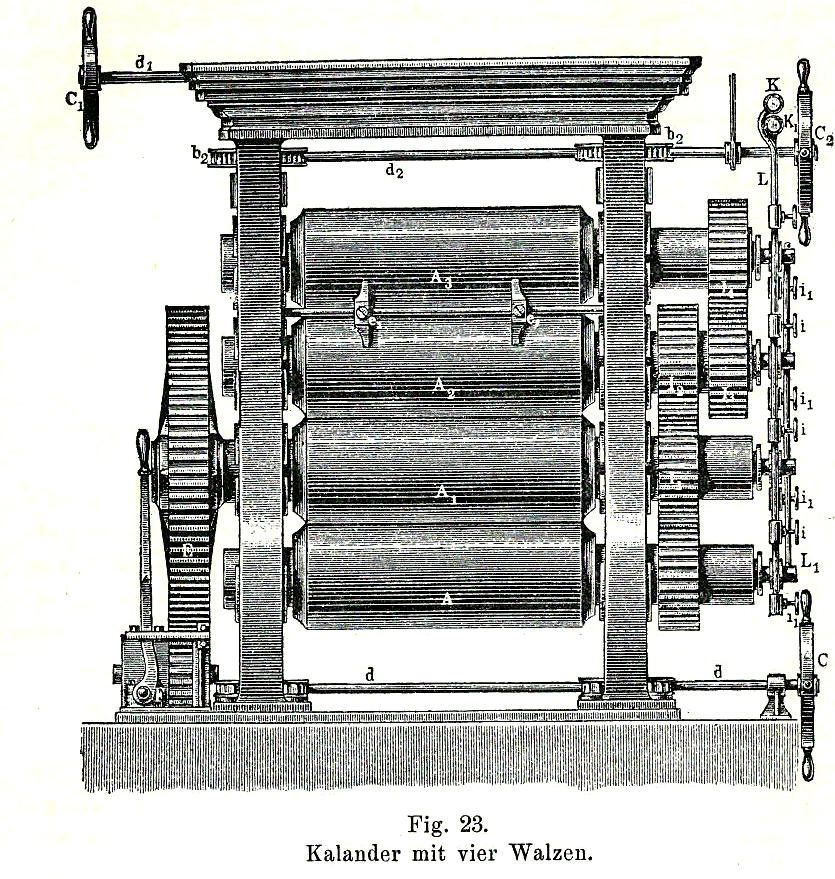
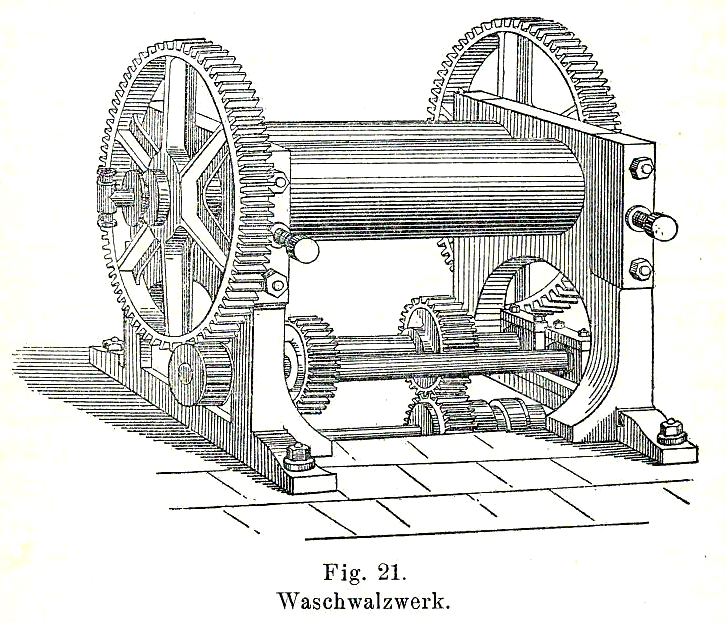

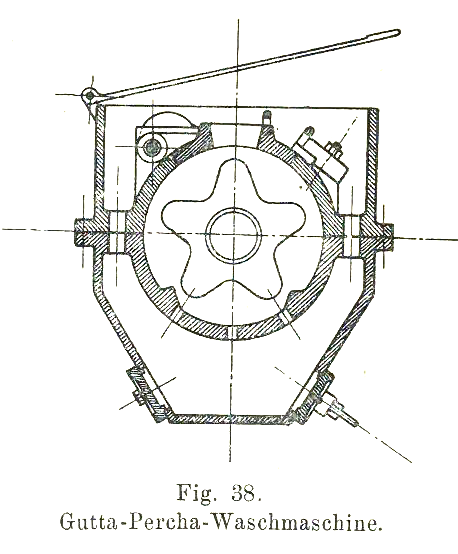
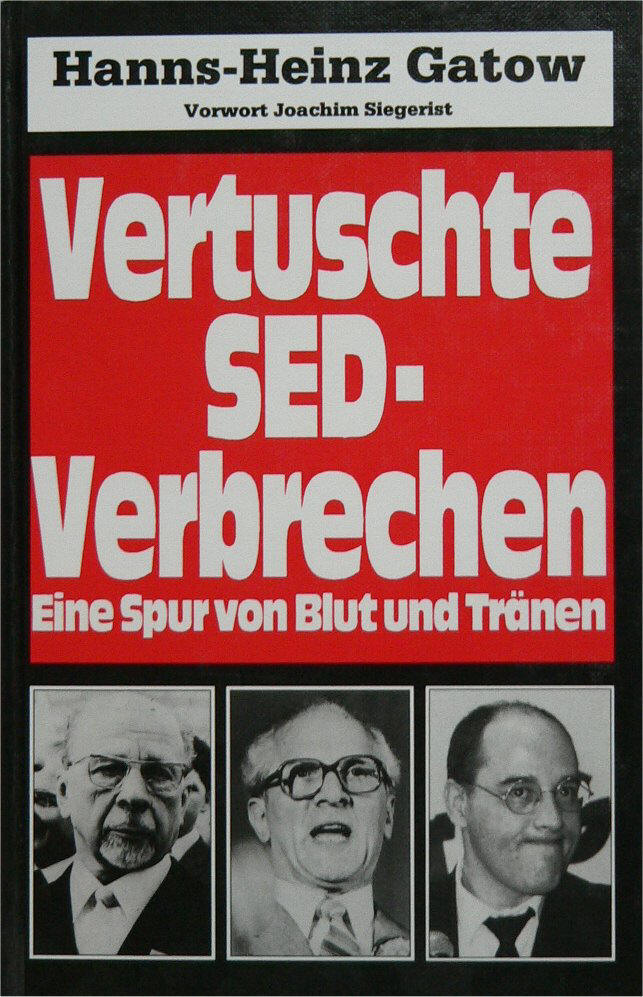
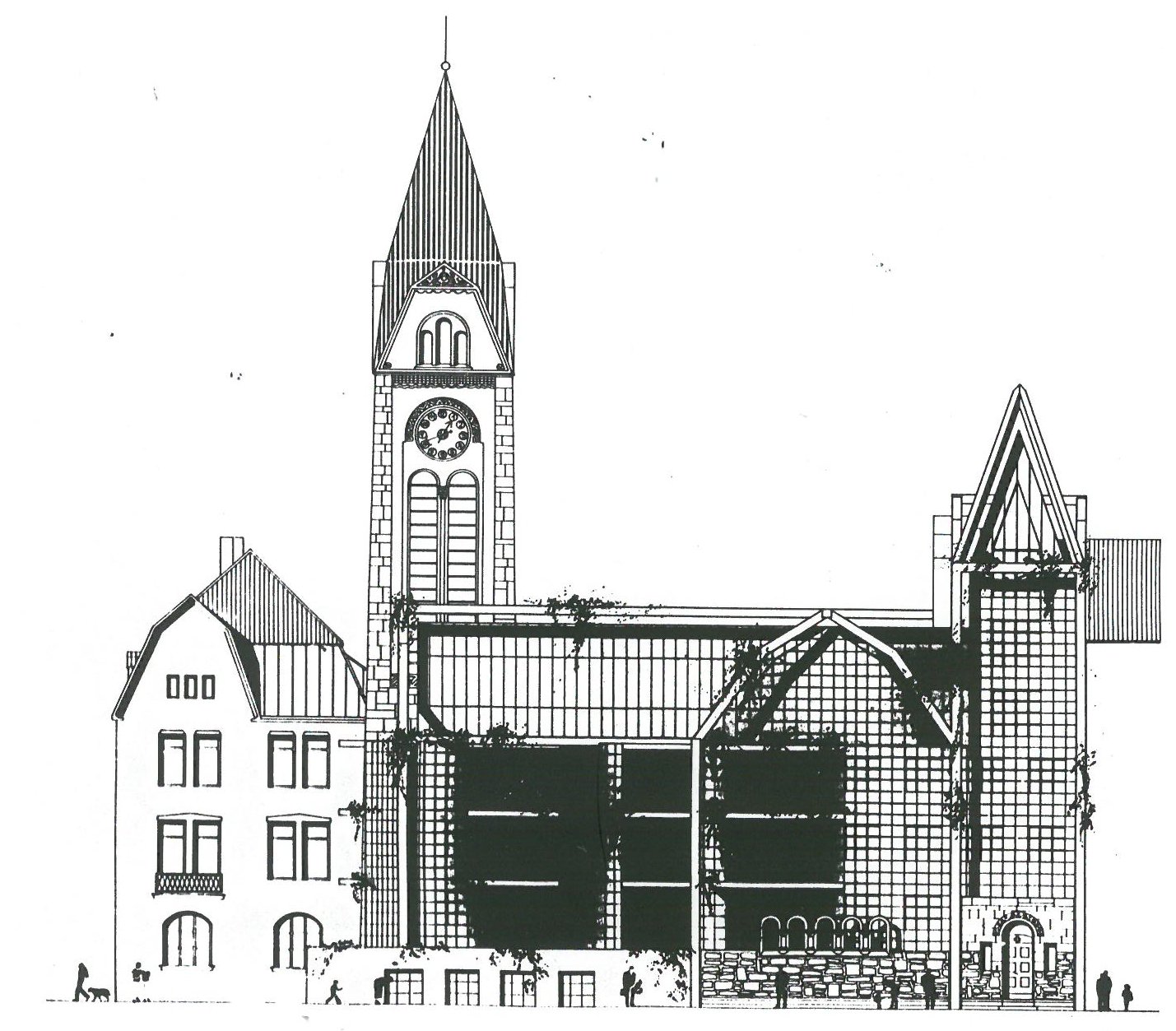


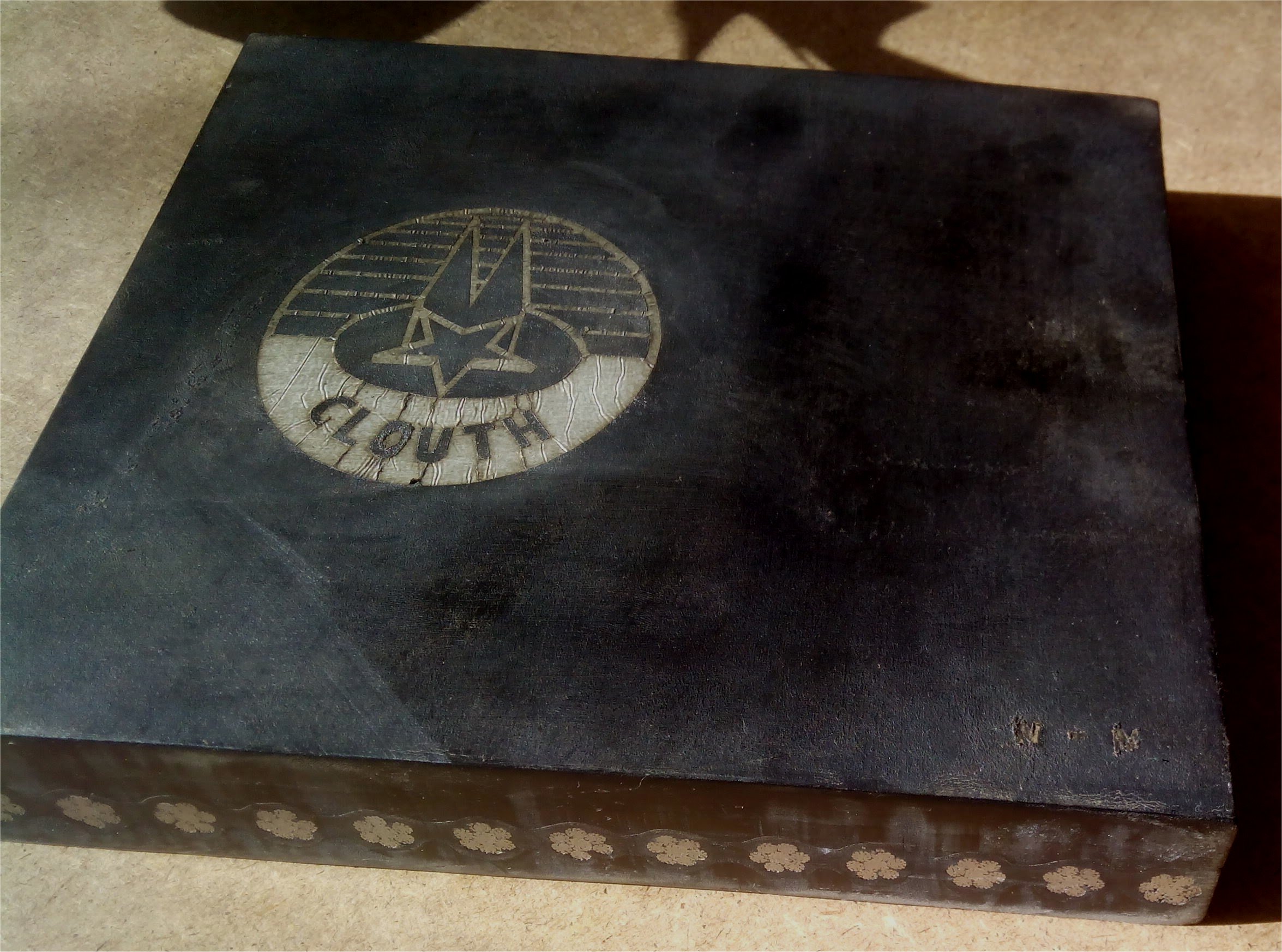



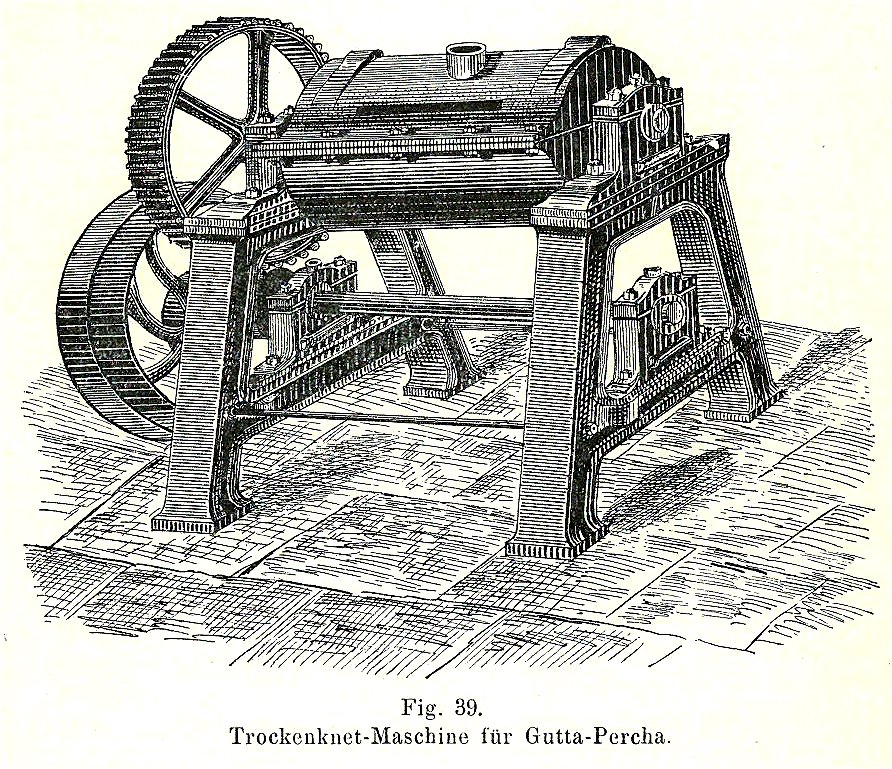
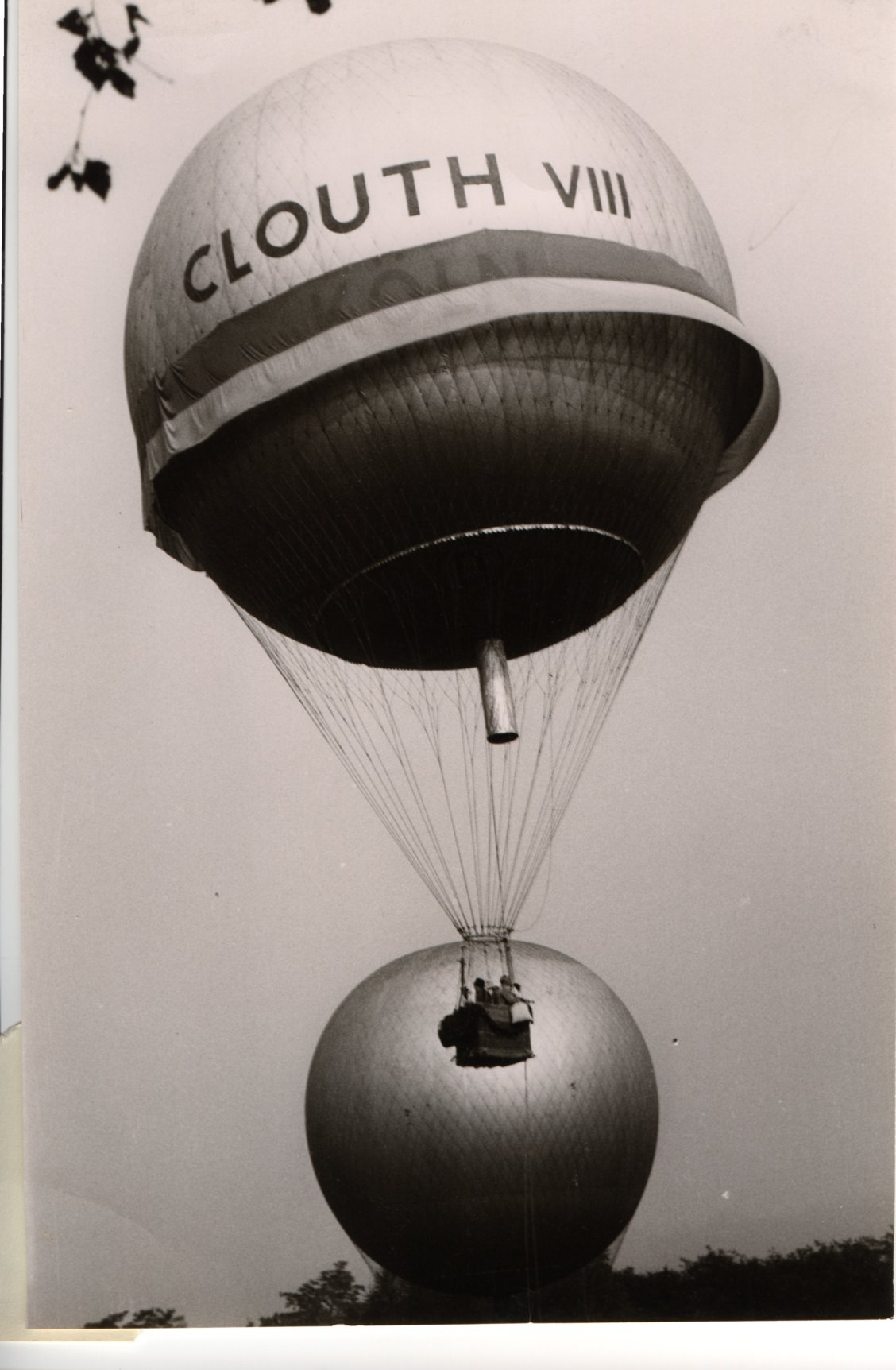

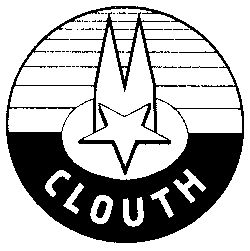




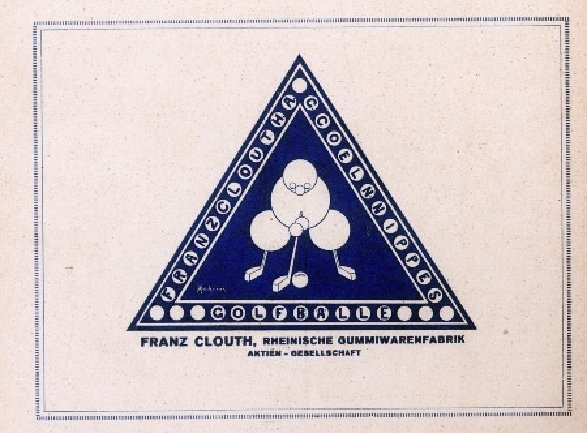


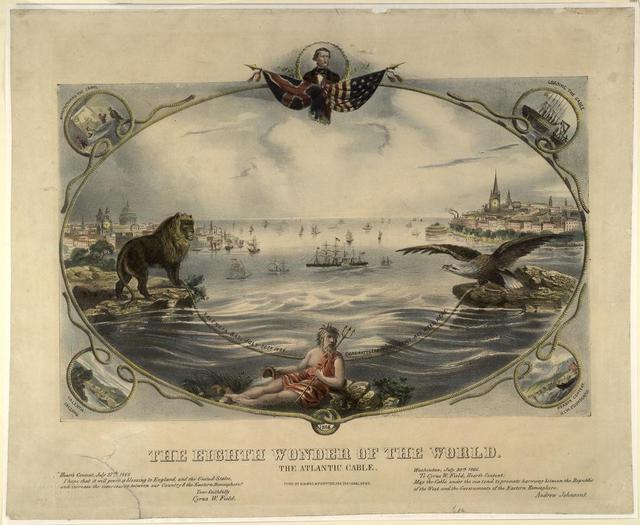

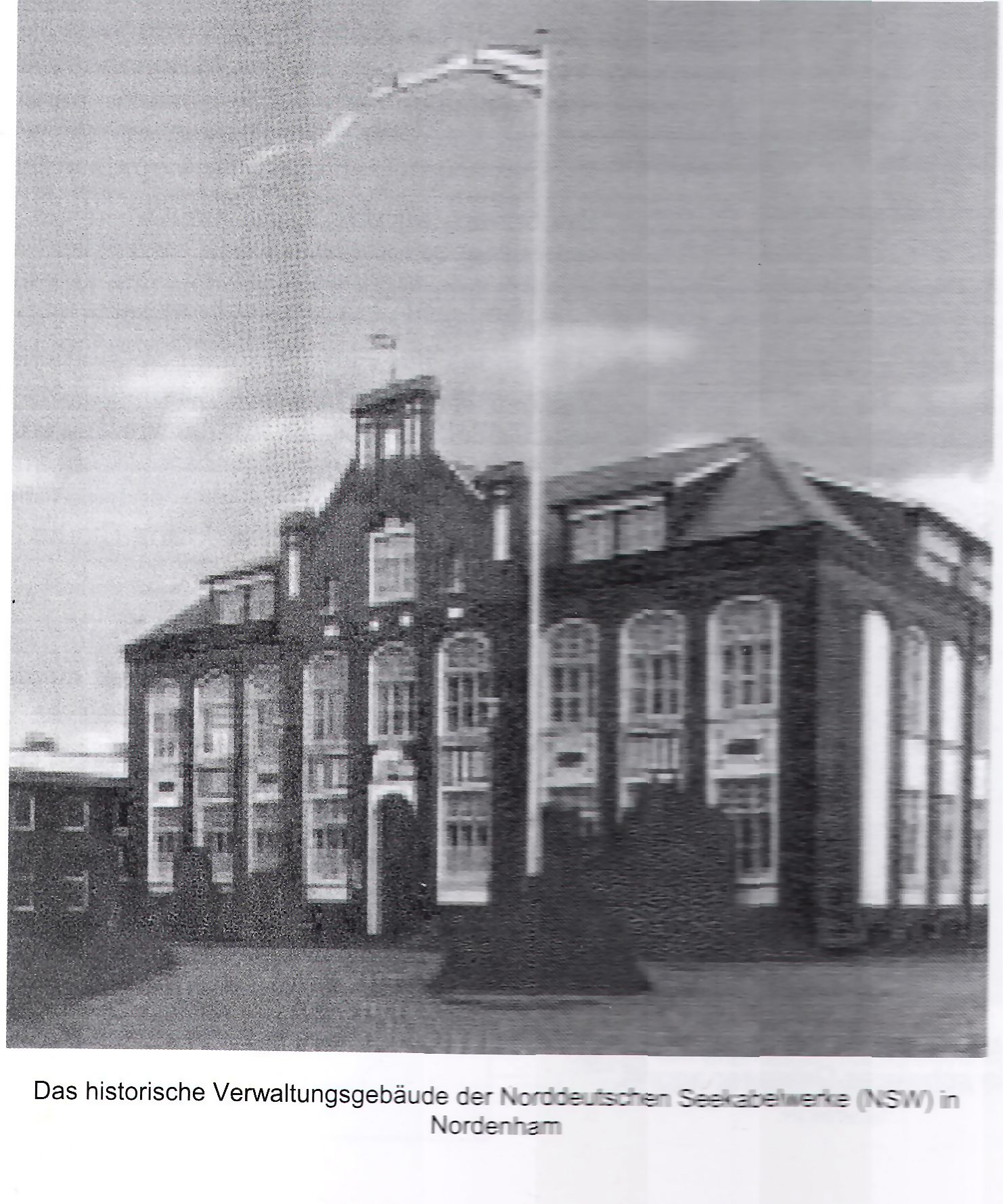
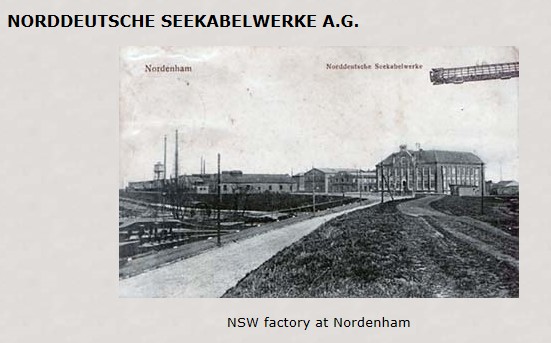
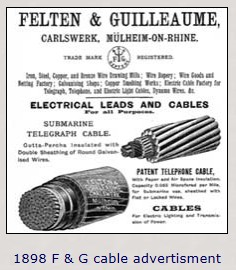 Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-
und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern
Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-
und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern
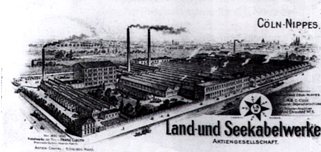 Deutschlands,
die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen
Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der
deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer
auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer
geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel
unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer
verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die
Errichtung einer Kabelfabrik
Deutschlands,
die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen
Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der
deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer
auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer
geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel
unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer
verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die
Errichtung einer Kabelfabrik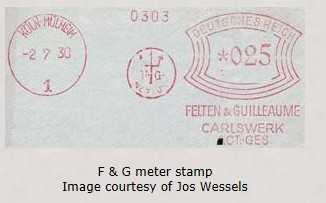 Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des
Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des
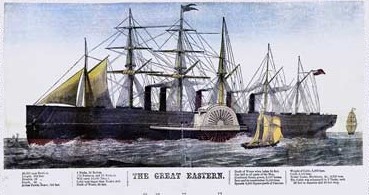 Zehn
Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,
die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden
sogenannte
Zehn
Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,
die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden
sogenannte
 transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische
See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von
transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische
See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von
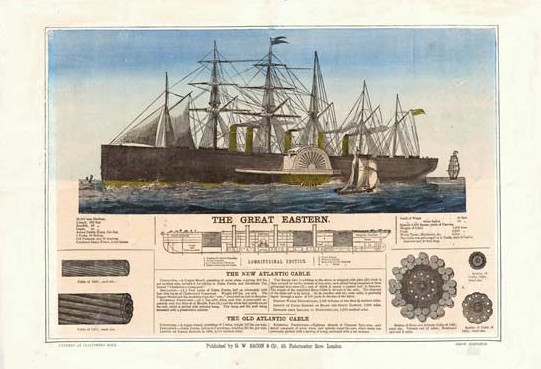
 Die Verlegung eines Transatlantikkabels
kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.
Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu
erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber
Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung
ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das
Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es
aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung
zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte
Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff
tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in
Glasgow/Schottland.
Die Verlegung eines Transatlantikkabels
kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.
Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu
erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber
Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung
ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das
Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es
aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung
zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte
Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff
tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in
Glasgow/Schottland.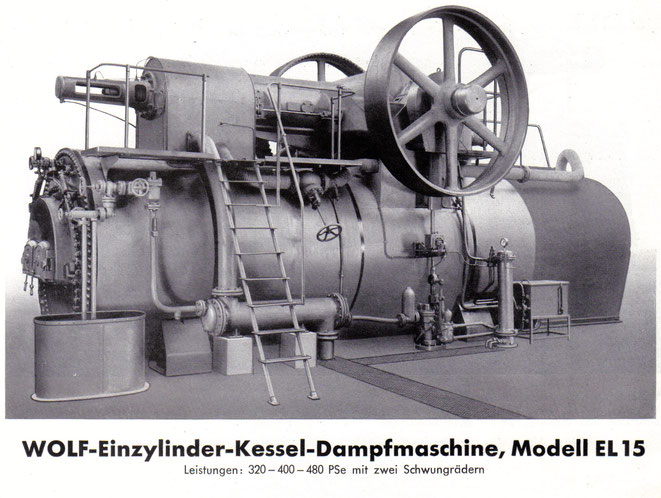

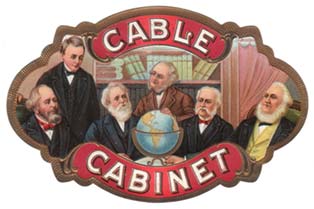 Lange
Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und
wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein
Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so
erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint
vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der
Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das
Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus
technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes
Unterfangen.
Lange
Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und
wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein
Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so
erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint
vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der
Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das
Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus
technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes
Unterfangen. 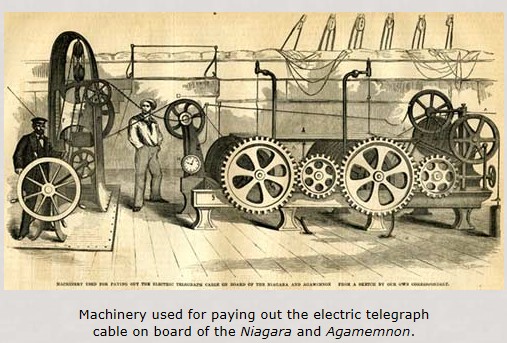 Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.
Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural
Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press
erschienen.
Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.
Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural
Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press
erschienen.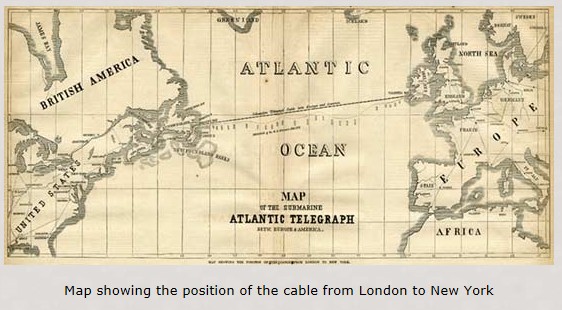 Hinzu
kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln
über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,
Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich
überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,
haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller
Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln.
Hinzu
kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln
über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,
Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich
überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,
haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller
Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln.  1858
gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,
dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum
Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen
durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem
Ozeanboden zurückbleibt.
1858
gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,
dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum
Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen
durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem
Ozeanboden zurückbleibt.  einem profunden
Technik- und Fortschrittsglauben.
einem profunden
Technik- und Fortschrittsglauben.  Manch
einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes
Manch
einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes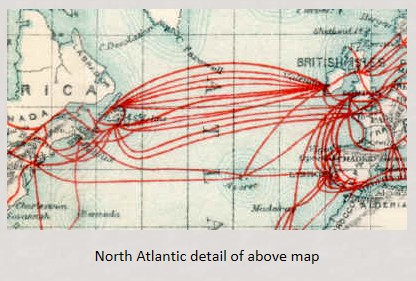 Seekabelnetzwerk
aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum
Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser
Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen.
Seekabelnetzwerk
aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum
Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser
Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen. 
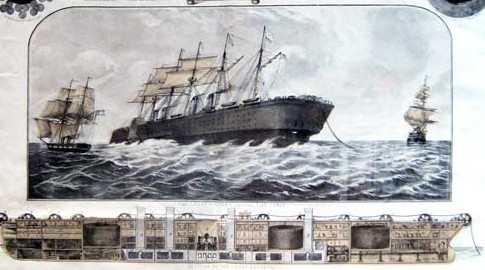 In
den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach
verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische
Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das
gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des
Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche
gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten
täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein
Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten
multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen.
In
den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach
verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische
Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das
gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des
Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche
gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten
täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein
Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten
multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen.  In
den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen
vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt
kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches
Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines
einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die
Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt
die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der
drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr
kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,
Unternehmern, Journalisten und Politikern.
In
den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen
vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt
kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches
Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines
einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die
Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt
die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der
drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr
kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,
Unternehmern, Journalisten und Politikern.  Netzwerke
rund um den gesamten Globus.
Netzwerke
rund um den gesamten Globus. 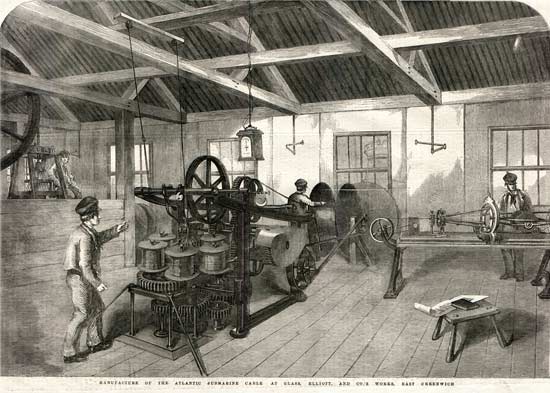 Als
Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet
lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und
Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.
Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung
und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus
dem britischen Imperium.
Als
Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet
lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und
Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.
Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung
und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus
dem britischen Imperium. 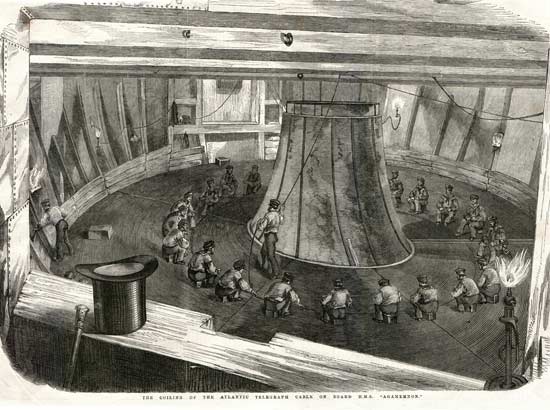 versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen
Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die
Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt
die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba
nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein
Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom
Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.
versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen
Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die
Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt
die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba
nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein
Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom
Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr. 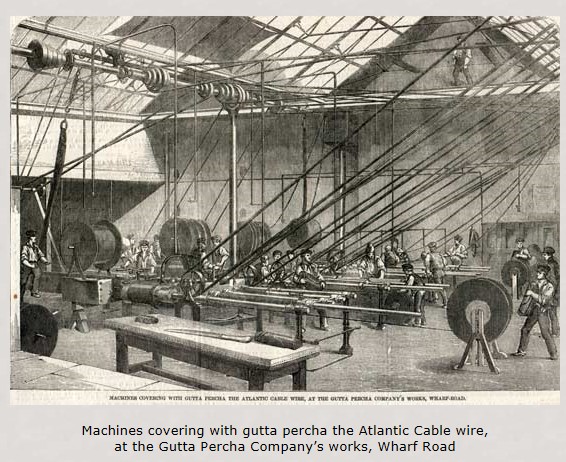 Journalisten
treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant
erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste
Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch
interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen
Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren
informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die
Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die
Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so
weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz
John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt
werden können.
Journalisten
treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant
erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste
Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch
interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen
Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren
informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die
Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die
Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so
weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz
John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt
werden können. 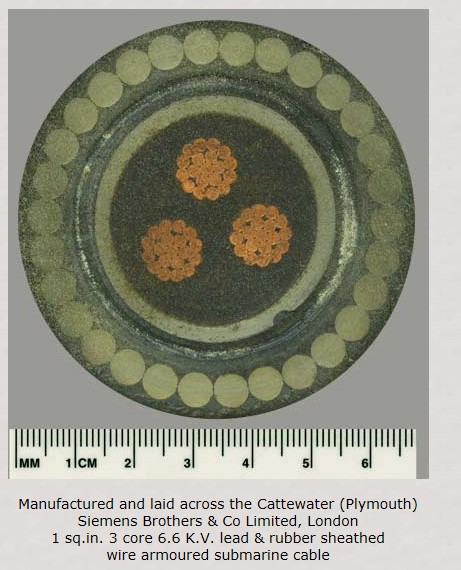
 Das
erste Transatlantikkabel war 1858 von
Das
erste Transatlantikkabel war 1858 von
 Das
mit
Das
mit
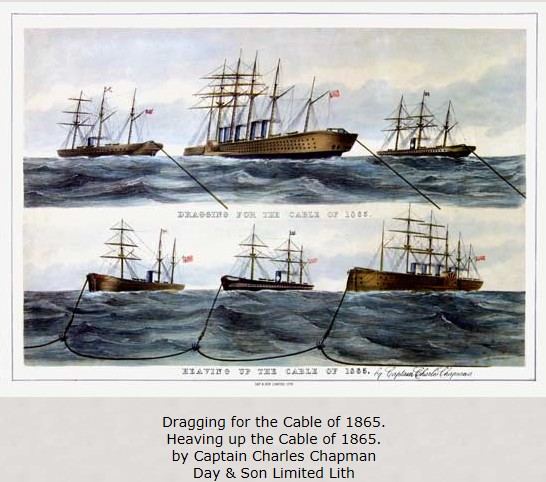 Zu
Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.
Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von
Zu
Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.
Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von