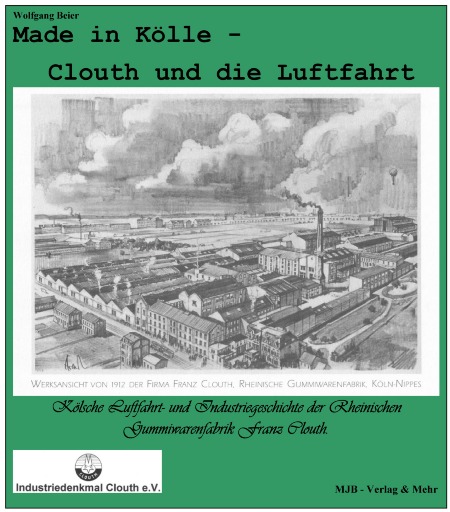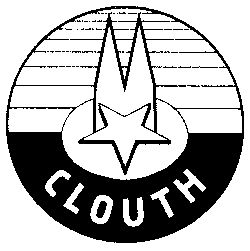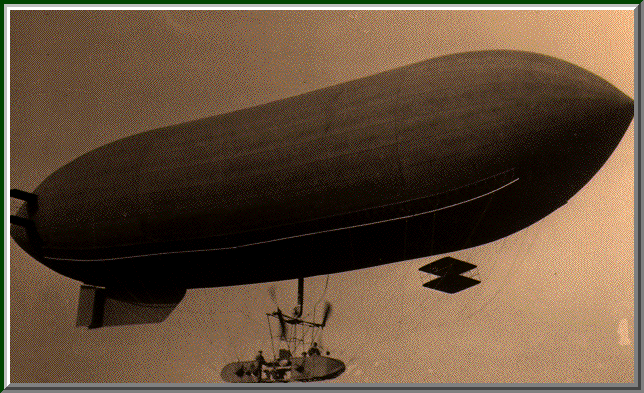|
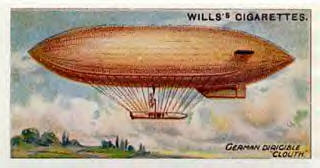
Lenkbares Luftschiff
Clouth
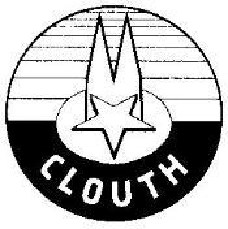
Clouth Firmen Logo

Tiefsee-Kabel

Altreifen
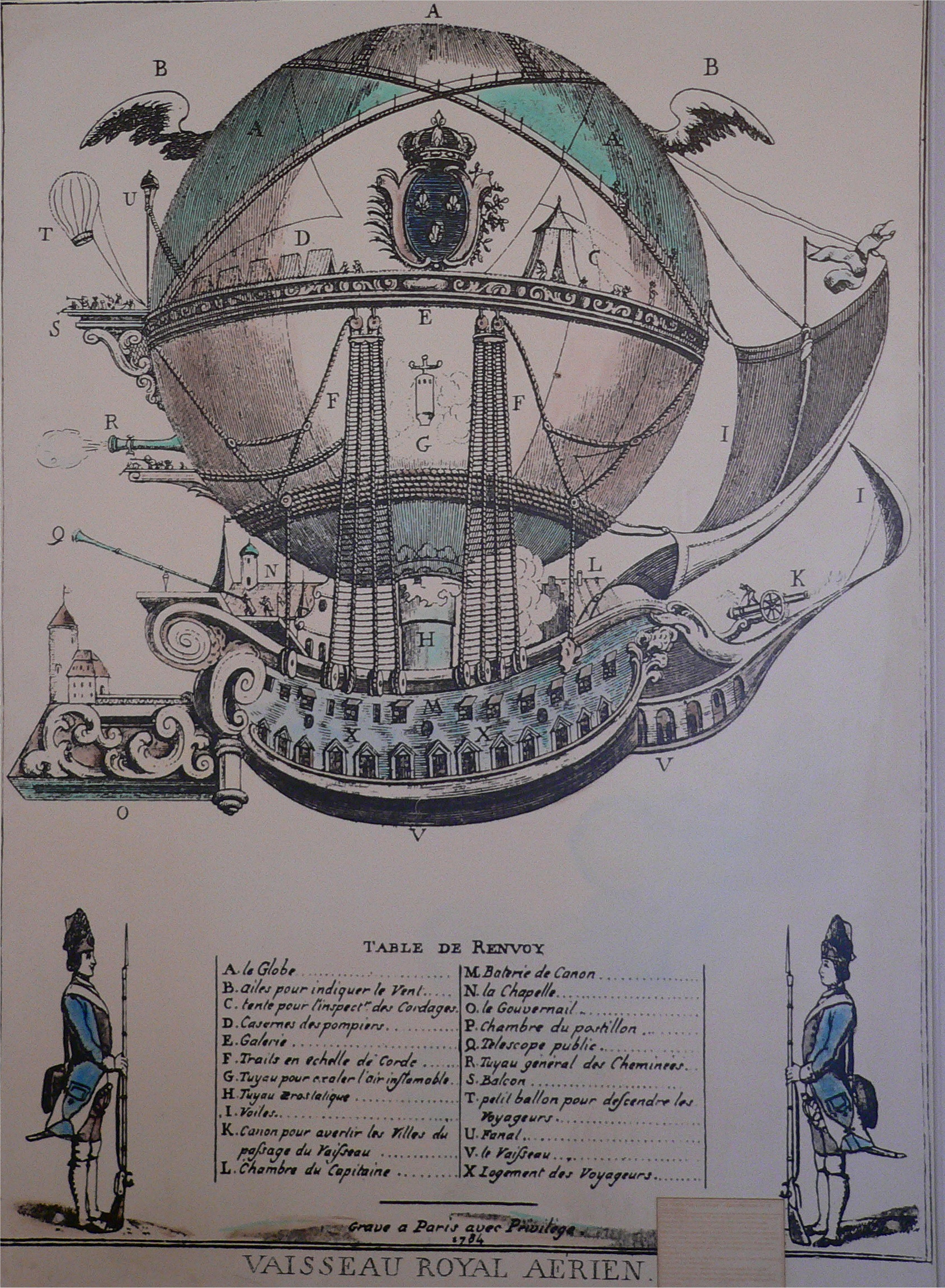
Erste Militärballons

Bakelite Radio
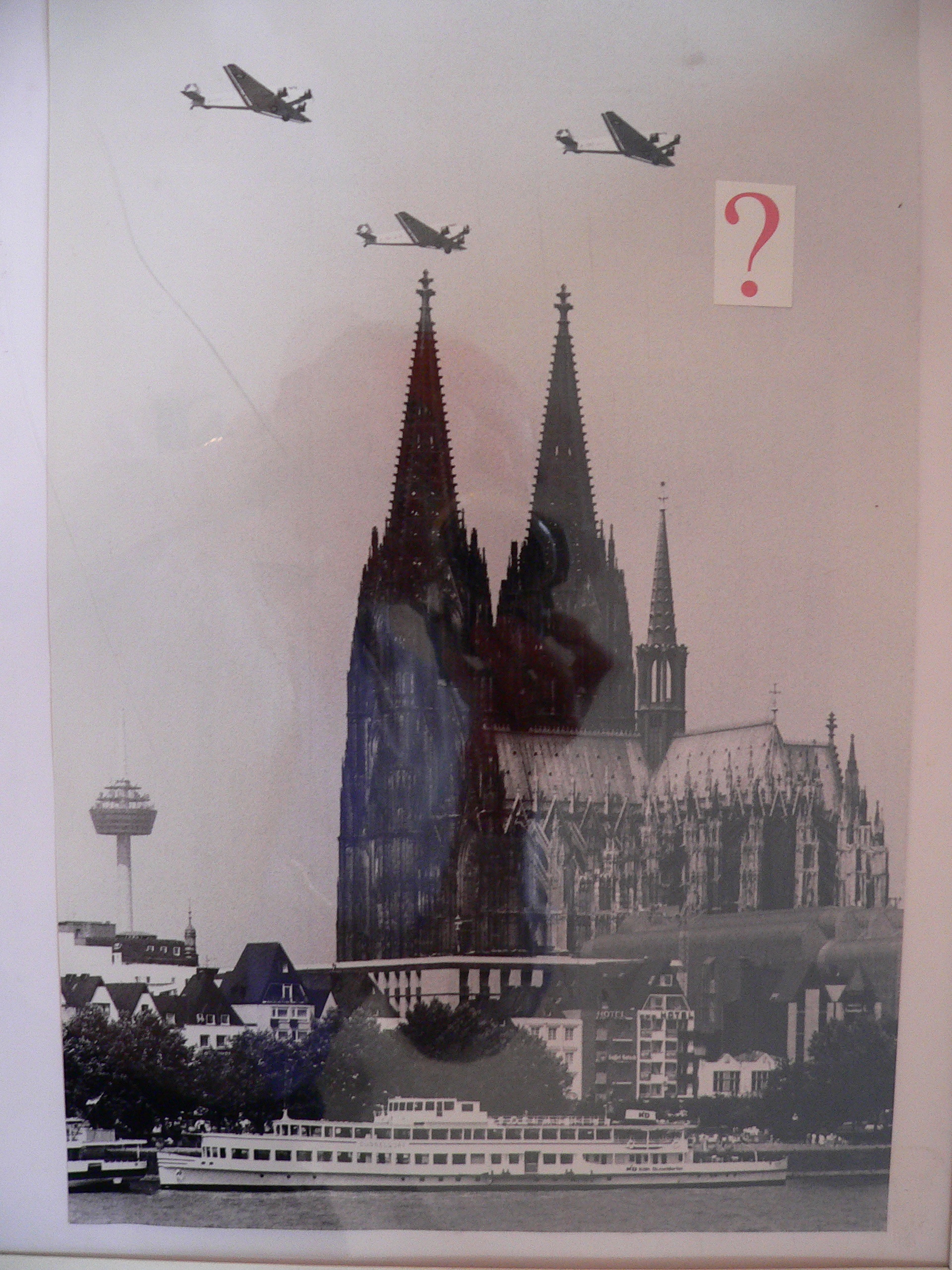
Cöln Anfang 20 Jhdt.
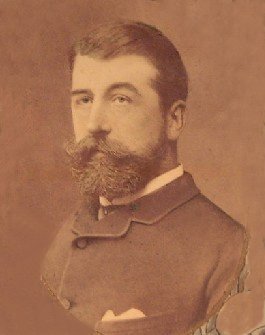
Franz Julius Hubert
Clouth
1862
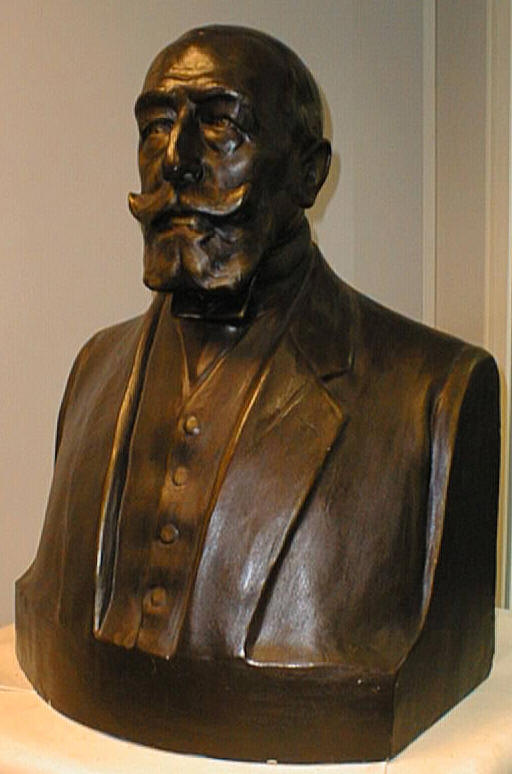
Bronze Büste Franz
Clouth

Franz Clouth 1905
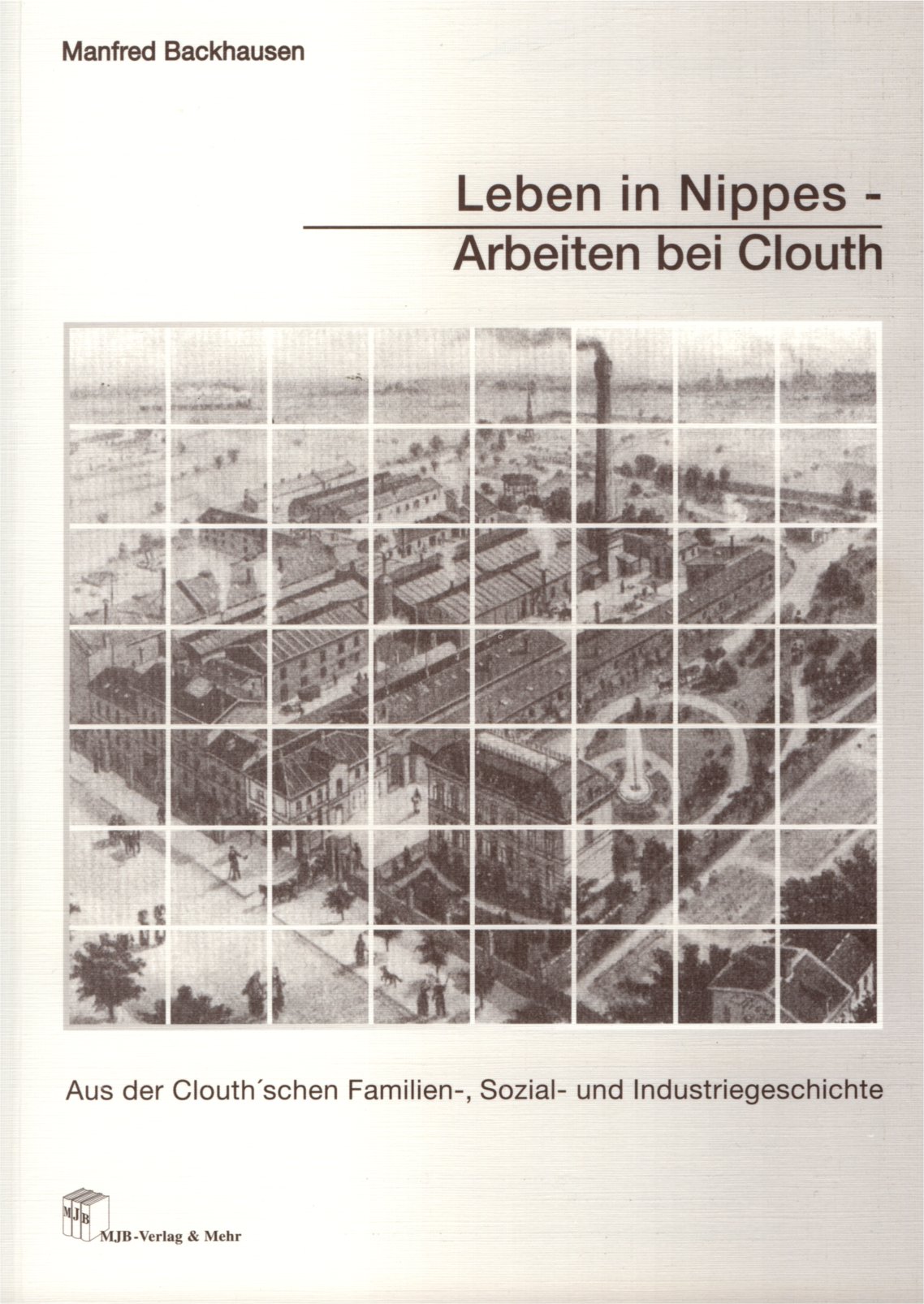
Clouth Book 1st Edition

Tauchhelm Clouth
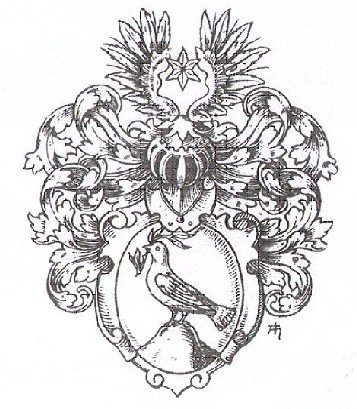
Altwappen Clouth
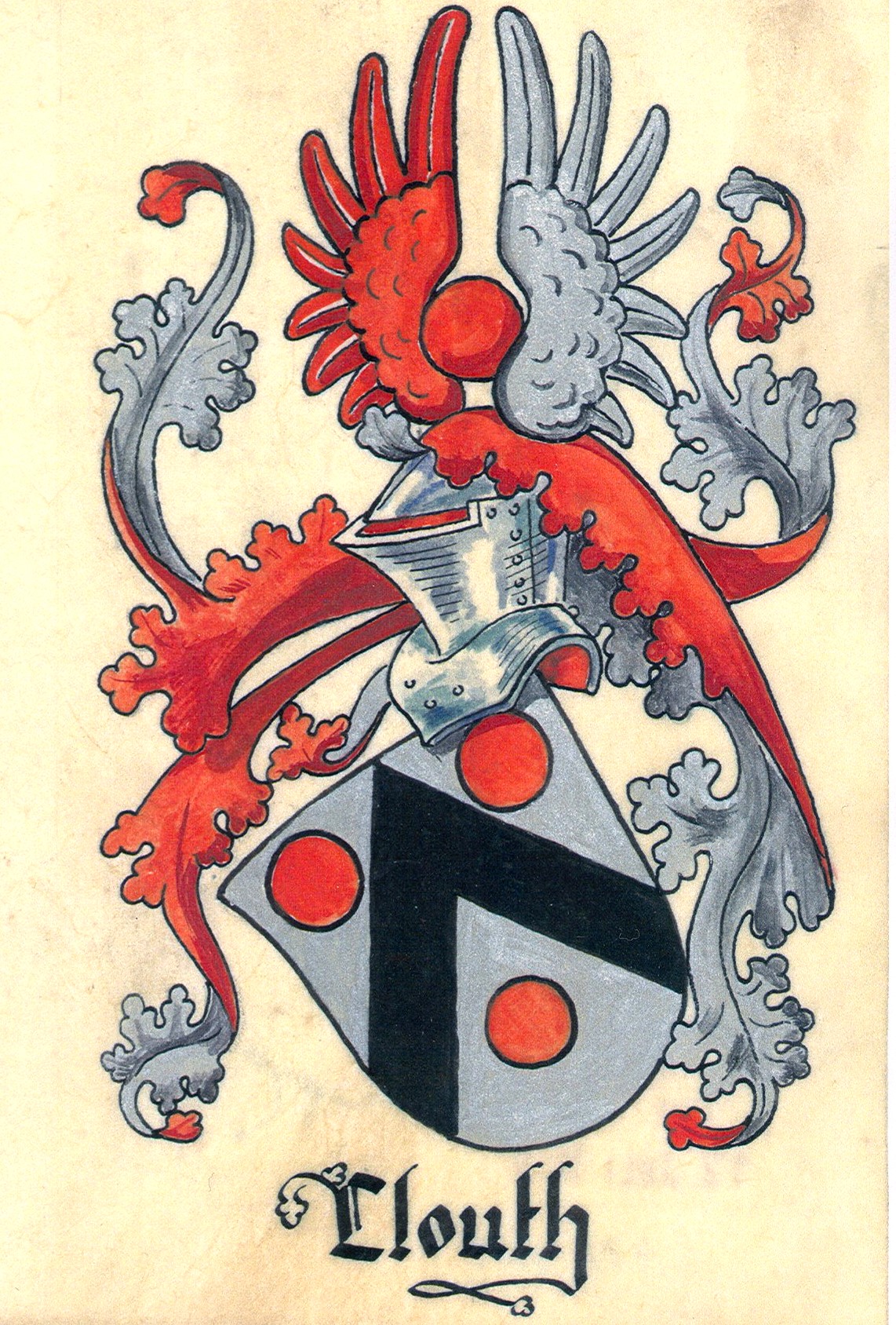
Clouth-Wappen 1923

Max Josef Wilhelm
Clouth
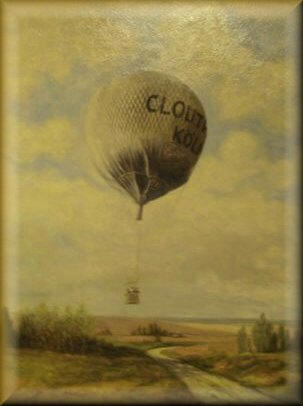
Preisbild
Ballonwettbewerb
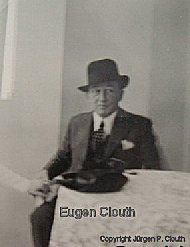
Eugen Clouth

"Anni" Heine Clouth
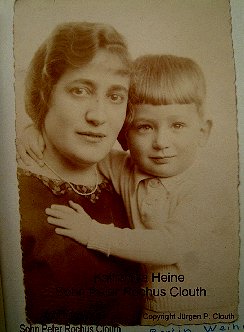
Anni & Peter

Peter Rochus Clouth

Margot Clouth, geb.
Krämer
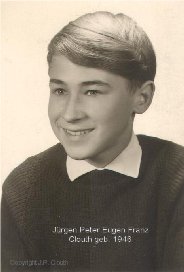
Jürgen Clouth 12

Vettern Peter (l) &
John (r)

Rechtsanwalt J.P.
Clouth

Ehefrau Audrey Clouth
15.1.1950-22.11.2017
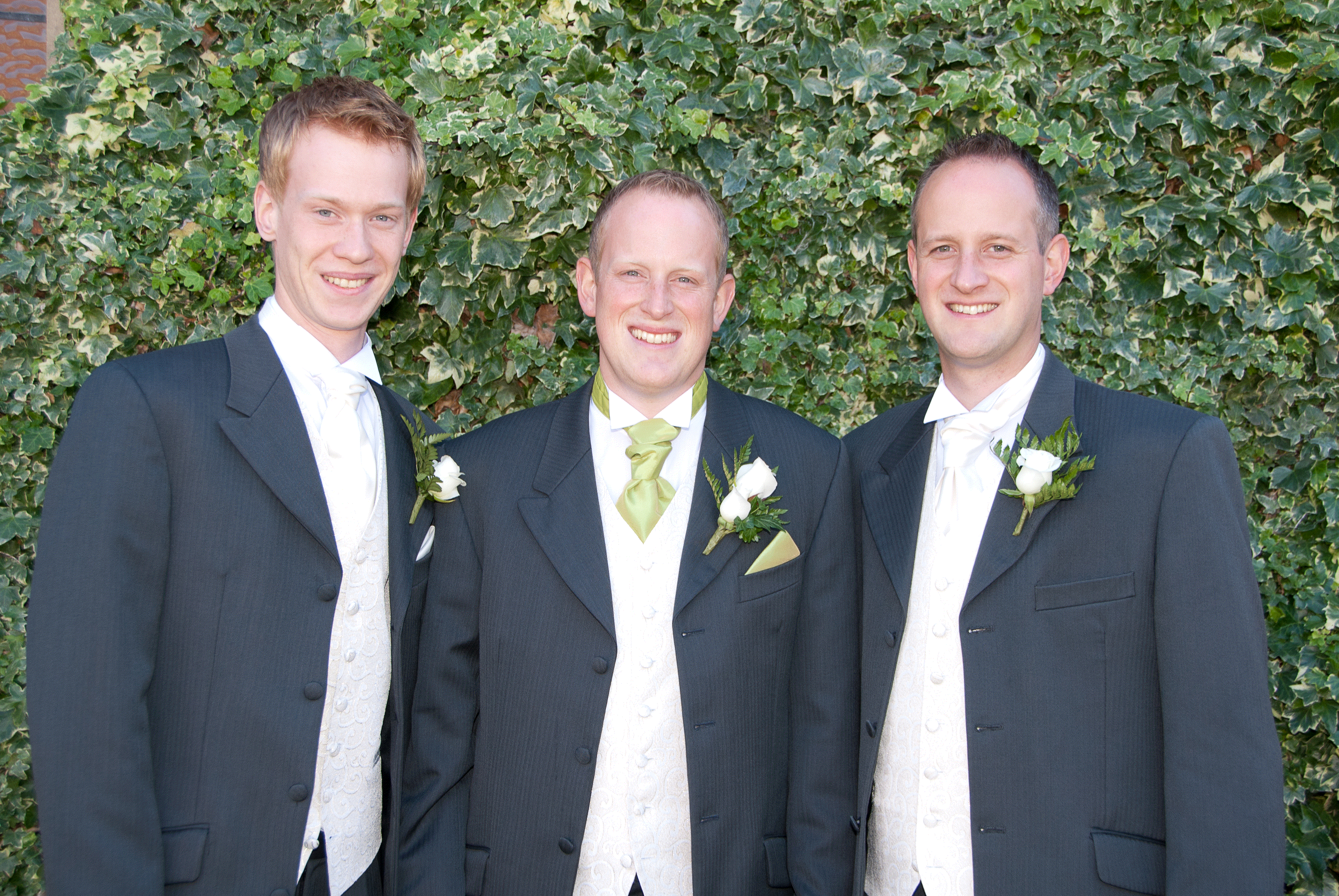
Bryan, Oliver,
Phillip

Jürgen Peter Clouth

Max Clouth
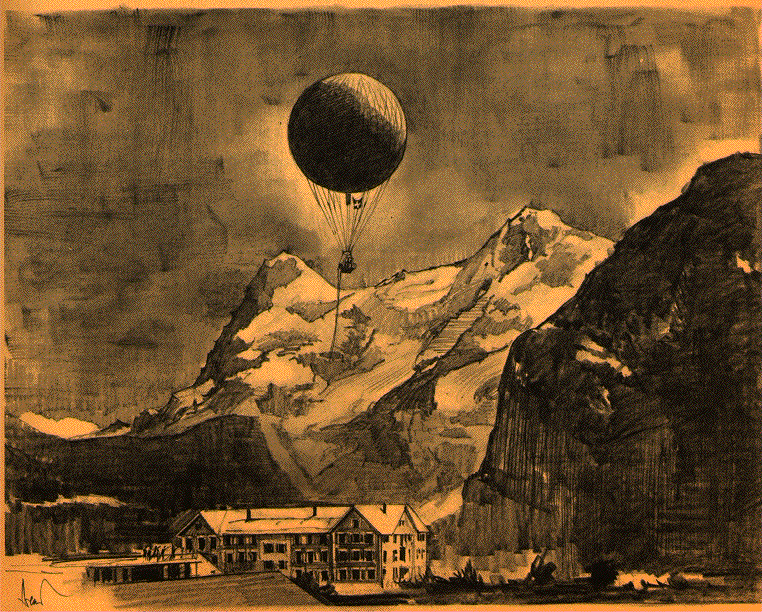
Ballon Sirius
Alpenquerung

Bakelite
Verteilerfinger
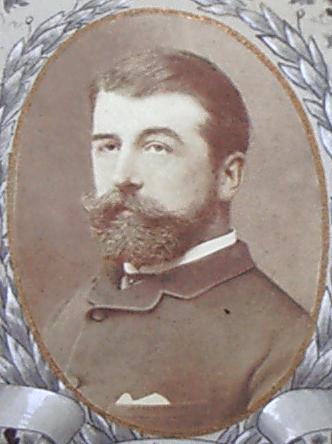
Franz Clouth

Eugen Clouth
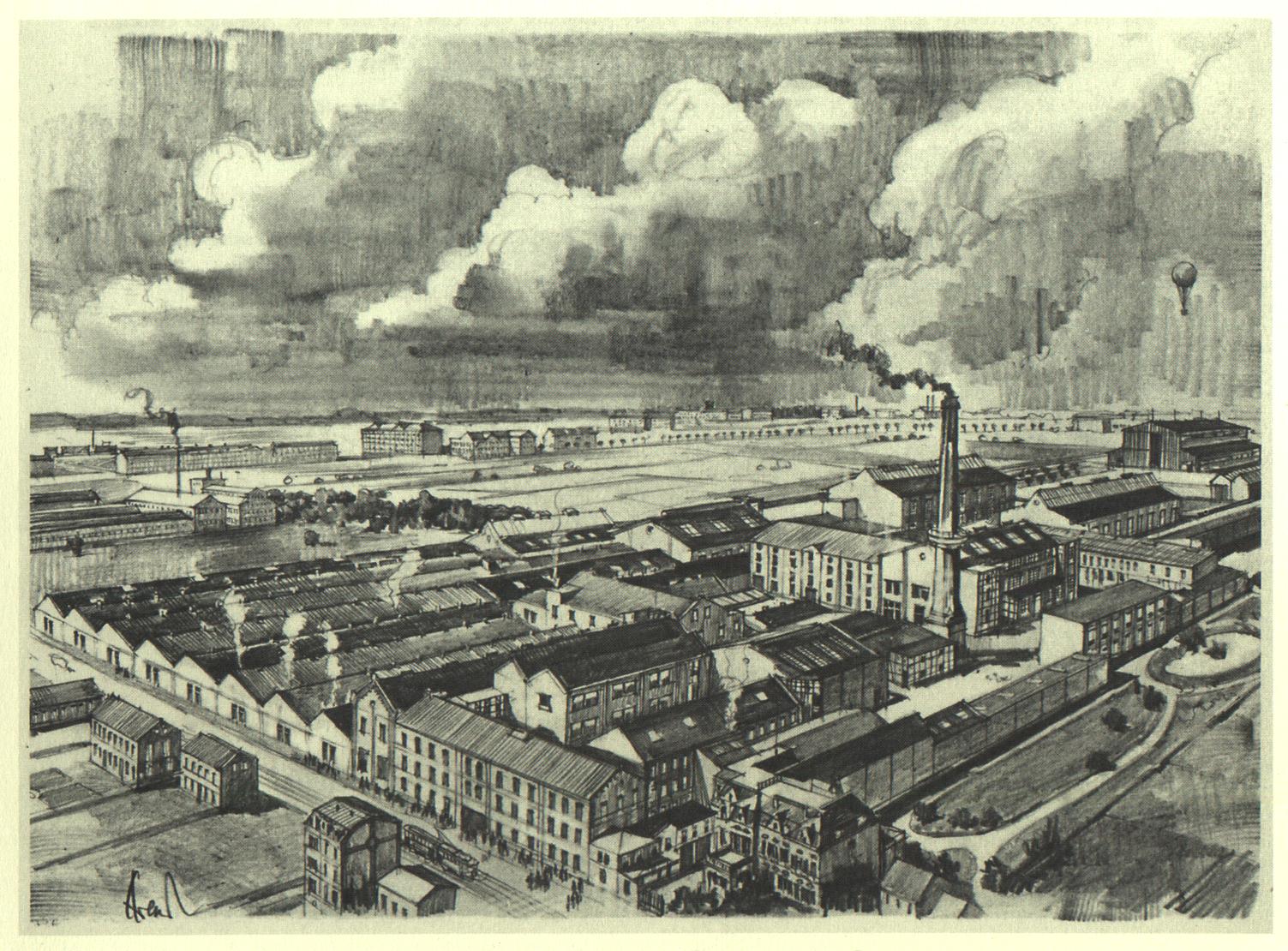
Clouth Werk
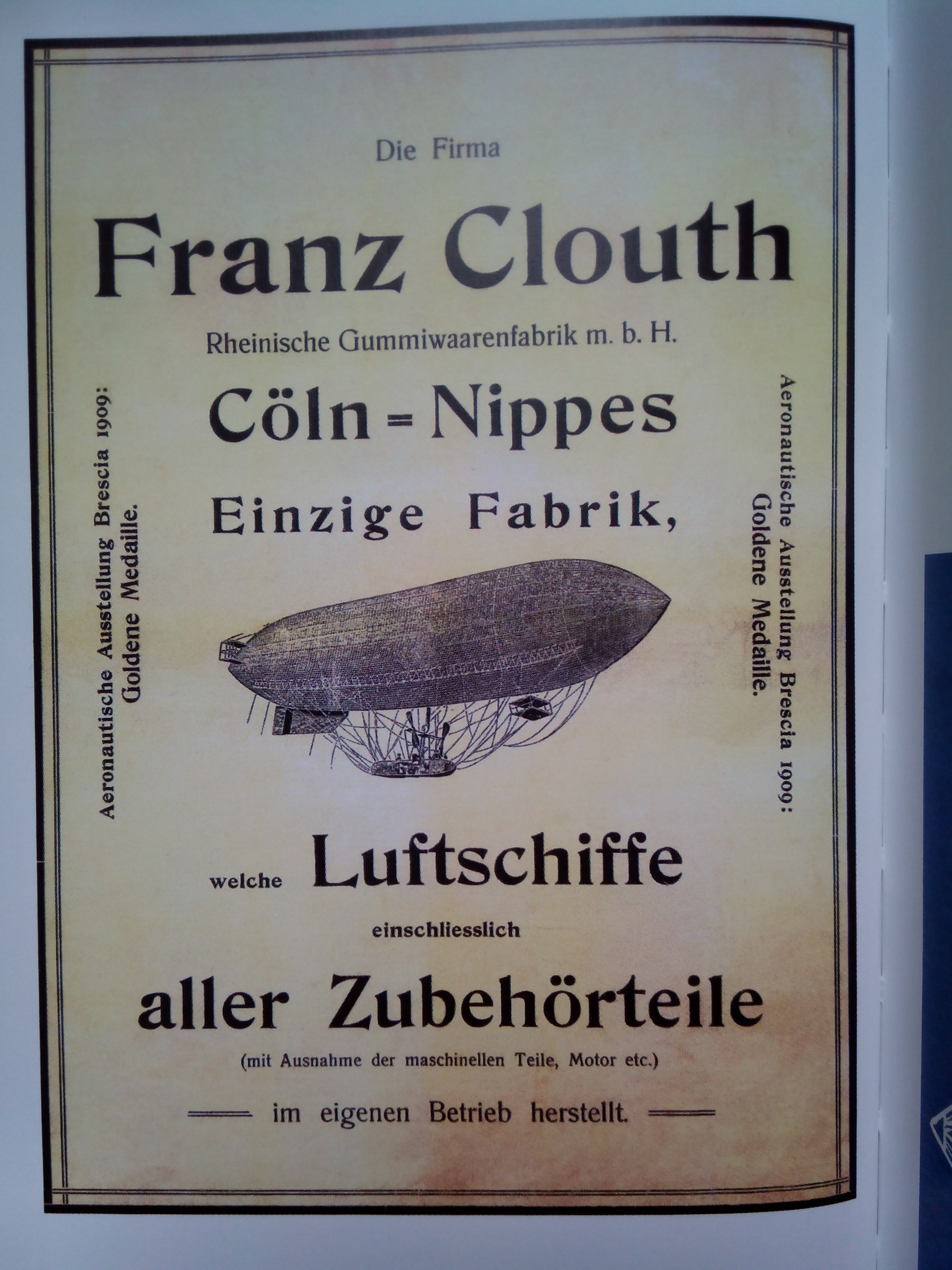
Clouth Werbung
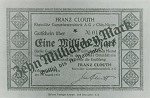
Clouth Notgeld

Clouth Werk

Alt-Autoreifen

Altfahrzeug

Daimler
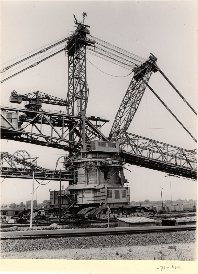
Förderbandkran
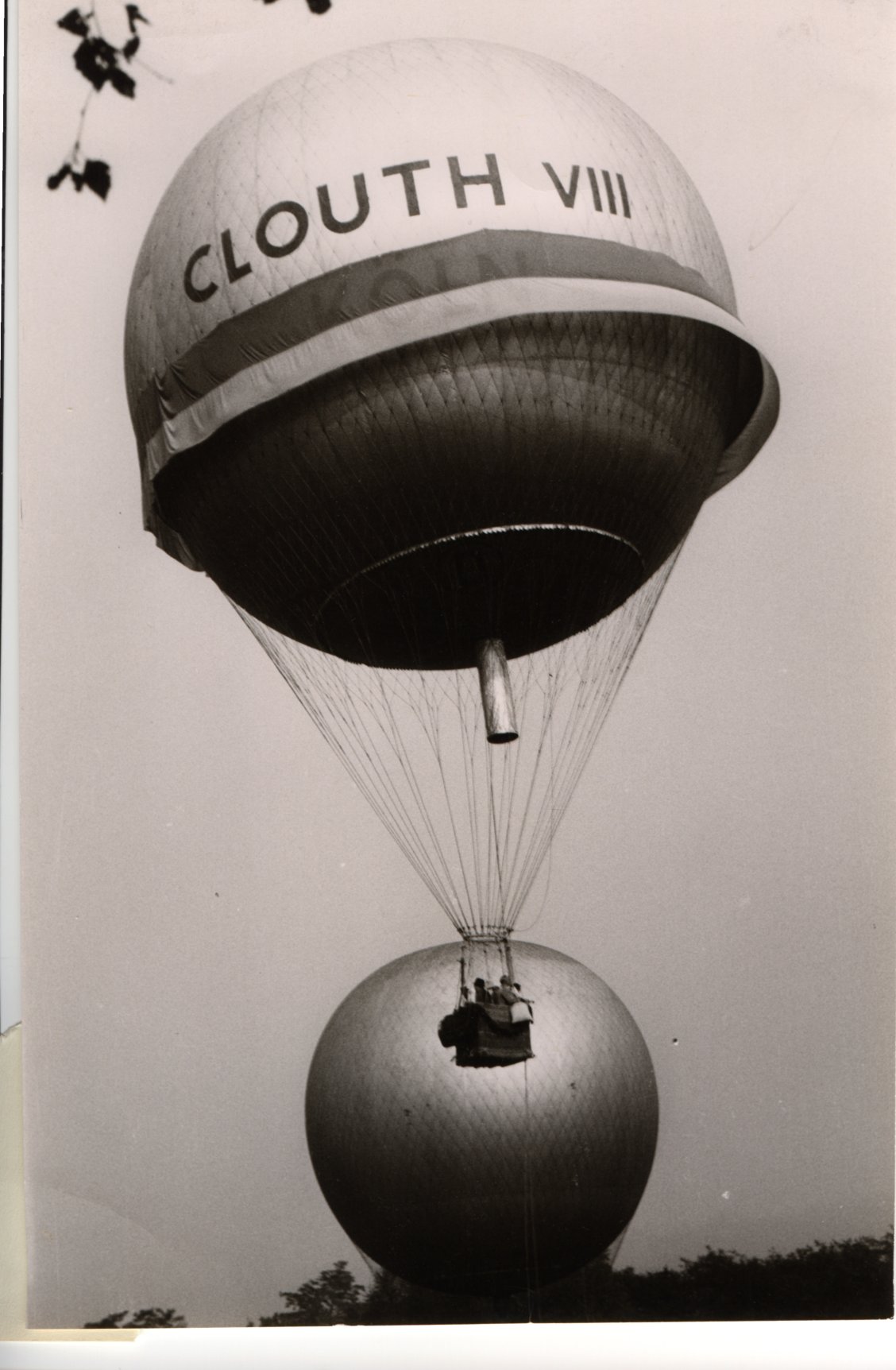
Clouth VIII Ballon

Wilhelm Clouth

Katharina Clouth

Caouchoc Golf Ball
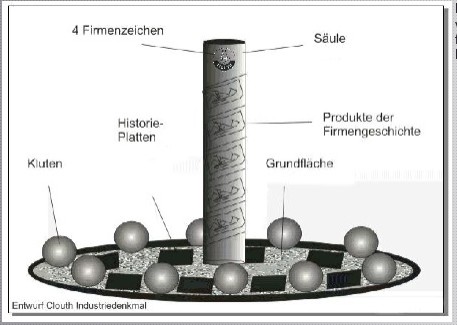
Skizze Clouth Denkmal
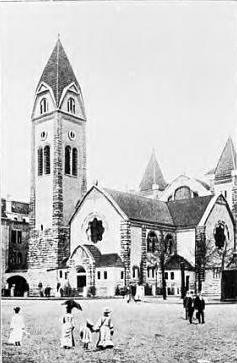
Altkatholische Kirche
Köln

Kabelaufroller
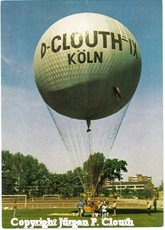
Clouth IX

Flugticket Clouth IX
.jpg)
Ballon Clouth IX über
Alpen
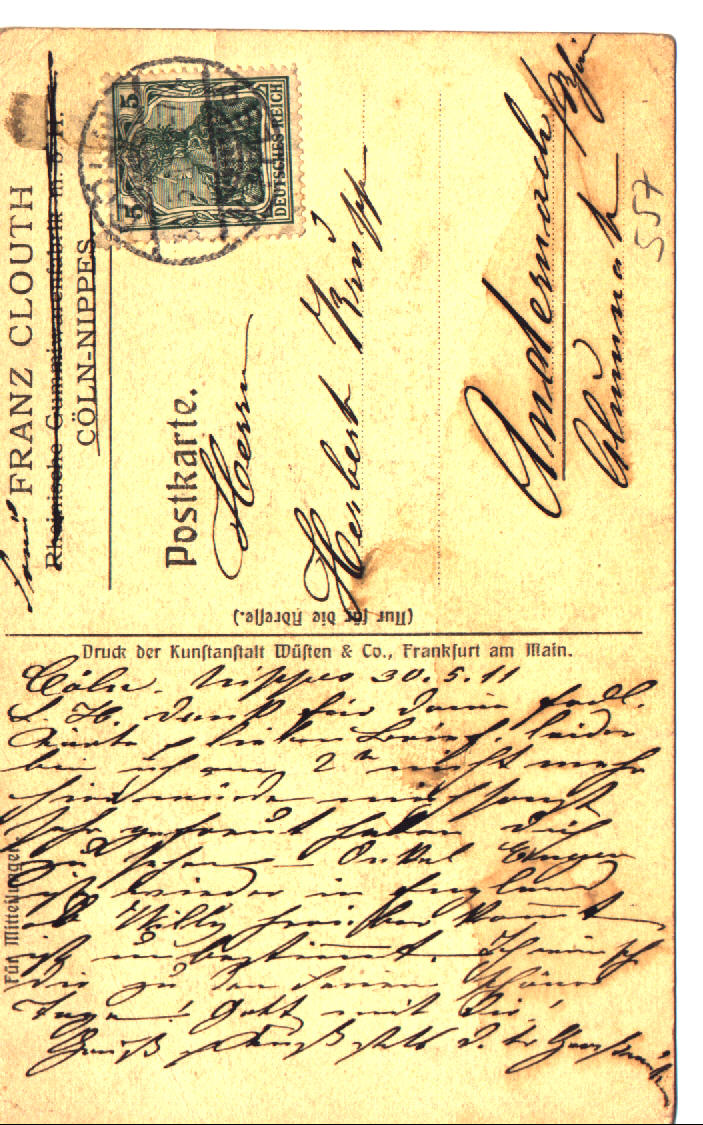
Post-Karte Franz Clouth
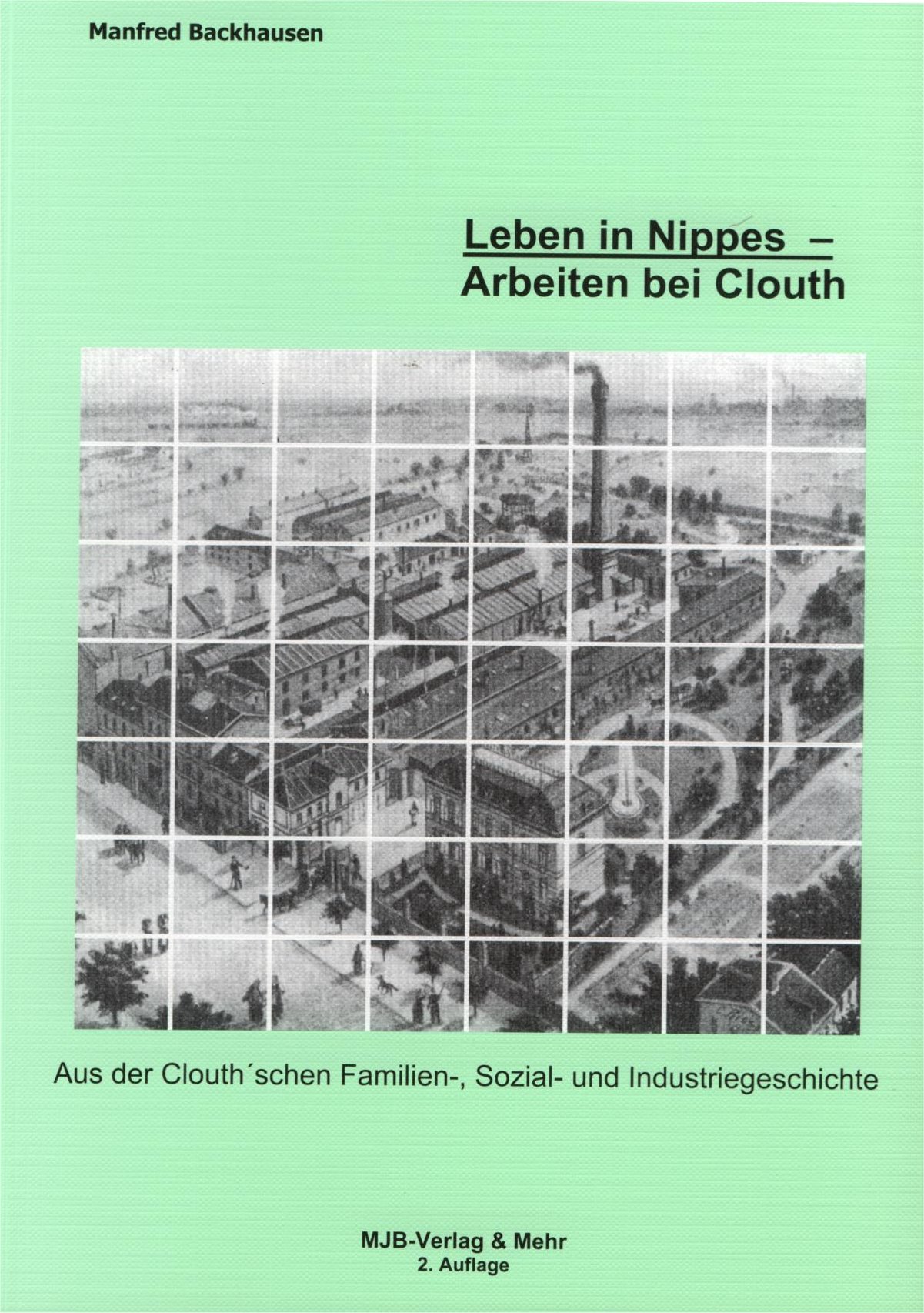
Clouth Buch 2.Ausgabe
.jpg)
Franz Clouth

Ballonkorb

Butzweilerhof Köln

Caouchoc Baum

Caouchoc Trocknung
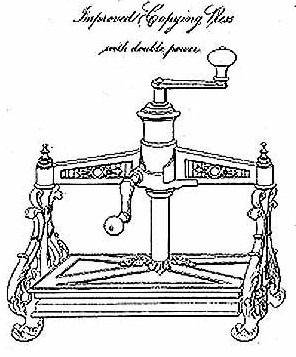
Kautschuk-Kopier System
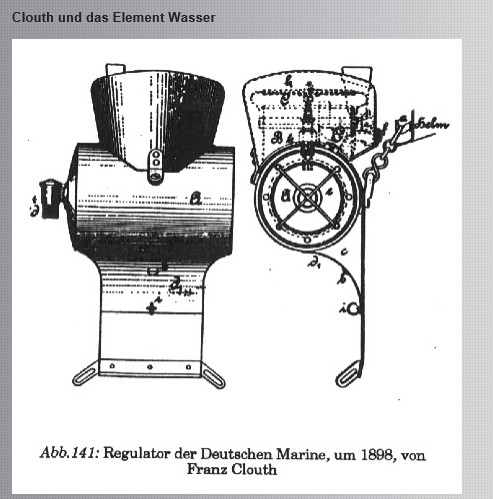
Wasser-Regulator
Clouth

Land & See Altes Logo

Land & See NEULogo
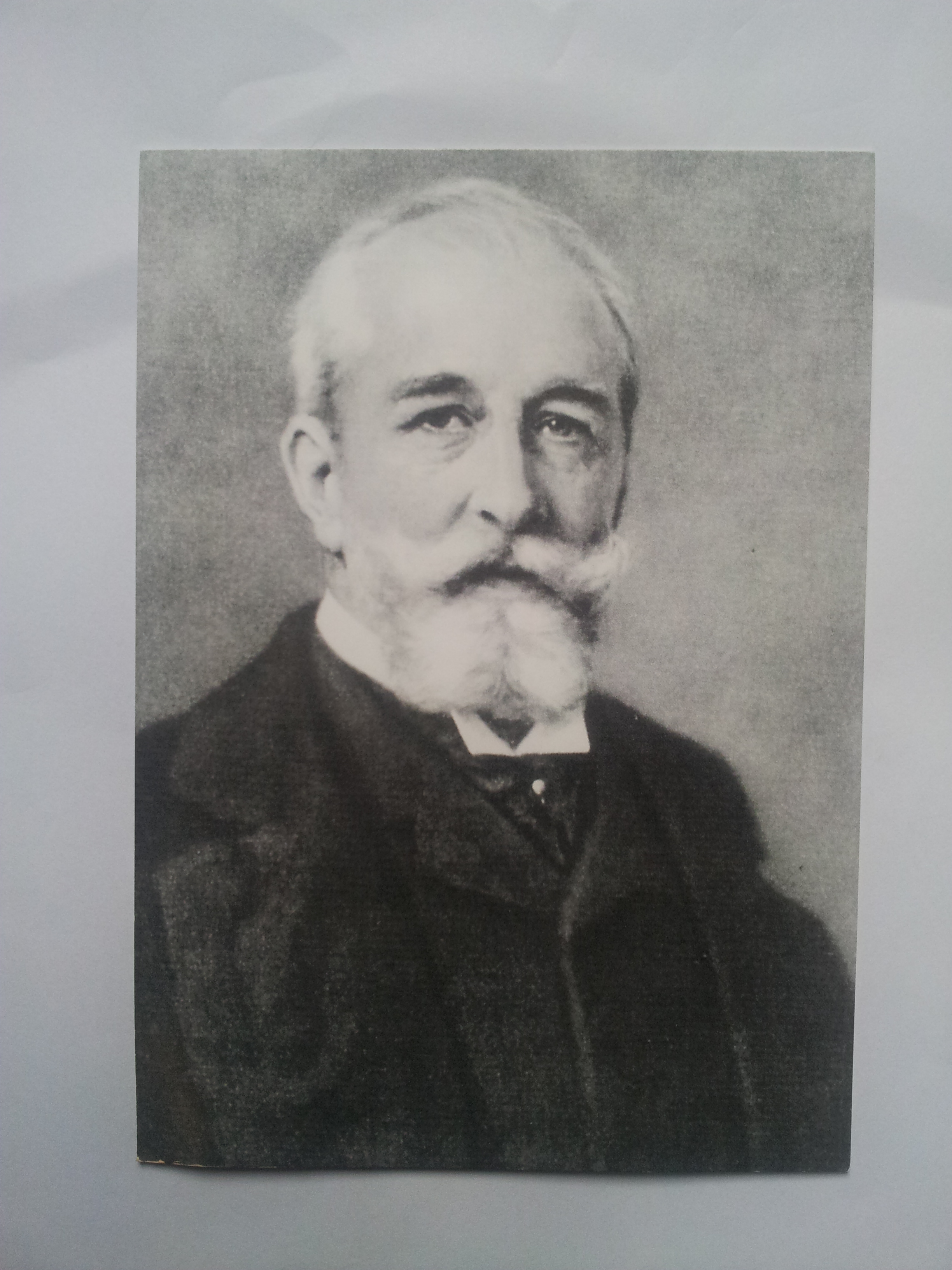
Franz Clouth

Richard Clouth
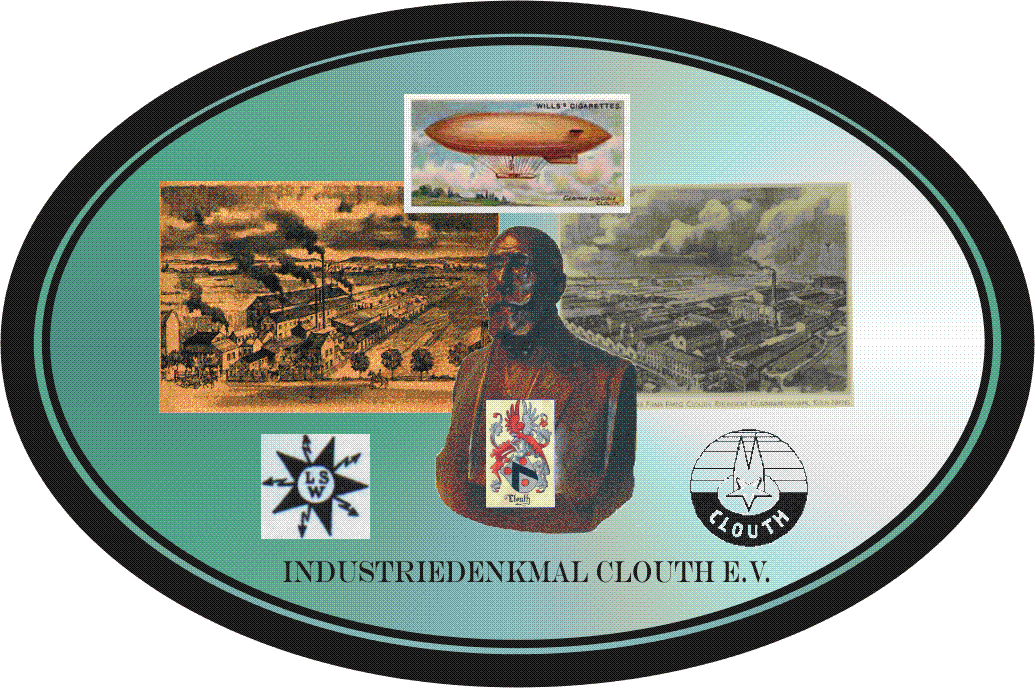
Industrieverein
Altlogo

Tauchergesellschaft
LOGO

Halle Förderband
Produktion

Firmentor 2

Bakelite Telefon

Podbielski
Kabellegeschiff
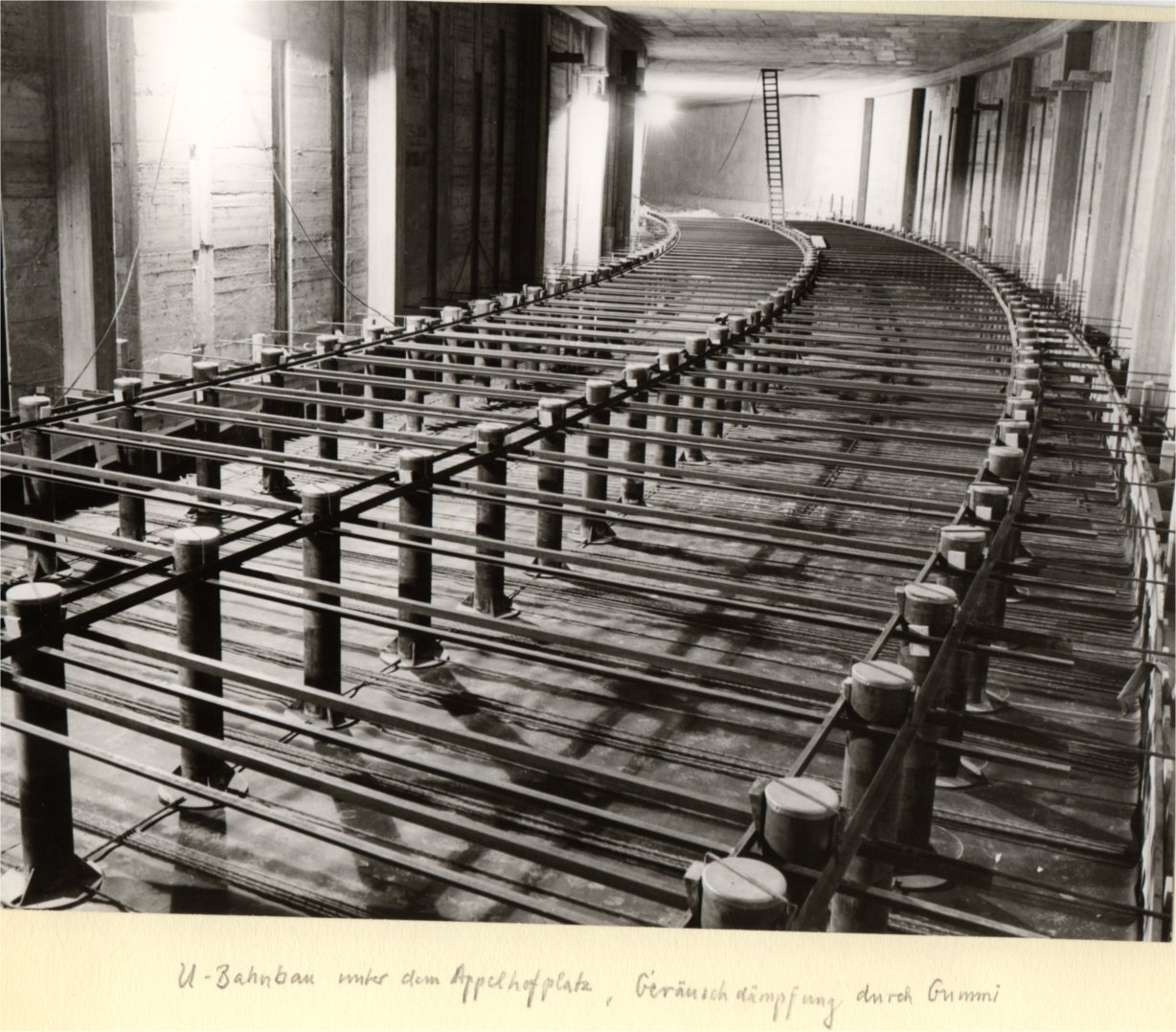
Kölner Ei
Geräuschdämmung
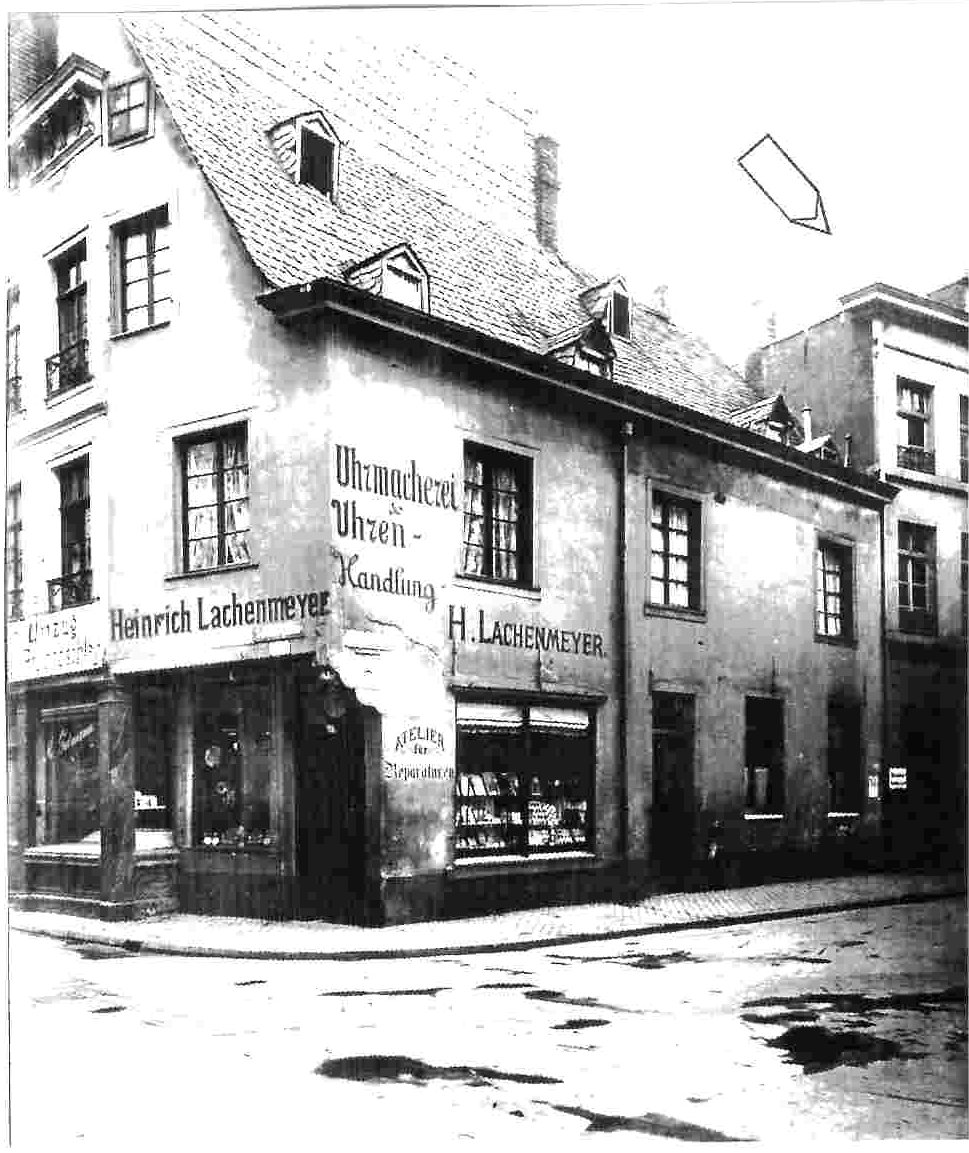
Druckerei Wilhelm
Clouth

Max Clouth ca.1950
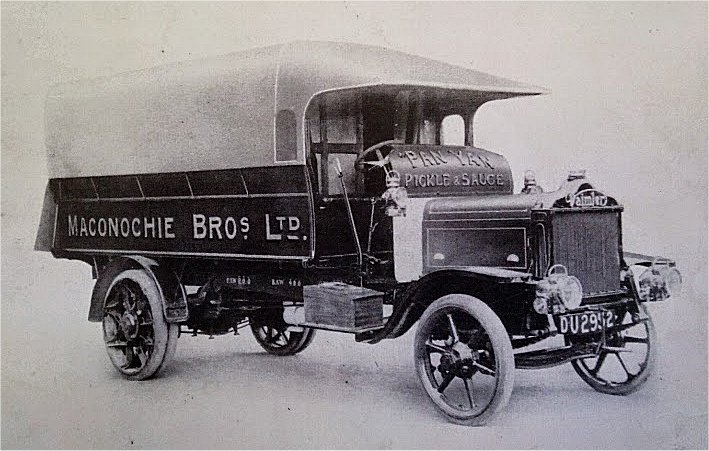
engl. Laster Daimler
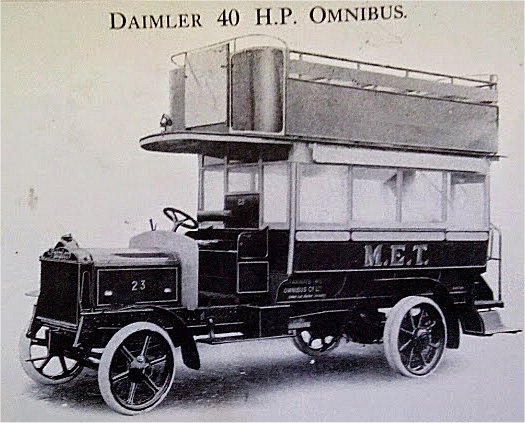
Daimler Bus

Ebonit-Telefon

Dampfmaschinen
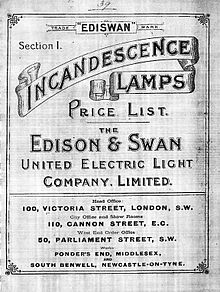
Lampenfortschritt

Bekelit-Radio

KNG Senatspräsident
J.Clouth

Juliane Heine/Hardware

Pfarrer W. Kestermann

Alt-Katholische Kirche
Köln
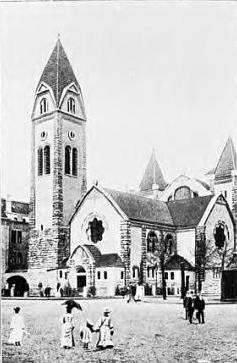
Alte Alt-Kath. Kirche
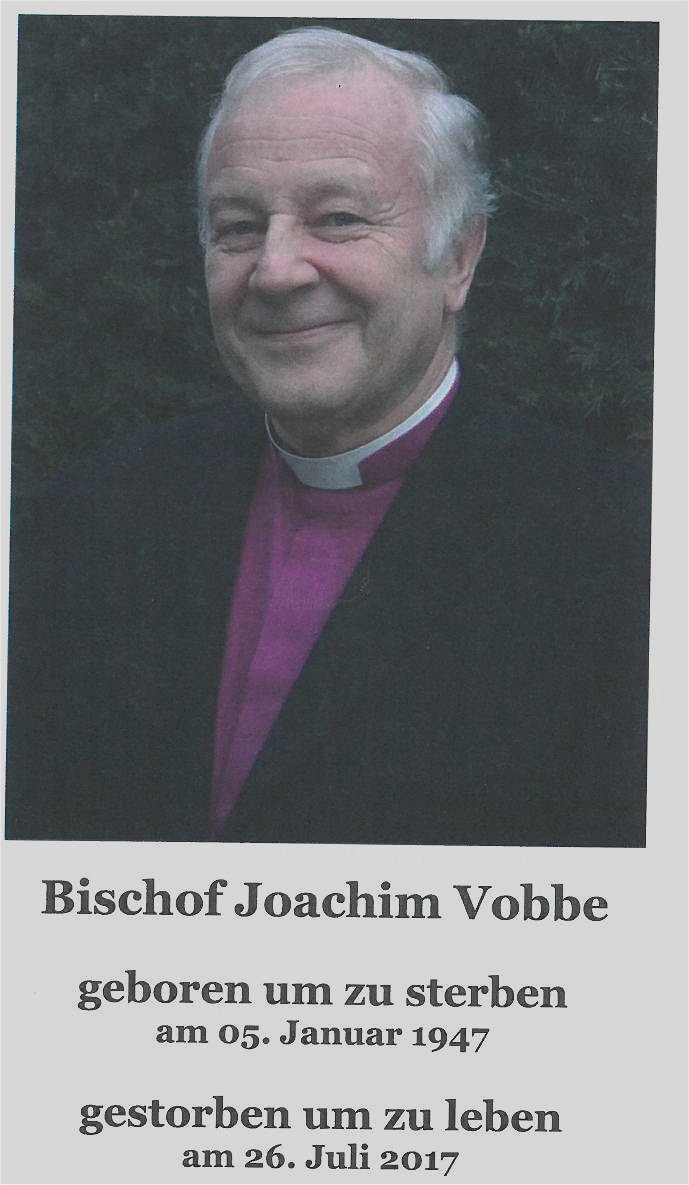
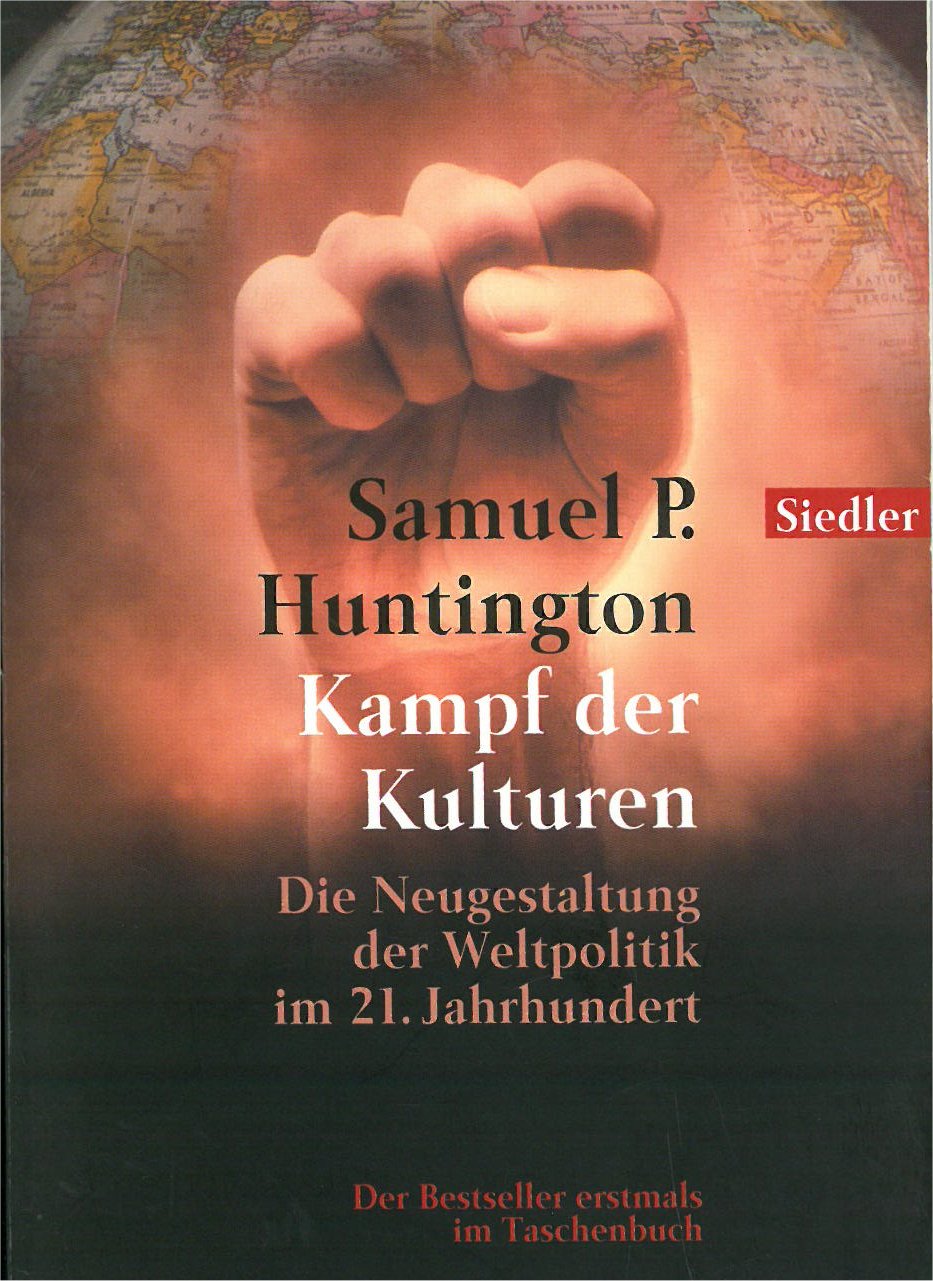
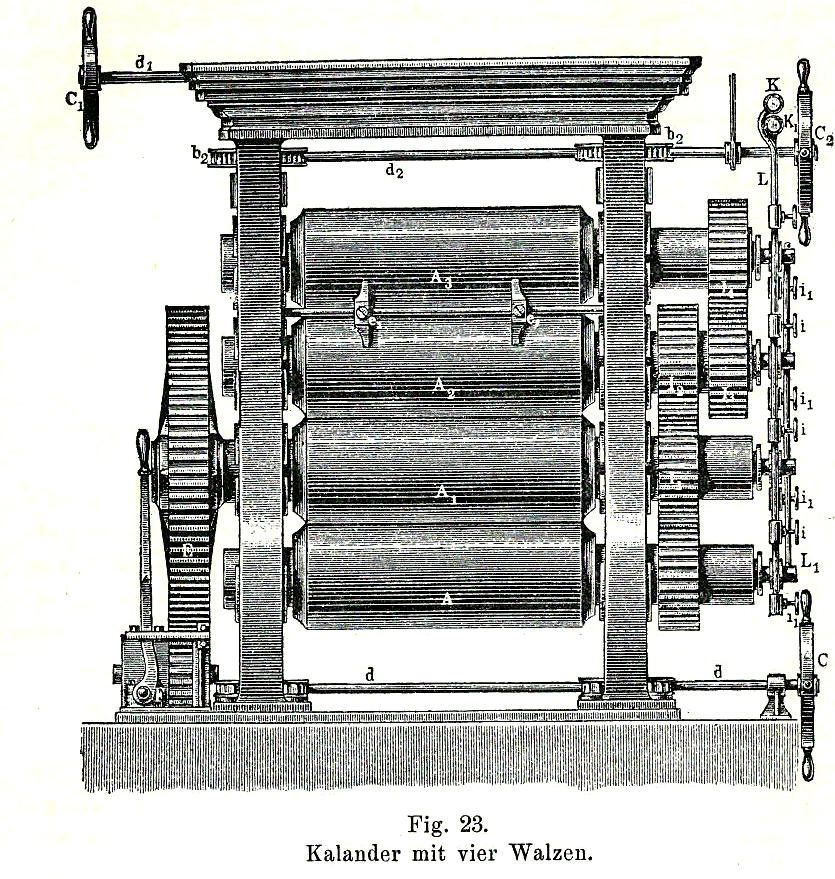
Walzwerk für Gummi
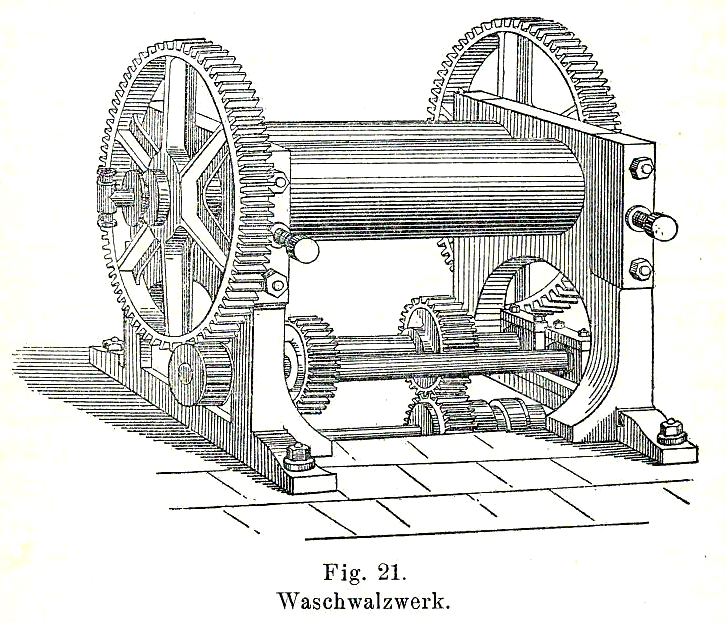
Walzwerk 2

Guttapercha
Pflanze
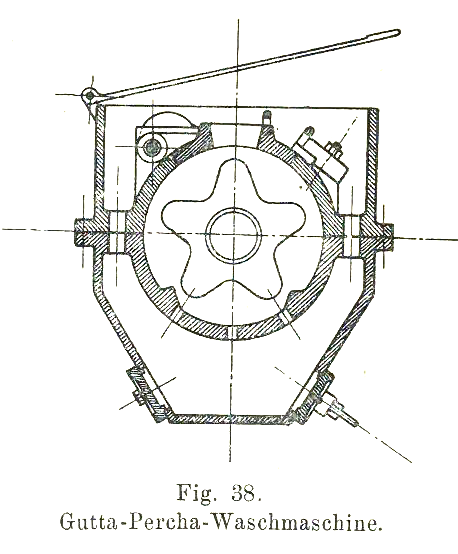
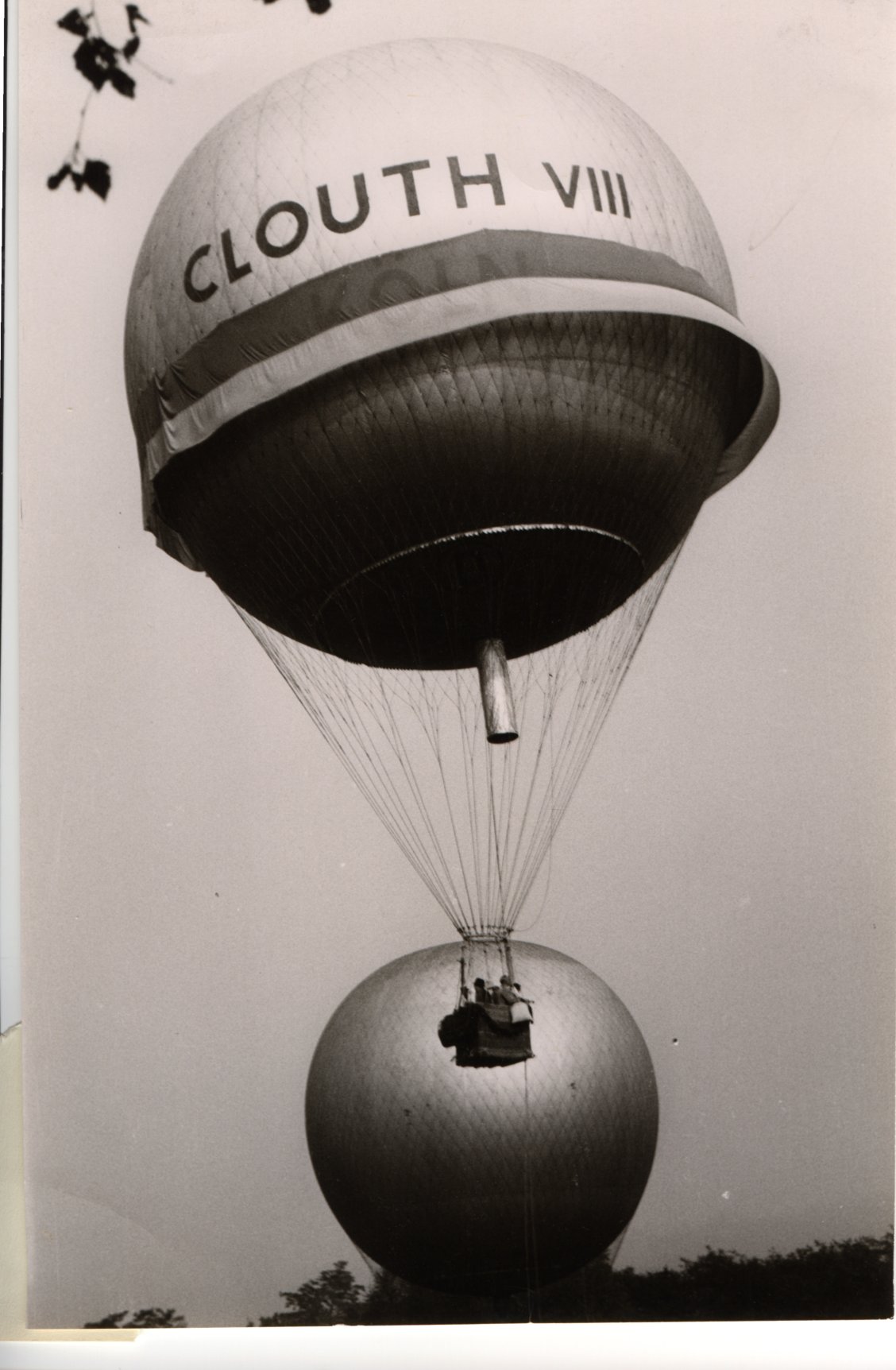
Tauffahrt Clouth VIII

Katharina Clouth
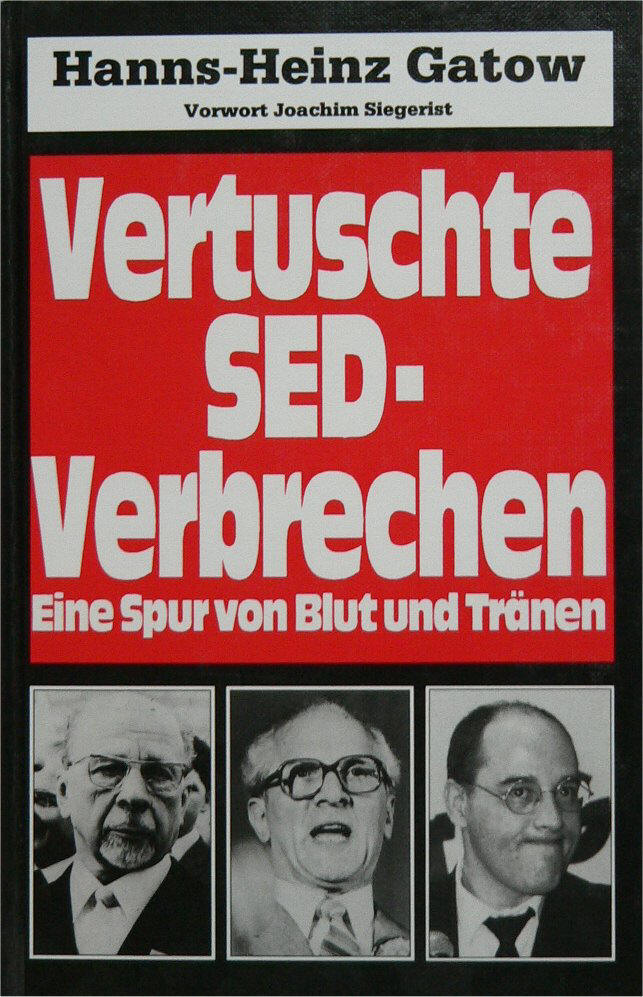
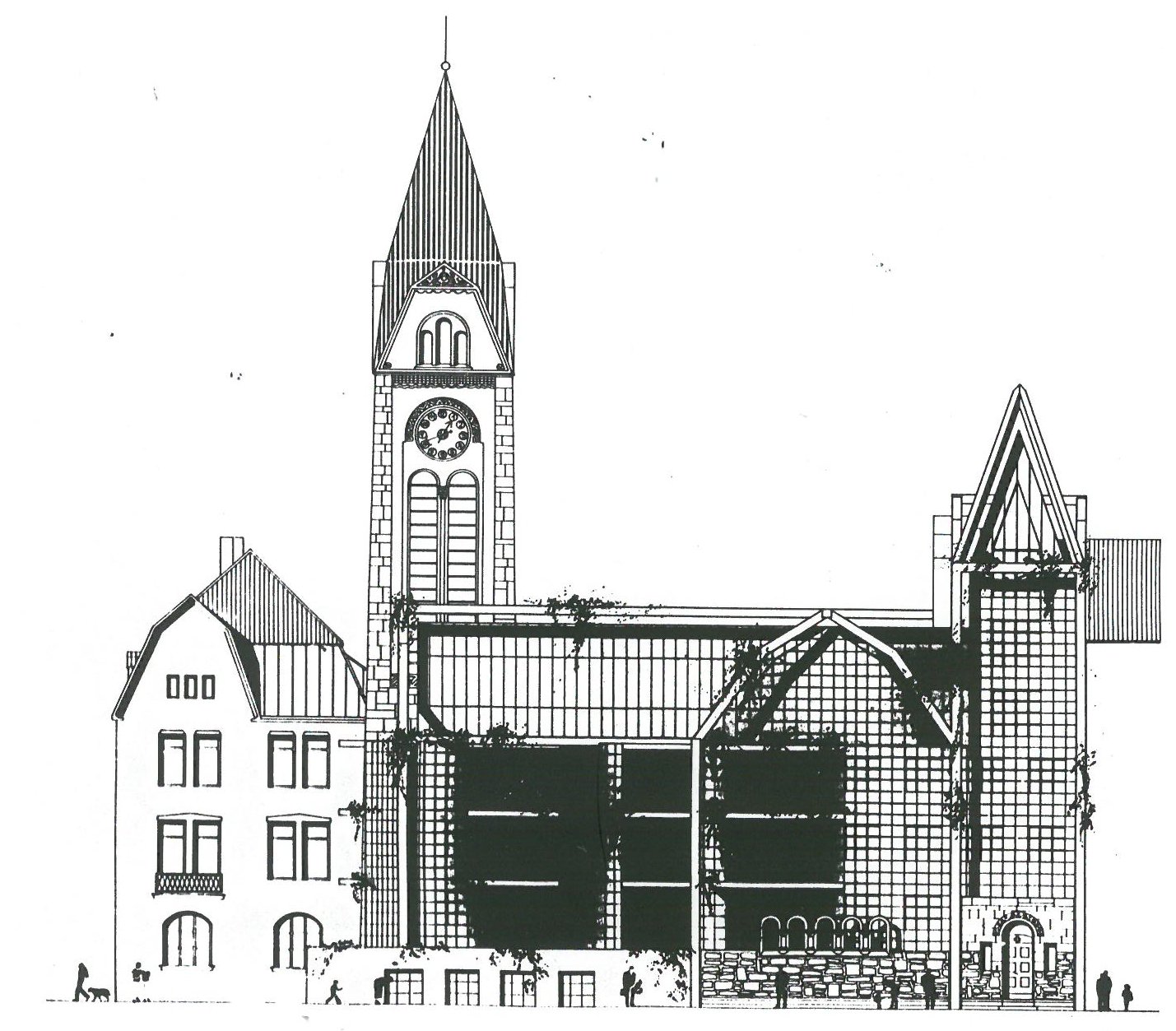
Alt-Katholische Kirche
Köln
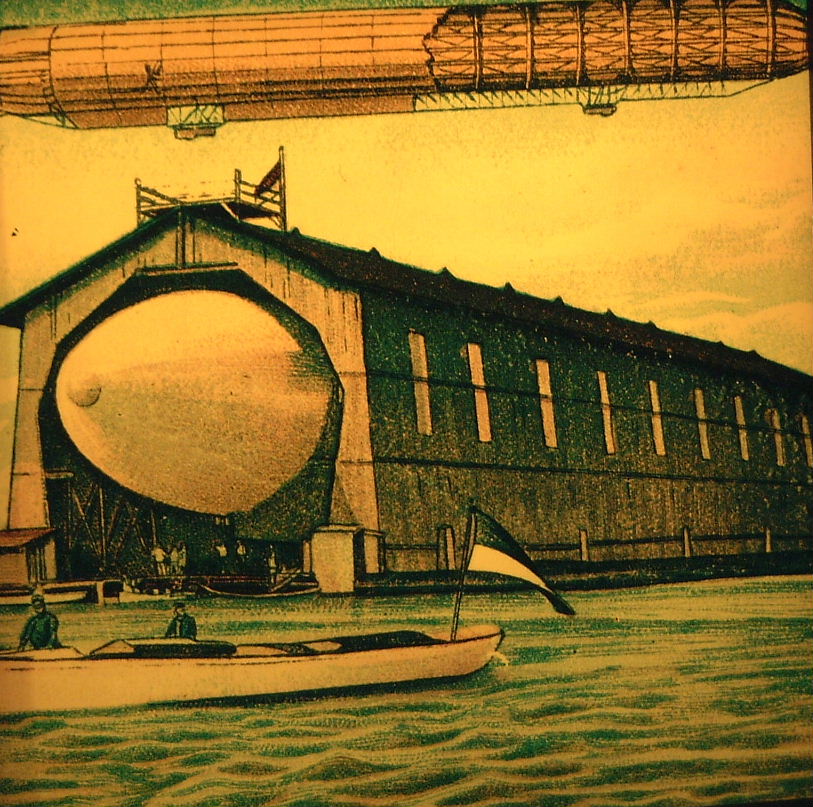
Ballonhalle

Flugobjekt-Wandel ab
1910

Charles Goodyear

Rubber Sheets
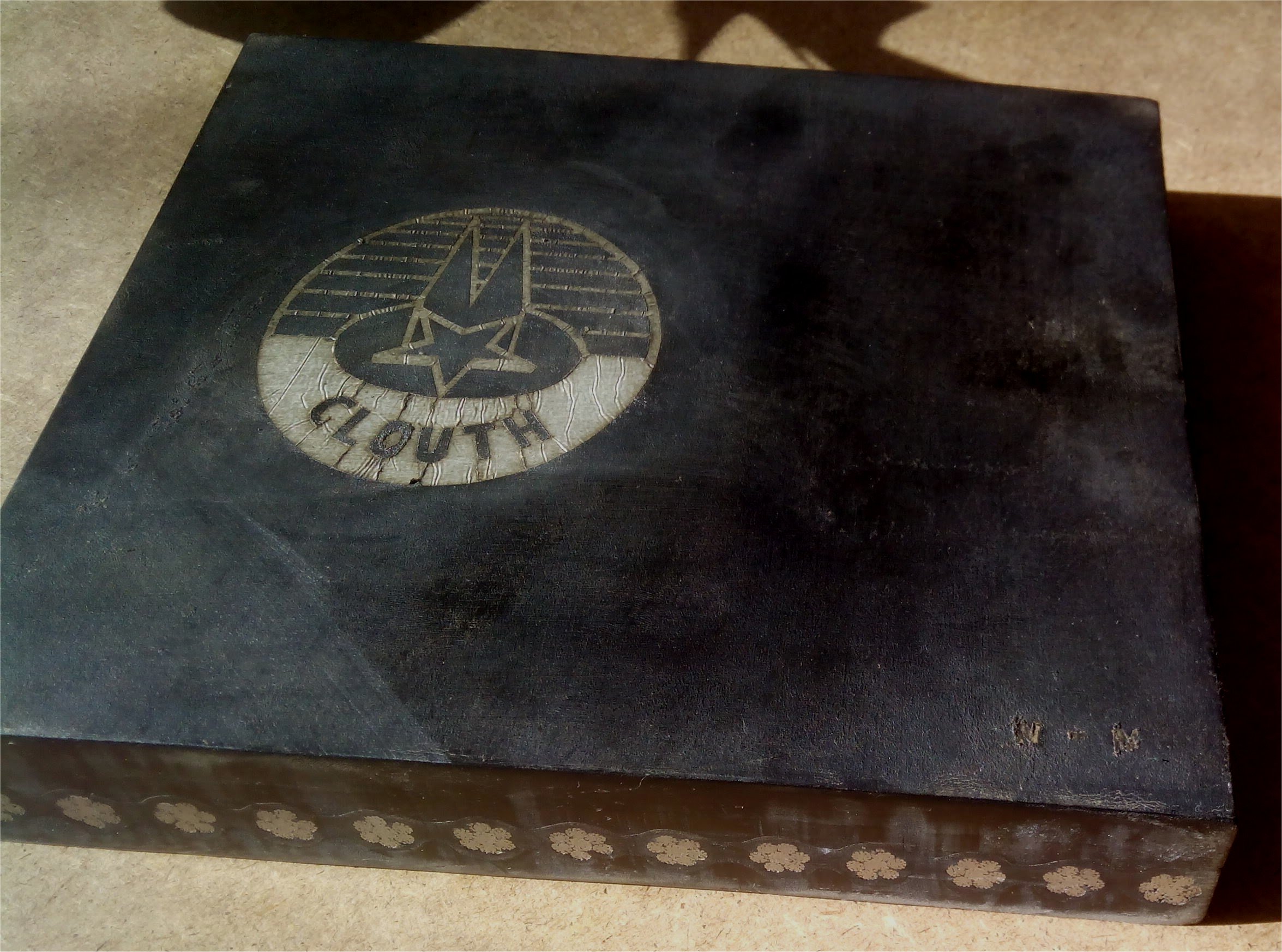
Clouth Förderband

Clouth Pentagon 1899

Audrey Clouth 2017

Rohkautschuk
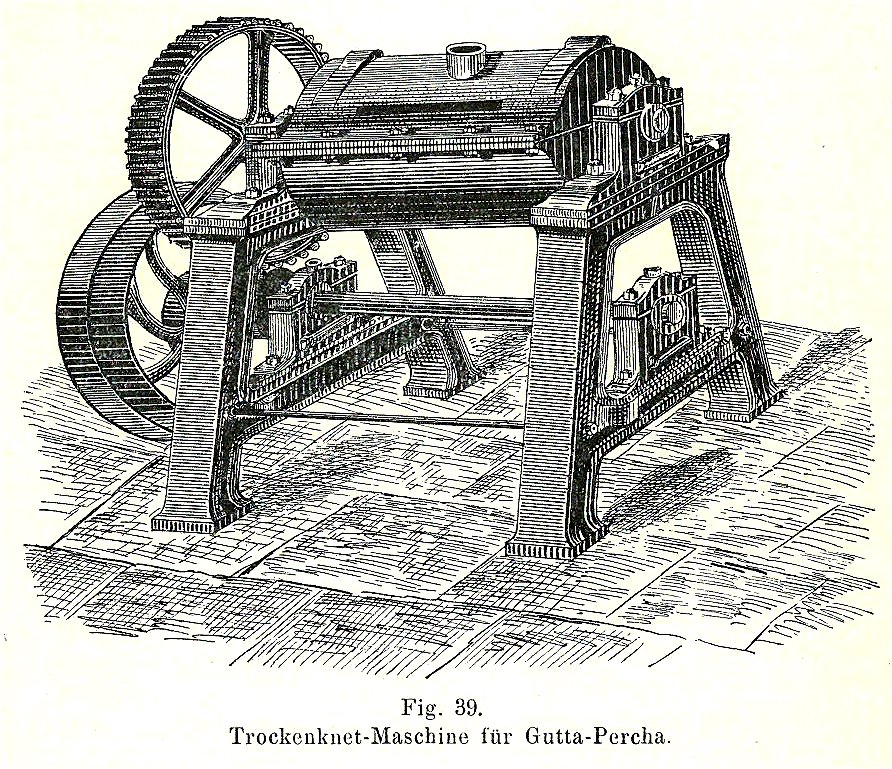
Guttapercha Wäscher
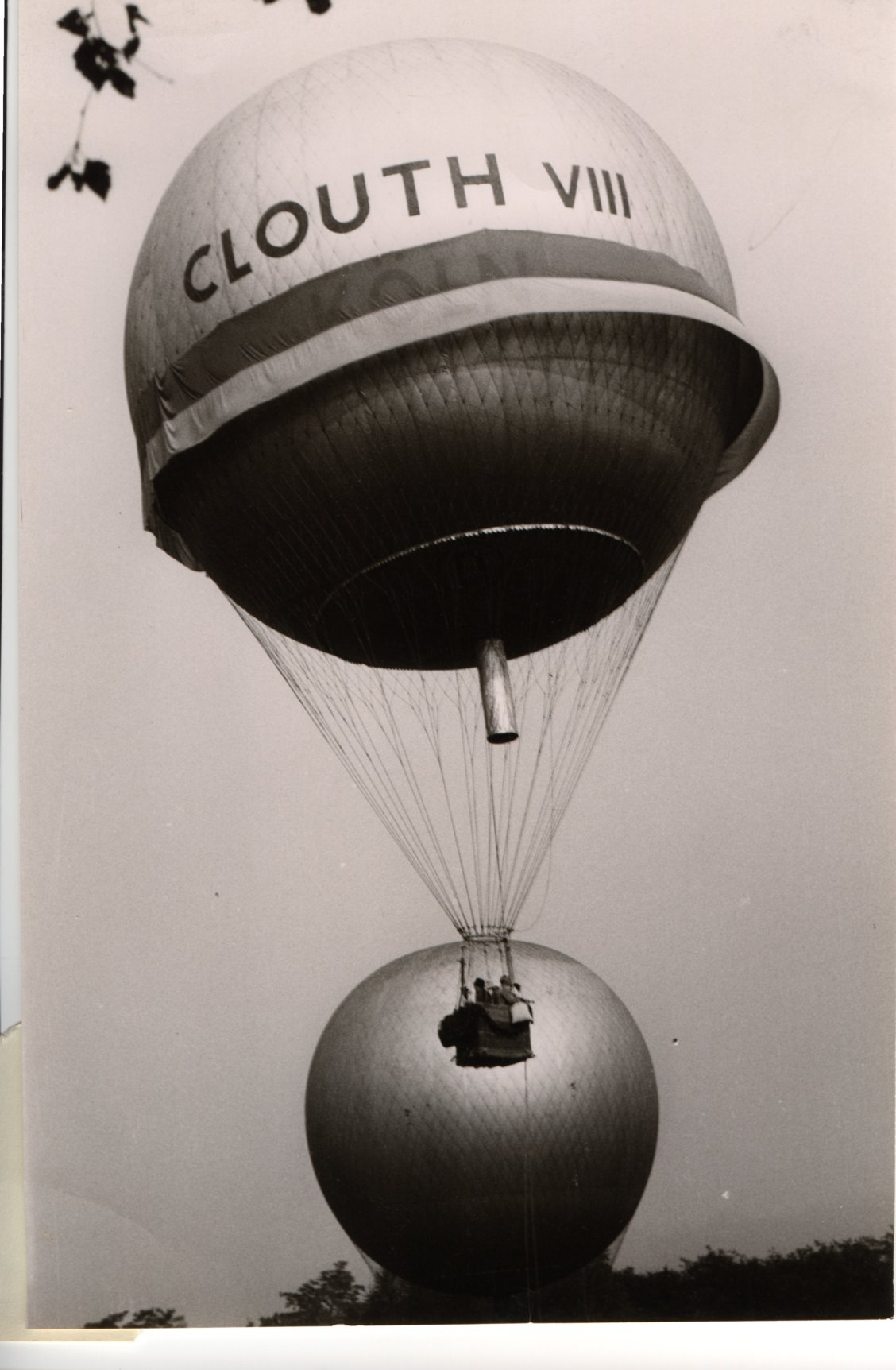
Ballon Clouth VIII

Anni Heine-Clouth
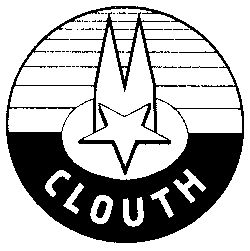
LOGO Sternengasse

J.P. Clouth

Josefine Clouth

Ella Clouth

Altkatholische Kirche
Köln

Köln

Cölner Dom
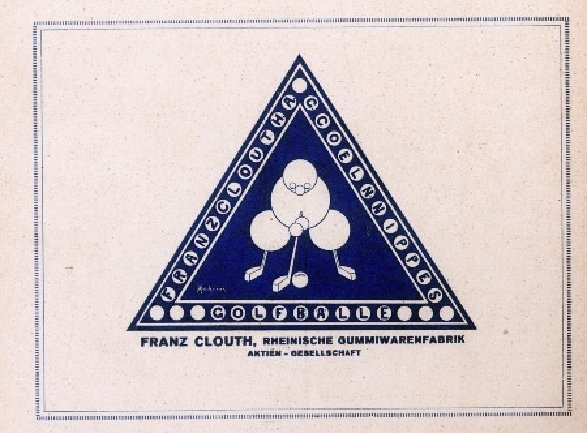
Golfballwerbung

Clouth Tauchhelm

Clouth Taucheranzug
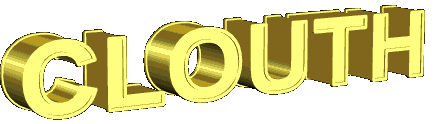
| |
Luftschiff-Fahrt

Luftschiff History
"CLOUTH I. 1909"/1910
nach John
Duggan und Gisela Woodward
überarbeitet von Rechtsanwlt Jürgen P. Clouth
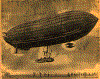
 
Lenkbares Luftschiff Clouth
Anfänge der Luftfahrtausstellung
Alter Kram?
Mitnichten, wie Zukunftsvorschläge zeigen
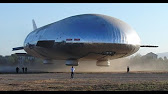
- Historie
speziell
-
Historie allgemein
-
Die Luftahrtgeschichte von Köln und der
Region, Teil 1
Lit.-Angabe:
Krause, Thorsten: Die Luftahrtgeschichte von Köln und der Region, Teil 1. Die
Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis 1912. Mit einem Geleitwort
von Dr. Edgar Meyer, Präsident der Stiftung Butzweiler Hof Köln. In: Pulheimer
Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde 2002, Bd. 26, S. 199-231.
- vom starren Luftschiff" Z1" Graf
Zeppelins zum lenkbaren Luftschiff "CLOUTH"
- Verbindungen zu Graf Zeppelin
- Aus Verdienst am Land, geplante Wappenverleihung durch
Kaiser ? kein Adligenprädikat wie "von" Clouth
- Luftschiff und Ballongeschichte
im 1. Weltkrieg
- Luftschiff-Fahrt der Moderne 2017
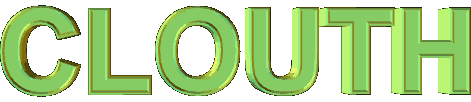
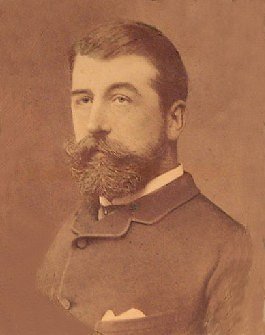
Der junge Franz
Clouth 1862

Clouth Kölner Familien-Wappen, eingetragen
1923, veranlaßt durch Sohn Max Clouth
Zur Wende ins
20. Jahrhundert begann die Luftfahrt mit erfolgreichen Konstruktionen ernsthaft
zu werden. Die Ballonfahrt hatte durch wissenschaftliche Aufstiege in große
Höhen die Grundlagen für die Aviatik geschaffen. Im Ballon erforschte man die
Einflüsse der Atmosphäre auf den Menschen. Das Studium der Höhen-,
Sauerstoff- und Luftdruckverhältnisse führte zur Entwicklung von Flugmessgeräten,
die zuerst der aufkommenden Luftschifffahrt und später ab 1910 den Fliegern
dienten. Freiballone, Luftschiffe und Flugzeuge prägten die Luftfahrtgeschichte
von Köln. Der Butzweilerhof strahlte in technischer, wirtschaftlicher und
kultureller Hinsicht beispielhaft für die allgemeine Luftfahrtentwicklung nach
Köln und der Region aus. Die Architektur der nicht mehr existierenden
Luftschiffhalle und frühen Pflegeeinrichtungen von 1909-1918 war bemerkenswert.
Der Erweiterungsbau von 1936 im Stil der neuen Sachlichkeit und versehen mit
deutlichen Merkmalen der Bauhausarchitektur spiegelt ein Stück Technik- aber auch
Kulturgeschichte der Region wider. Das gesamte Gebäude-Ensemble steht heute
unter Denkmalschutz
(Thorsten Krause, die Luftfahrtgeschichte von Köln und der Region, Teil 1)
Luftschiffahrt Cöln
1909
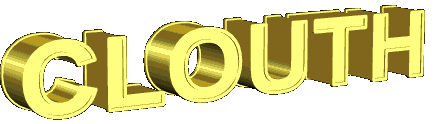
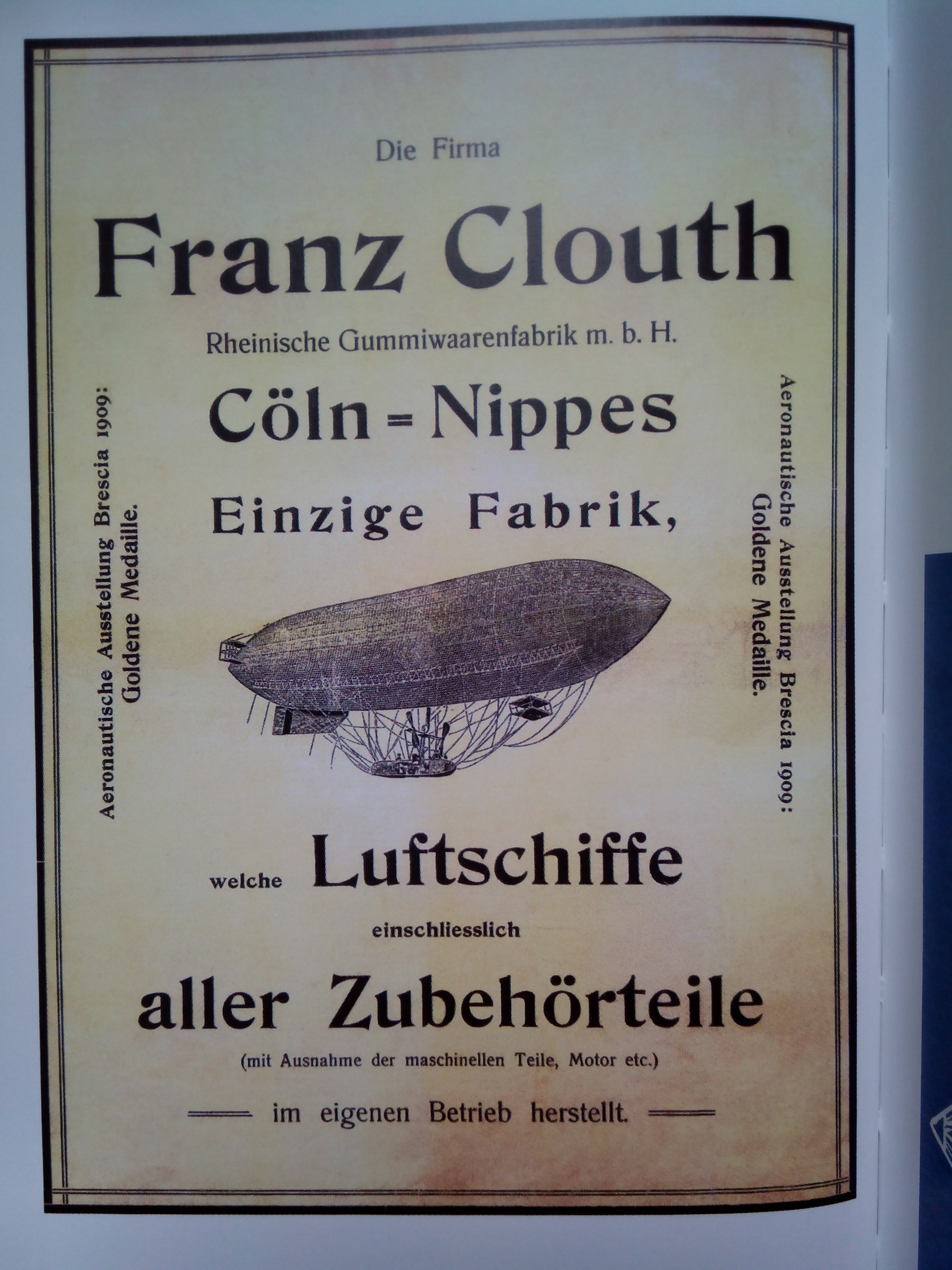
um 1909
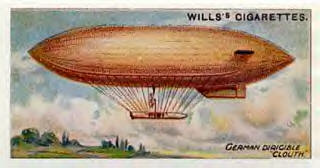
Die Tabakfabrikation Wills in England gab
im Rahmen von Zigarettenpacks Themenbilder an die Käufer und mit Abschluß z.B.
der Zeppelinaktion oder Polizeiautos, Feuerwehren ein vorgegebenes Album, in
welches die Sammelbilder eingeklebt werden konnten. Diese Albumwerbung zeigte
sich als sehr erfolgreich nicht nur bei reinen Sammlern, vielmehr z.B. auch in
der breiten Raucherbevölkerung
-
vom starren Luftschiff Z1 zum lenkbaren
Luftschiff "CLOUTH" u.a
-
-
-
 Deutsches Luftschifffahrt-Museum
Deutsches Luftschifffahrt-Museum
-
 Butzweilerhof Video
Butzweilerhof Video
Die
Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Cöln bis 1912
(english Video)
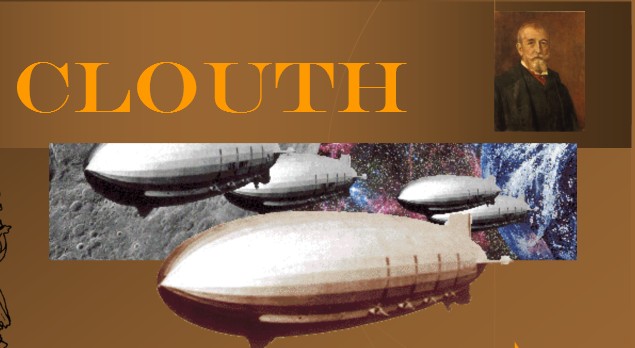
I.
Einleitung
 In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat
finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“[1] In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat
finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“[1]
Die Geschichte der
frühen deutschen Ballonfahrt weist gegenüber dem klassischen Land der
Ballonfahrt Frankreich, wo aerostatische Unternehmungen und Experimente meist
den Höhepunkt von Feierlichkeiten, Gebäudeeinweihungen, Brückeneröffnungen und
Ausstellungen darstellen, nur wenige repräsentative Ereignisse auf. Gleichwohl sind für
das Jahr 1783 bereits Versuche mit unbemannten Ballonen in deutschen Städten
überliefert, so z. B. am 23. Dezember in Darmstadt und am 27. Dezember in
Berlin. Es handelt sich dabei allerdings vermutlich eher um Schauvorstellungen
als um ernsthafte aerostatische Experimente, wie sie z. B. der
Benediktinerpater Ulrich Schiegg mit seinem Heißluftballon in Ottobeuren/Bayern
am 9. und 22. Januar 1784 durchführt.[2]
 Erst am 3. Oktober
1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in
Deutschland.[3] Der Franzose Jean-Pierre Blanchard
leitet damit eine Reihe von Ballonvorführungen auf deutschem Boden ein und
macht damit die Ballonfahrt auch im Deutschen Reich allgemein bekannt.[4] Erst am 3. Oktober
1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in
Deutschland.[3] Der Franzose Jean-Pierre Blanchard
leitet damit eine Reihe von Ballonvorführungen auf deutschem Boden ein und
macht damit die Ballonfahrt auch im Deutschen Reich allgemein bekannt.[4]
 Im folgenden
wird die Geschichte der Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis
1912 skizziert. Ausgehend vom Ende des 18. Jhs. schließt dieser chronologische
Abriß mit der Gründung der militärischen Fliegerstation „Butzweilerhof“ im
Jahre 1912 ab. Der Fokus der Schilderung liegt auf den Luftfahrzeugen „Leichter
als Luft“ und den damit verbundenen Ereignissen innerhalb der Domstadt.
Speziell der Freiballon ist bis zu Beginn des 20. Jhs. das einzige Luftfahrzeug
von Bedeutung; Luftschiffe oder Flugzeuge – später dominierend – sind noch
nicht ganz ausgereift, denn noch fehlt diesen Luftfahrzeugen ein geeigneter
Antrieb. Der Beginn der Motorfliegerei in Köln mit den Luftfahrzeugen „Schwerer
als Luft“ wird im Kontext dieser Betrachtung weitestgehend ausgenommen. Jenes
Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte bedarf einer separaten Darstellung, denn es
ist ebenso vielschichtig wie ereignisreich und von Flugpionieren geprägt, wie
dieses, welches hier geschildert werden soll. Im folgenden
wird die Geschichte der Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis
1912 skizziert. Ausgehend vom Ende des 18. Jhs. schließt dieser chronologische
Abriß mit der Gründung der militärischen Fliegerstation „Butzweilerhof“ im
Jahre 1912 ab. Der Fokus der Schilderung liegt auf den Luftfahrzeugen „Leichter
als Luft“ und den damit verbundenen Ereignissen innerhalb der Domstadt.
Speziell der Freiballon ist bis zu Beginn des 20. Jhs. das einzige Luftfahrzeug
von Bedeutung; Luftschiffe oder Flugzeuge – später dominierend – sind noch
nicht ganz ausgereift, denn noch fehlt diesen Luftfahrzeugen ein geeigneter
Antrieb. Der Beginn der Motorfliegerei in Köln mit den Luftfahrzeugen „Schwerer
als Luft“ wird im Kontext dieser Betrachtung weitestgehend ausgenommen. Jenes
Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte bedarf einer separaten Darstellung, denn es
ist ebenso vielschichtig wie ereignisreich und von Flugpionieren geprägt, wie
dieses, welches hier geschildert werden soll.
Die vorliegende
Darstellung stützt sich hauptsächlich auf die von der Stiftung Butzweilerhof
Köln zusammengestellten und dort archivierten Dokumente und Aufzeichnungen.[5] Ergänzend werden
allgemeine Literatur zur Geschichte der Luftfahrt sowie entsprechende Dokumente
aus Archiven herangezogen, um das Bild abzurunden.
II
Zivile und militärische Ballon- und Luftschifffahrt
II.
1 Zivile Ballon- und Luftschifffahrt
 Der erste Versuch, in
Köln die Luft zu erobern, der allerdings ergebnislos blieb, ist für Jahr 1785
überliefert. Als Jean-Pierre Blanchard auf seiner Rundreise durch das Deutsche
Reich am 21. Oktober 1785 in Köln eintrifft, richtet dieser eine Anfrage an die
Stadt, in der rheinischen Metropole mit seinem Ballon aufsteigen zu dürfen. Der
Kölner Stadtrat lehnt Blanchards Gesuch ab: Die Stadtväter argumentieren, es
sei vermessen gegen Gottes Barmherzigkeit, derartiges zu unternehmen.[6] Die Stadt Köln erläßt ein
Startverbot und gestattet dem gelernten Mechaniker und Ingenieur lediglich eine
öffentliche Präsentation seines Ballons. Mit der Genehmigung des
Ballonaufstiegs zweieinhalb Wochen zuvor zeigte sich der Rat der Stadt
Frankfurt a. Main aufgeschlossener als die Domstadt.[7] Der erste Versuch, in
Köln die Luft zu erobern, der allerdings ergebnislos blieb, ist für Jahr 1785
überliefert. Als Jean-Pierre Blanchard auf seiner Rundreise durch das Deutsche
Reich am 21. Oktober 1785 in Köln eintrifft, richtet dieser eine Anfrage an die
Stadt, in der rheinischen Metropole mit seinem Ballon aufsteigen zu dürfen. Der
Kölner Stadtrat lehnt Blanchards Gesuch ab: Die Stadtväter argumentieren, es
sei vermessen gegen Gottes Barmherzigkeit, derartiges zu unternehmen.[6] Die Stadt Köln erläßt ein
Startverbot und gestattet dem gelernten Mechaniker und Ingenieur lediglich eine
öffentliche Präsentation seines Ballons. Mit der Genehmigung des
Ballonaufstiegs zweieinhalb Wochen zuvor zeigte sich der Rat der Stadt
Frankfurt a. Main aufgeschlossener als die Domstadt.[7]
Die ablehnende
Haltung der Kölner Ratsherren ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass
den Zeitgenossen der Ballon als Symbol der Aufklärung und des technischen
Fortschritts galt, manchen sogar als Menetekel für Umwälzung und Umsturz. Von
diesen politischen Dimensionen möchte die mehrheitlich bürgerlich konservative
Bevölkerung und die auf Ruhe und Ordnung bedachte Domstadt vermutlich Abstand
nehmen.[8]
Trotz dieser
Besorgnis seitens der Stadt lassen sich Ballonaufstiege nicht restlos aus dem
Kölner Umland bzw. dem Rheinland fernhalten.[9] Im Mai bzw. Juni und Juli
des Jahres 1788 läßt der Landphysiker des Amtes Monheim, Georg Haffner, in
Deutz einen Ballon eigener Bauart steigen;[10] sein Vorhaben hat Haffner
per Zeitungsanzeige im Vorfeld bekannt gegeben.[11] Erst nach Ausräumung
einiger Bedenken des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten Maximilian Franz,
erteilt ein Deutzer Amtmann - Deutz ist damals noch Nachbarstadt von Köln[12] - mit Zustimmung der
Kölner Stadtherren Haffner die Erlaubnis für seine Ballonvorführung.[13] Weitere Ballonaufstiege
von Haffner, ob ohne oder mit menschlicher Besatzung, scheinen ausgeblieben zu
sein. Dafür treffen nach Haffners Abreise aus Deutz beim dortigen Amtmann
mehrere Beschwerdebriefe ein, die dem Aeronauten Zahlungsversäumnisse
nachsagen.[14]
Ähnlich wie der
Franzose Jean-Pierre Blanchard, dem „Ballonfahrer der ersten europäischen
Luftfahrtbegeisterung,“[15] ist Georg Haffner einer
der wenigen professionellen Luftfahrer, die es zum Ende des 18. Jhs. in Europa
offenbar gegeben hat. Er gehört zu der Gruppe von Schausteller-Aeronauten, die
dem Vorbild Blanchards folgen und die Ballonfahrt aus echter Begeisterung
beruflich betreiben. Häufig müssen sie aus den Einnahmen ihrer Vorstellungen
den Bau ihrer Ballone selbst finanzieren. Zu dieser Zeit ist es nur wenigen
Personen vorbehalten, selbst aufzusteigen. Die Ballonfahrer nennen sich selbst
‘Aeronauten’ oder zu deutsch „Luftschiffer“; als
„Kapitäne“ „fahren“ sie im „Luftmeer“ und kleiden sich in Marineuniformen.
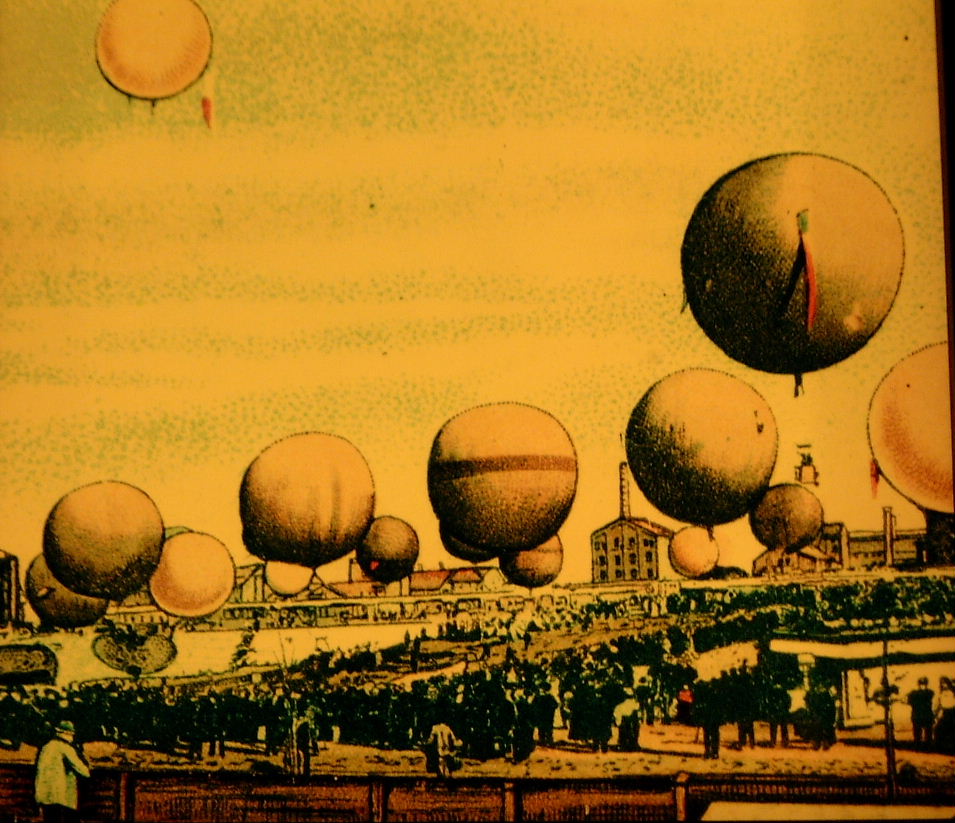 Im Verlauf des 19.
Jhs. erfreuen sich Ballonvorführungen durch berühmte und weniger prominente
Aeronauten zunehmender Beliebtheit. Neben den Veranstaltungen in bekannten
Vergnügungszentren vor einem ‘gehobenen’ Publikum, spielt der Ballon auf
Jahrmärkten und Volksfesten ebenfalls eine attraktive Rolle. Durch eine
Bereicherung des bisherigen Flugprogramms, es kommen Fallschirmabsprünge und
Nachtfahrten hinzu, werden die Voraussetzungen für eine erhöhte und breitere
Publikumswirksamkeit des Ballons geschaffen. Anfangs sind es
vornehmlich ausländische Aviatiker, die in Deutschland Ballonvorführungen
durchführen: „Deutschland besaß auch im 19. Jahrhundert keine Ballonfahrer von
internationalem Ruf.“[16] Im Verlauf des 19.
Jhs. erfreuen sich Ballonvorführungen durch berühmte und weniger prominente
Aeronauten zunehmender Beliebtheit. Neben den Veranstaltungen in bekannten
Vergnügungszentren vor einem ‘gehobenen’ Publikum, spielt der Ballon auf
Jahrmärkten und Volksfesten ebenfalls eine attraktive Rolle. Durch eine
Bereicherung des bisherigen Flugprogramms, es kommen Fallschirmabsprünge und
Nachtfahrten hinzu, werden die Voraussetzungen für eine erhöhte und breitere
Publikumswirksamkeit des Ballons geschaffen. Anfangs sind es
vornehmlich ausländische Aviatiker, die in Deutschland Ballonvorführungen
durchführen: „Deutschland besaß auch im 19. Jahrhundert keine Ballonfahrer von
internationalem Ruf.“[16]
Entsprechend erfolgen
auch in Köln zahlreiche Aufstiege vorwiegend von französischen und englischen
‘Aeronauten’. Derartige Vorführungen könnten die Aeronauten Sinval und Guerin
im April und Mai des Jahres 1808 in Köln veranstaltet haben. In den Kölner
Zeitungen „Gazette Française de Cologne“ und „Der Verkündiger“ werden von ihnen
mehrfach Inserate geschaltet.[17] Darin geben sie ihre
Absicht bekannt, einen Ballon aufsteigen zu lassen, vom dem Monsieur Guerin
dann mit einem Fallschirm abspringen wird.
Anfang Mai 1847 gibt
der Engländer Charles Green[18] in der Domstadt ein
Gastspiel, bei dem er zwei Ballonstarts durchführt.[19] Während seines
Aufenthalts stellt Green seinen Ballon samt eines
verbesserten Fallschirms zur Besichtigung aus. Green zählt zu den
berühmtesten und erfolgreichsten Aeronauten des 19. Jhs. In seinem
selbstkonstruierten ‘Royal Vauxhall Ballon’ gelingt ihm am 7./8. November 1836
eine spektakuläre Fahrt von London bis in das Herzogtum Nassau.
Im März 1878 bittet
Gustave Landreau, ein Aviatiker aus Brüssel, beim Kölner Polizeipräsidenten um
die Erlaubnis, am 15. und 19. Mai 1878 gemeinsam mit seinem Kollegen Palont in
der Stadt aufsteigen zu dürfen.[20]
 Eine bemerkenswerte
Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist
Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den
Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen
Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von
luftfahrtbegeisterten Menschen.[21] Im Jahre 1889 findet sich Wolff in
Köln als Ingenieur und schriftführender Vorsitzender des „Ballon-Sport-Clubs
Cöln, gegr. 1888“ wieder; 1890 gründet er als Pendant zum Berliner Vorgänger
den „Verein zur Förderung der Luftschiffahrt, Cöln“ und avanciert zum
Chefredakteur des Sammelwerks „Das Luftschiff“.[22] Seit den 1880er Jahren
führt der Aeronaut als ständige Attraktion im Riehler „Goldenen Eck“[23] Ballonfahrten mit
Passagieren durch, die ihn über die Grenzen Kölns bekannt machen. So nutzt
Wolff seine praktischen Kenntnisse auf dem Gebiet der Luftschifffahrt zum
Geldverdienen. Eine bemerkenswerte
Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist
Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den
Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen
Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von
luftfahrtbegeisterten Menschen.[21] Im Jahre 1889 findet sich Wolff in
Köln als Ingenieur und schriftführender Vorsitzender des „Ballon-Sport-Clubs
Cöln, gegr. 1888“ wieder; 1890 gründet er als Pendant zum Berliner Vorgänger
den „Verein zur Förderung der Luftschiffahrt, Cöln“ und avanciert zum
Chefredakteur des Sammelwerks „Das Luftschiff“.[22] Seit den 1880er Jahren
führt der Aeronaut als ständige Attraktion im Riehler „Goldenen Eck“[23] Ballonfahrten mit
Passagieren durch, die ihn über die Grenzen Kölns bekannt machen. So nutzt
Wolff seine praktischen Kenntnisse auf dem Gebiet der Luftschifffahrt zum
Geldverdienen.
Spektakulär ist die
Vorführung am späten Abend des 10. Juni 1889 während der „Allgemeinen
Ausstellung für Hausbedarf und Nahrungsmittel“ im Riehler „Goldenen Eck“.[24] An einem ca. 50 m langen
Seil zieht sein Ballon ‘Hohenzollern’ eine „Zusammenstellung verschiedener
Feuerwerkskörper“ hinter sich her, so der Bericht einer Kölner Zeitung.[25] In einiger Höhe zündet
Wolff zahlreiche bunte Leuchtkugeln, die den Himmel über Köln illuminieren.
Zwei Tage zuvor
passierte Wolff im Rahmen der dort gleichzeitig stattfindenden „Internationalen
Sportausstellung“[26]
ein Missgeschick: Sein Ballon ‘Colonia’ platzte während des Füllens, in aller
Eile wurde der kleinere mit Namen ‘Schwalbe’ startklar gemacht.[27] Etwa ein Jahr später, am
7. Juli 1890, passiert Wolff erneut ein Malheur, diesmal mit schwerwiegenderen
Folgen: Auf einer Fahrt von Köln nach Bensberg wird sein Ballon ‘Stollwerck’
während der Landung von einer plötzlich auftretenden Windböe erfasst. Dieser
reißt einen der acht Landarbeiter, die bei der Landung helfen, den noch im Korb
befindlichen Passagier Peter Schmitz, der u. a. Präsident der Blauen-Funken
ist, sowie Wolff selbst mit sich in die Höhe. Kurz darauf stürzt der
Landarbeiter ab und verletzt sich schwer, Peter Schmitz und Wolff können später
unverletzt den Ballon verlassen. Im Anschluss an diese Ereignisse wird Wolff
seitens der Behörden vorgeworfen, das Leben seiner Passagiere fahrlässig aufs
Spiel zu setzen.[28]
Offenbar hat die
Verbreitung dieser Ballon-Unfallgeschichte, die Gegenstand zahlreicher
Zeitungsartikel ist,[29] die Bevölkerung
sensibilisiert. Von den Behörden wird zunehmend verlangt, dass durch genaue
Prüfungen von Anfragen für Ballonaufstiege ähnliche Vorgänge zukünftig
vermieden werden sollen. So erreicht den Kölner Polizeipräsidenten am 19. Mai
1894 ein Brief, in dem davor gewarnt wird, dem Luftschiffer Robert Feller,
genannt Ferrel, die Erlaubnis für einen Ballonaufstieg in Köln zu erteilen.[30] Feller, so der Verfasser
des Briefes, gefährde wegen seiner Trinksucht seine Passagiere. Welche
konkreten Maßnahmen eingeleitet werden, ist nicht bekannt; ein Jahr später ist
Ferrel wieder bei seiner Berufsausübung im Riehler „Goldenen Eck“ anzutreffen.[31] Hier tritt „Kapitän“
Ferrel zusammen mit der bekannten Luftschifferin „Miss Polly“ auf. Zu „Miss
Pollys“ Attraktionen gehört der Aufstieg an einer Strickleiter, die unter dem
Ballonkorb hängt.„Miss Polly“, die mit
bürgerlichem Namen Luise Giese geb. Schleifer heißt, gehört, neben der
bekannteren Frankfurter Fallschirmartistin und Ballonfahrerin Käthe Paulus, zu
den wenigen Frauen in diesem Gewerbe.[32] Da beide Frauen in
Matrosenkostümen auftreten sowie den Künstlernamen „Miss (mit zwei ‘s’) Polly“
bzw. „Miß (mit ‘ß’) Polly“ tragen und somit nur anhand der unterschiedlichen
Schreibweise zu unterscheiden sind, werden sie häufig verwechselt. Beide
Aeronautinnen gastieren im Rheinland, daneben werden ihnen auch Engagements in
zahlreichen Städten des Auslandes angeboten.
Auch für die Entwicklung der Ballon- und
Luftschifftechnik gehen von Köln im 19. Jh. sowie zu Beginn des 20. Jhs.
wichtige Impulse aus. Bereits 1861 beschäftigt sich Paul Haenlein, Mitglied des „Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“,[33] angeblich in
Köln-Bayenthal mit dem Bau eines Luftschiffmodells, mit dem ihm im Oktober 1871
einige Flugversuche gelungen sein sollen.[34] Haenlein, dessen
grundlegende Bedeutung seiner Arbeiten für die Entwicklung und den Bau von
Luftschiffen allerdings weithin unbeachtet geblieben ist, wird 1872 mit dem Bau
eines lenkbaren Luftschiffes bekannt.[35]
„Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“,[33] angeblich in
Köln-Bayenthal mit dem Bau eines Luftschiffmodells, mit dem ihm im Oktober 1871
einige Flugversuche gelungen sein sollen.[34] Haenlein, dessen
grundlegende Bedeutung seiner Arbeiten für die Entwicklung und den Bau von
Luftschiffen allerdings weithin unbeachtet geblieben ist, wird 1872 mit dem Bau
eines lenkbaren Luftschiffes bekannt.[35]
Einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Kölner als auch zur allgemeinen Entwicklung der
Luftfschifffahrt sowie zum städtischen Industrialisierungsprozess leistet der
Kölner Fabrikant Franz Clouth mit seiner Firma „Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik
Cöln-Nippes“. Zum Ende des 19. Jhs widmet sich das 1862 gegründete
Unternehmen, welches bisher Kautschuk-Produkte aller Art produziert, der
Herstellung von Ballonstoffen und kompletter Ballone sowie der Entwicklung und
dem Bau eines lenkbaren Luftschiffes.[36] Bereits 1908 unternimmt
das Luftschiff ‘Clouth I’ über Nippes
seine Jungfernfahrt. Für die Entwicklung und Konstruktion des Luftschiffes
werden ca. eineinhalb Jahre benötigt, alle Teile mit Ausnahme des Motors sind
Eigenanfertigungen der Firma Clouth. Zum Bau von ‘Clouth I’ entsteht 1907 auf
dem Werksgelände in Köln-Nippes das vermutlich erste architektonische Zeugnis
einer – im weitesten Sinne – Luftverkehrsarchitektur in Köln: Es wird eine 45 m
lange, 29 m breite und 17 m hohe Luftschiffhalle errichtet, die den
firmeneigenen Ballonen und dem Luftschiff später als „Heimathafen“ dient.[37] 1909 ist das Clouthsche Luftschiff
auf der „Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung“ (ILA) in Frankfurt a. Main
neben Konstruktionen von Zeppelin, Parseval und Ruthenberg zu besichtigen. Bei
den zahlreichen Aufstiegen während des Ausstellungsbesuches stellt sich heraus,
dass die Steuerung des Luftschiffes modifiziert werden muss. Bereits in
Frankfurt werden einige provisorische Änderungen vorgenommen, doch erst nach
der Rückkehr nach Köln erhält das Luftschiff eine komplett überarbeitete
Steuerung; das Schiff gewinnt dadurch erheblich an Manövrierfähigkeit. Auch zur
Weltausstellung 1910 in Brüssel unternimmt das Luftschiff eine Fahrt, wo es
mehrere Rundfahrten absolviert und vom Flugkomitee der Ausstellung mit dem
Preis für Luftschiffe ausgezeichnet wird.[38] Insgesamt hat das
Luftschiff ‘Clouth I’ über 40 Fahrten durchgeführt und dabei fast 2000
Kilometer zurückgelegt; dieser Umstand beweist die Betriebssicherheit und
Brauchbarkeit dieses Typs. Ein zweites Luftschiff wird nie entwickelt, denn
bereits 1910 beginnt sich die Firma Clouth aus dem Bereich der Luftschifffahrt
zurückzuziehen.[39]
Neben der Konstruktion eines eigenen Luftschiffes, sind es ebenfalls einige Ballone
aus der Clouth'schen Produktion, die in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen
sind und Pionierarbeit geleistet haben.[40]
Die Kunst des
Ballonfahrens breitet sich zu Beginn des 19. Jhs. innerhalb und außerhalb
Europas schnell aus. Der Nachteil allerdings ist, dass sie bald hauptsächlich
von Schaustellern mit ihren öffentlichen Aufstiegen in Freiballonen beherrscht
wird und weniger von Erfindern, die sich um technologische Fortschritte
bemühen. Meist wird das Ballonfahren von Abenteurern oder Angehörigen des
Schaustellergewerbes betrieben, doch „stets haftete ihrem Tun ein Hauch von
Unseriosität an.“[41]
Die Ausnahme hiervon bilden indes Frankreich und England, „wo private Aufstiege
immer mehr zunahmen und Berufsaeronauten häufig von Amateuren begleitet oder
durch sie ersetzt“[42] werden.
Im Verlauf des 19.
bzw. am Anfang des 20. Jhs. ändert sich dies. Zu dieser Zeit wandelt sich der
Ballon von einem reinen Schauobjekt zu einem Sportgerät, die Entwicklung des
Luftsportes „im Sinne eines für jedermann zugänglichen Breitensportes“[43] nimmt hier ihren Ausgang.
Auch Mitglieder der oberen Gesellschaftsschichten entdecken nun ihr praktisches
Interesse an der Ballonfahrt. Einen wichtigen Beitrag zur Entstehung dieser
Sportart leistet der Amerikaner James Gordon Bennett. Als Zeitungsherausgeber,
der „auf steter Suche nach einer Schlagzeile für sein Blatt“[44] ist, fördert er die
Entwicklung der Luftfahrt finanziell. 1906 startet in Paris die nach ihm
benannte und in Nachfolge alljährlich ausgeschriebene, internationale „Gordon-Bennett-Wettfahrt“
für Freiballone mit einem überwältigenden Erfolg.
Die Wirkung dieses
Luftsportereignisses schlägt sich Deutschland in der Form nieder, dass nun eine Welle von Gründungen neuer Vereine für
Luftschifffahrt einsetzt.[45] Durch Einführung einer
Ballonfahrerlizenz, Veranstaltung von Wettbewerben und Ballonrennen sowie
Herausgabe von Wettbewerbsregeln tragen speziell diese Vereine zur Etablierung
und Popularität des Ballonsportes bei. Der erste Verein im Rheinland ist der am
15. Dezember 1902 ins Leben gerufene „Niederrheinische Verein für Luftschiffahrt“ (NVfL).[46]
In Köln erfolgt am 6.
November 1906 im Hause Kattenbug 1–3 die Gründung des „Cölner Aero-Club“, der
aber bereits auf der ersten Generalversammlung am 15. Januar 1907 in „Cölner
Club für Luftschiffahrt e. V.“ (CCfL) umbenannt wird.[47] Die wichtigsten Ziele des
Vereins sind die Etablierung der Luftschifffahrt in gebildeten Kreisen sowie
die Ausübung und Pflege des Luftsportes. Zu den Gründungsmitgliedern des
Vereins gehören Persönlichkeiten der domstädtischen Wirtschaft, Kultur,
Gesellschaft und dem Militär. Zu den Gründungsinitiatoren zählen der
Rechtsanwalt Dr. Cornelius Menzen, Fabrikbesitzer Hans Hiedemann,
Rechtsreferendar Dr. Otto Nourney sowie eine Reihe von Mitgliedern des „Kölner
Automobilclubs“. Ende 1907 hat der CCfL bereits 270 Mitglieder. Darunter
befinden sich so bekannte Namen wie Clouth, Greven und Stollwerck; mit 47
Mitgliedern bilden die Offiziere die größte Berufsgruppe innerhalb des Vereins.
1908 übernimmt der damalige Studiendirektor der Kölner Handelshochschule und
Mitbegründer der Kölner Universität, Prof. Christian Eckert, den
Vereinsvorsitz. Im Jahre 1910 verzeichnet der Kölner Verein 700 Mitglieder.
Am 9. Februar 1907
findet in Deutz der erste Ballonstart des Vereins statt. Alle weiteren
Aufstiege erfolgen vom Jugendspielplatz am Lindentor, dem Gelände des heutigen
Aachener Weihers; das 7750 qm große Areal ist mit 36 Füllstellen ausgestattet.[48]
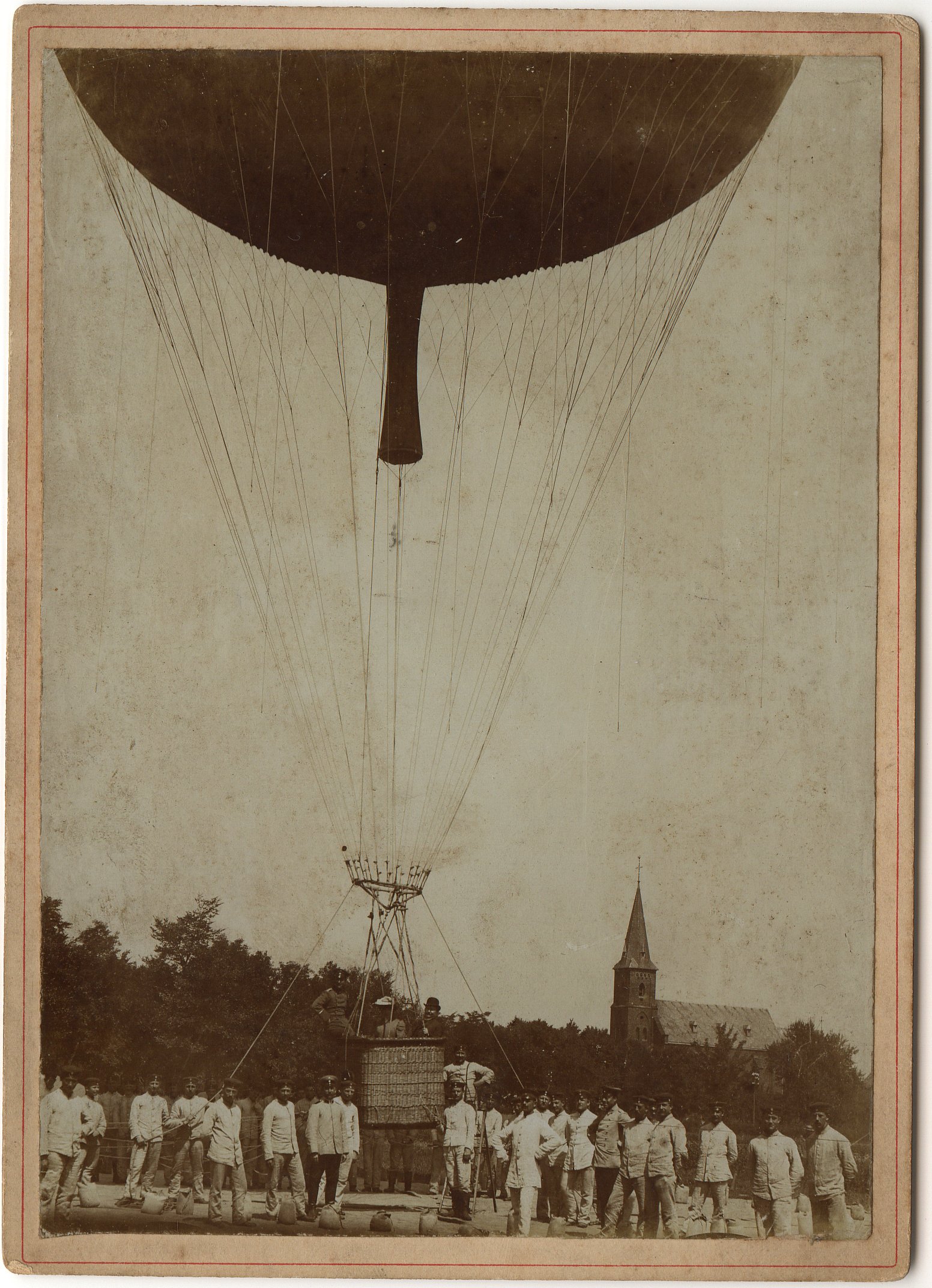 Zunächst müssen die
ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone
unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein
für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907
feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,
Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April
1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein
erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in
St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser
Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im
ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig
demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung
ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte
Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“[49] – hat Hiedemann mit
seinem Mitfahrer Dr. Niemeyer Glück im Unglück: Zwar legen die Ballonfahrer in
Hiedemanns Ballon ‘Busley’ die zweitlängste Strecke mit der zweitlängsten
Fahrtdauer zurück, doch müssen die beiden Aeronauten zwischen Norwegen und
Schottland auf hoher See notwassern; erst nach 26 Stunden werden sie von einem
Schiff gerettet. Da die Wettbewerbs-Jury ausschließlich Bodenlandungen wertet,
bleibt der Verdienst der beiden Kölner unberücksichtigt.[50] Zunächst müssen die
ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone
unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein
für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907
feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,
Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April
1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein
erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in
St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser
Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im
ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig
demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung
ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte
Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“[49] – hat Hiedemann mit
seinem Mitfahrer Dr. Niemeyer Glück im Unglück: Zwar legen die Ballonfahrer in
Hiedemanns Ballon ‘Busley’ die zweitlängste Strecke mit der zweitlängsten
Fahrtdauer zurück, doch müssen die beiden Aeronauten zwischen Norwegen und
Schottland auf hoher See notwassern; erst nach 26 Stunden werden sie von einem
Schiff gerettet. Da die Wettbewerbs-Jury ausschließlich Bodenlandungen wertet,
bleibt der Verdienst der beiden Kölner unberücksichtigt.[50]
Der CCfL verfügt bald
über eine ansehnliche Anzahl sowohl klubeigener als auch privater Freiballone
und kleinerer Luftschiffe, die an zahlreichen Wettbewerben und Ausstellungen
teilnehmen. Im Jahr 1909 besitzt der Kölner Verein zahlreiche Ballone; darunter
sind allein fünf Aerostaten der in Köln ansässigen Firma Clouth – ‘Clouth I bis
V’ – , die alle dem Klub zur Verfügung stehen.[51] Seit seiner Gründung bis
zum Jahr 1914 verzeichnet der CCfL insgesamt 616 Ballonfahrten. Wie engagiert
die Mitglieder des CCfL sind, zeigt sich daran, dass der Kölner Klub bereits im
zweiten Jahr seines Bestehens, 1907, die Tagung des „Deutschen
Luftschiffer-Verbandes“ (DLV), der 1902 in Augsburg gegründeten
Dachorganisation aller Luftfahrt-Vereine, in der Domstadt ausrichtet. Der CCfL
wird als zehnter Klub in den DLV aufgenommen.[52]
Für Köln ist der 1906
gegründete CCfL der entscheidende Ausgangspunkt und Grundlage für eine
anschließend jahrzehntelange Ballon- bzw. Luftsportgeschichte der Stadt; damit
findet die allgemeine Luftfahrt in Köln eine konkrete Organisationsform: „… als
einer der aktivsten Luftschiffahrtsvereine Deutschlands führte [der CCfL]
zahlreiche Ballonfahrten durch, die große sportliche Leistungen darstellten,
aber auch der wissenschaftlichen Erforschung der Atmosphäre dienten.“[53] Der Verein und seine
Mitglieder verhelfen der am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Sportart zu
einer ungemein großen Popularität innerhalb Kölns. Die praktische Ausübung des
Luftsportes erstreckt sich anfangs auf Freiballone und Luftschiffe. Auf die
Bürger der Domstadt ist der Eindruck der neuen Sportart so beträchtlich und von
so großer Begeisterung geprägt, dass die Veranstaltungen des Kölner Klubs auf
dem Ballonaufstiegsplatz vor dem Lindentor stets zu Ereignissen mit
Volksfestcharakter werden. In der Folgezeit erweist sich der CCfL als
Ausrichter bedeutender luftsportlicher Veranstaltungen.
Eine der Höhepunkte
der frühen Ballonsportgeschichte ist zweifellos die vom Kölner Verein
veranstaltete „Internationale Ballonwettfahrt“ am 27. und 29. Juni 1909. An
diesem größten internationalen Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.
zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten
Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35
Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer
Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als
Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den
Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten
Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich
tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der
Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine
Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der
hohen Eintrittspreise unerschwinglich.[54] Der Erlös aus den
verkauften Eintrittskarten deckt nicht die vom CCfL für die Veranstaltung
aufgebrachten 16000 Mark. Aus diesen und weiteren Gründen ist die Resonanz auf
die Veranstaltung in der Presse eher verhalten.[55] Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.
zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten
Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35
Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer
Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als
Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den
Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten
Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich
tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der
Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine
Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der
hohen Eintrittspreise unerschwinglich.[54] Der Erlös aus den
verkauften Eintrittskarten deckt nicht die vom CCfL für die Veranstaltung
aufgebrachten 16000 Mark. Aus diesen und weiteren Gründen ist die Resonanz auf
die Veranstaltung in der Presse eher verhalten.[55]
Die „Internationale
Flugwoche“ vom 30. September bis 6. Oktober 1909 bildet das zweite
flugsportliche Großereignis des Jahres in Köln. Die Veranstaltung, zugleich das
„bedeutendste sportliche Ereignis auf dem Gebiet der Aviatik im Jahre 1909,“[56] findet auf der Rennbahn
in Köln-Merheim,[57]
dem heutigen Weidenpesch, statt. Zum ersten Mal ist es der Kölner Bevölkerung
möglich, die neue Form der Flugtechnik, die Motorfliegerei, unmittelbar zu
erleben. Das Interesse an der Veranstaltung ist entsprechend groß. Im
fliegerischen Geschehen während der Veranstaltung dominieren französische
Piloten mit ihren französischen Konstruktionen. Berühmte Luftfahrtpioniere und
Kunstflieger, wie Louis Bleriot, Léon Delagrange und Louis Paulhan, zeigen ihr
fliegerisches Können, u. a. stellt Blériot einen neuen Geschwindigkeitsrekord
auf.[58]Flugtage, bei denen
einer Eintritt zahlenden Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben wird, mehrere
Flugzeuge zugleich in der Luft zu erleben, gibt es seit 1909.[59] Die Orte, die von den
ersten Fliegern für derartige Veranstaltungen genutzt werden, sind Wiesen oder
flaches Gelände, deshalb eignet sich die ebene Rasenfläche der Kölner
Pferderennbahn für die Start- und Landevorgänge besonders gut.[60] Die bereits angesprochene
Dominanz französischer Flieger mit französischen Konstruktionen hat folgende
Gründe: Frankreich setzt zu dieser Zeit erhebliche finanzielle Mittel für die
Flugzeugentwicklung ein und etabliert sich in den Vorkriegsjahren als
Luftmacht. Anders in Deutschland: Hier ist die Luftfahrt vorrangig auf den Bau
von Luftschiffen, besonders den Zeppelinen, fixiert. Industrie und insbesondere
Militär unterschätzen (scheinbar) noch die Fähigkeiten des Flugzeugs und
unterlassen entsprechende Investitionen; Deutschland bemüht sich erst in den
kommenden Jahren, das Niveau der französischen Fliegerei zu erreichen.[61] Der daraus resultierende
flugzeugtechnische Rückstand wird zunächst in bescheidenem Rahmen durch das
Engagement privater Flugzeugbauer kompensiert, so auch in Köln:
Einer der ersten
Kölner Flugpioniere auf diesem Gebiet ist Arthur Delfosse. Seit 1902 baut der
gebürtige Kölner Eigenkonstruktionen, deren Flugtauglichkeit – wie üblich –
anfangs über einige Hüpfer nicht hinausgeht. In diesem Jahr gelingen ihm auf
der Mülheimer Heide die ersten Luftsprünge. Neben Arthur Delfosse sind es Bruno
Werntgen, Jean Hugot und andere, denen aufgrund ihrer Pionierarbeit auf dem
Gebiet der Motorfliegerei ein besonderes Verdienst zukommt und die damit
innerhalb der Kölner Luftfahrtgeschichte eine besondere Stellung einnehmen.[62]
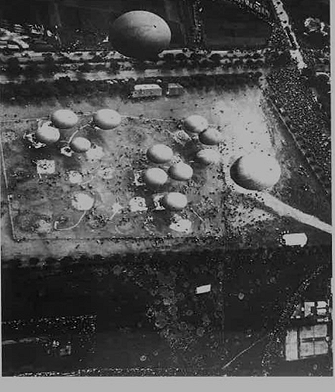 Die „Internationale
Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos
Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar. Die „Internationale
Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos
Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar.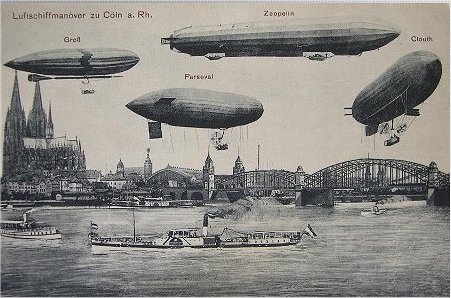 Die Anzahl von insgesamt 69
Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des
Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt
des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale
Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer
derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an
erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der
Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.
Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich
um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre
zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte
Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“[63] Damit wird dieses Kölner
Ereignis zum Bestandteil der größten Motorflugveranstaltung dieser Art vor dem
Ersten Weltkrieg. Nun sind auch einige Kölner Flieger vertreten, vor allem
Bruno Werntgen beeindruckt durch seine gelungenen Flüge. Im selben Jahr
veranstaltet der Franzose Adolphe Pégoud am selben Ort einen weiteren Flugtag;
die Kölner kommen zu tausenden. Die Anzahl von insgesamt 69
Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des
Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt
des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale
Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer
derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an
erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der
Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.
Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich
um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre
zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte
Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“[63] Damit wird dieses Kölner
Ereignis zum Bestandteil der größten Motorflugveranstaltung dieser Art vor dem
Ersten Weltkrieg. Nun sind auch einige Kölner Flieger vertreten, vor allem
Bruno Werntgen beeindruckt durch seine gelungenen Flüge. Im selben Jahr
veranstaltet der Franzose Adolphe Pégoud am selben Ort einen weiteren Flugtag;
die Kölner kommen zu tausenden.
Das Gelände der Pferderennbahn im Kölner Norden stellt
für derartige Veranstaltungen ein Provisorium dar. Da die Ballonfahrer mit dem
Gelände am Lindentor bereits über einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Aufstiegsplatz verfügen, beabsichtigen nun auch die Kölner Motorflieger für
ihre luftsportlichen Aktivitäten einen geeigneten Platz einzurichten. Die Suche
nach einem solchen Fluggelände beginnt bereits 1908; vorerst scheitert dieses
Vorhaben an der Militärbehörde, die sich bis dahin wegen des Festungscharakters
der Domstadt[64]
nicht für eine Zusage entscheiden kann.
Im Jahre 1910 finden einige Flugversuche von Jean
Hugot auf dem Feld des landwirtschaftlichen Betriebes des Butzweiler Hofes
statt. Nach und nach nutzen andere Kölner Flieger die guten Start- bzw.
Landeeigenschaften des Areals und errichten, wie bereits Hugot zuvor,
dauerhafte Unterstellräume für ihre Flugzeuge.
Die ersten ernsthaften Versuche seitens der
Stadtverwaltung, in Köln einen Flugplatz auf Dauer zu einzurichten, erfolgen
1911. Dabei wird zwar das Gebiet um den immer noch existierenden
Landwirtschaftsbetrieb des Butzweiler Hofes als
zukünftiger Lande- und Startplatz vorgesehen, doch über die endgültige
Unterbringung des Flugplatzes an dieser Stelle ist keinesfalls entschieden.[65] Im Herbst des Jahres
verhandelt der CCfL mit der Stadt über die pachtfreie Überlassung eines
größeren städtischen Grundbesitzes nordwestlich des heutigen Kölner Stadtteils
Volkhoven, um dort einen Flugplatz einzurichten. Inzwischen ist sich jedoch
auch das deutsche Militär der militärischen Bedeutung des Flugzeuges bewusst
geworden.
Noch im Sommer 1912
organisiert Hugot den ersten Großflugtag auf dem Gelände des Butzweiler Hofes,
bei dem es sich keineswegs um einen bereits offiziellen Flugplatz handelt. Zu
dem Ereignis erscheinen 100.000 Besucher.[66] Trotzdem sind alle
Initiativen zur Aufrechterhaltung des zivilen Flugbetriebs vergeblich. Das
Gelände am Butzweiler Hof soll demnächst für den zivilen Flugbetrieb gesperrt
werden. Das Ende der Sportfliegerei zeichnet sich ab, zahlreiche Flieger
wandern zum Flugfeld in Köln-Merheim oder, wie Werntgen, nach Bonn-Hangelar ab.[67]
II.
2 Militärische Ballon- und Luftschifffahrt
Als erstes
unmittelbares Zeugnis für einen Ballonaufstieg in Köln gilt eine Tuschezeichnung
von Franz Xaver (?) Laporterie[68] mit dem Titel „Aussicht
an der Hahnenpforte den 29. Junius 1795, da der französische Ballon ist
aufgelassen“. Die Zeichnung zeigt die Gegend vor dem Hahnentor. Im
Bildvordergrund sind die Außenwälle der Kölner Stadtbefestigung, in der rechten
Bildhälfte ist ein Teil eines Festungsturms sichtbar. Aus der Stadt führt ein
Weg ins freie Gelände hinaus. Auf diesem wird in Anwesenheit einer großen
Gruppe von Zuschauern ein Fesselballon aufgelassen. Unterhalb der eigentlichen
Ballonkugel ist die Gondel des Ballons in Form einer Gondel erkennbar, in der
sich schemenhaft drei Personen ausmachen lassen. Weitere Zuschauer befinden am
Anfang des Weges und auf den Außenwällen der Festungsmauern.
 Das Ereignis des
französischen Ballonaufstiegs, welches den Beginn der bemannten Luftschifffahrt
in Köln darstellt, wird durch eine andere Quelle Das Ereignis des
französischen Ballonaufstiegs, welches den Beginn der bemannten Luftschifffahrt
in Köln darstellt, wird durch eine andere Quelle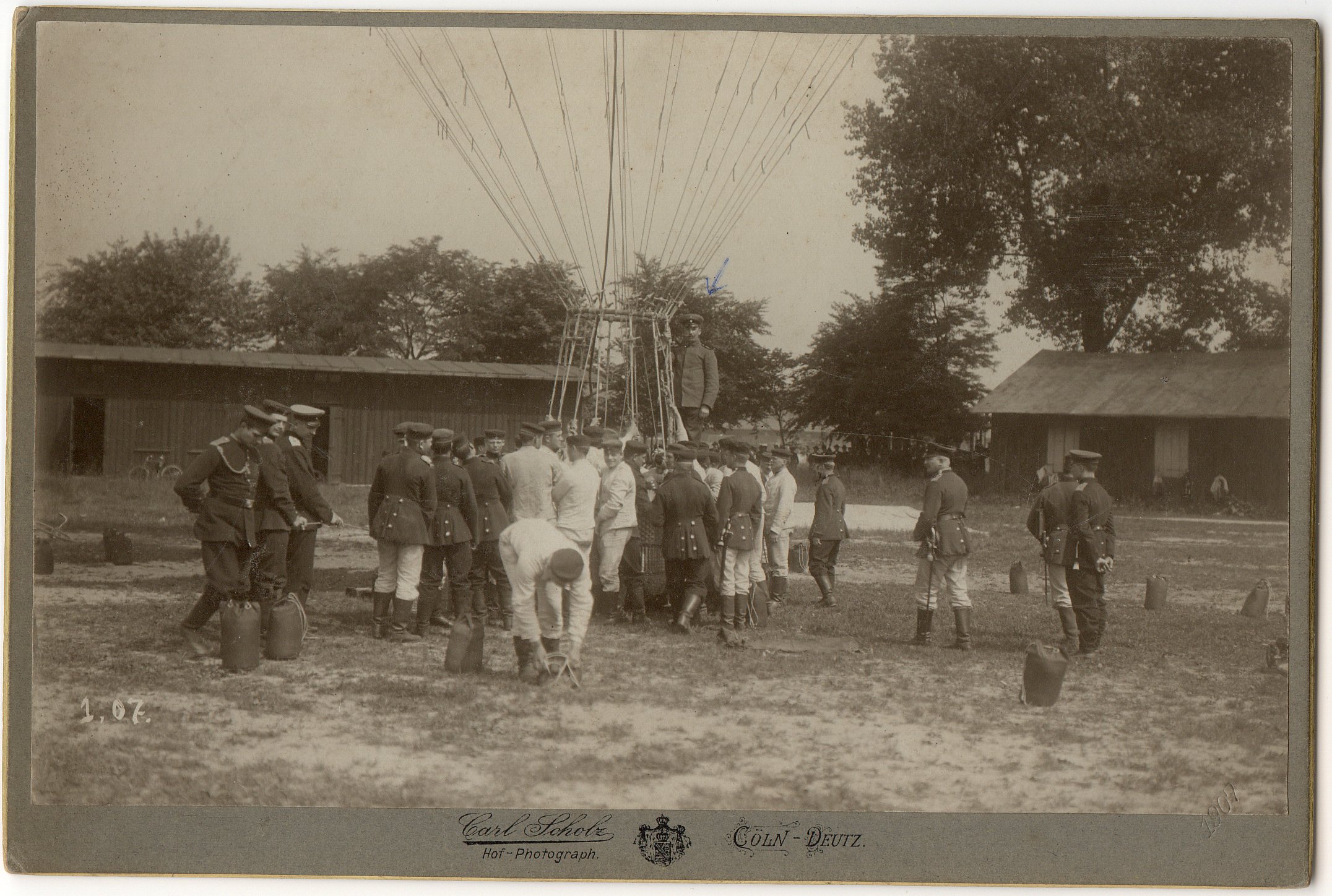 bestätigt: Es handelt sich
dabei um einen Brief eines Balthasar Kourt vom 15. Juli 1795 an die unter
Französischer Verwaltung stehende Reichsstadt Köln.[69] Darin fordert Kourt eine
Wiedergutmachung für die Schäden auf seinem Feld, die durch das Auflassen eines
Ballons entstanden seien. bestätigt: Es handelt sich
dabei um einen Brief eines Balthasar Kourt vom 15. Juli 1795 an die unter
Französischer Verwaltung stehende Reichsstadt Köln.[69] Darin fordert Kourt eine
Wiedergutmachung für die Schäden auf seinem Feld, die durch das Auflassen eines
Ballons entstanden seien.
Mit hoher
Wahrscheinlichkeit handelt es sich, folgt man den Hinweisen in der Zeichnung
und dem Brief eines in den Vorgang involvierten Mannes, um den Aufstieg eines
französischen Militärballons zu Übungszwecken. Nachdem die französischen
Truppen am 6. Oktober 1794 Köln besetzten, stand die Reichsstadt unter
französischer Militärverwaltung. Die militärische Verwendung von Ballonen in
der französischen Armee hatte bereits seit den Revolutionskriegen Tradition, wo
sie als u. a. Beobachtungs- und Aufklärungs-Ballone eingesetzt wurden. Die
erste Luftschiffer-Kompanie der Welt, die ‘Aérostiers militaires’, wurde am 2.
April 1794 gebildet.[70]
 Als 1870/71 der
deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine
Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung
wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische
Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte
sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert
und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes
bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein
Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“[71] Coxwell ist ein auf dem
Gebiet der militärischen Ballonfahrt erfahrener Luftschiffer, bereits während
seines ersten Aufenthaltes in Deutschland von 1848 bis 1851 hat er in der Nähe
von Berlin Bombenabwürfe vom Ballon aus demonstriert. Die in Köln ausgebildete
Luftschiffer-Einheit wird im September 1870 zur Belagerung Straßburgs verlegt,
jedoch in den Kampfhandlungen nicht eingesetzt und bereits am 10. Oktober 1870
wieder aufgelöst, ohne je an einem Kampf-Einsatz beteiligt gewesen zu sein. Als 1870/71 der
deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine
Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung
wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische
Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte
sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert
und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes
bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein
Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“[71] Coxwell ist ein auf dem
Gebiet der militärischen Ballonfahrt erfahrener Luftschiffer, bereits während
seines ersten Aufenthaltes in Deutschland von 1848 bis 1851 hat er in der Nähe
von Berlin Bombenabwürfe vom Ballon aus demonstriert. Die in Köln ausgebildete
Luftschiffer-Einheit wird im September 1870 zur Belagerung Straßburgs verlegt,
jedoch in den Kampfhandlungen nicht eingesetzt und bereits am 10. Oktober 1870
wieder aufgelöst, ohne je an einem Kampf-Einsatz beteiligt gewesen zu sein.
Eine Neubelebung
erfährt die deutsche militärische Ballon- und Luftschifffahrt zu Beginn des
Jahres 1884. Nachdem England und Frankreich mit der Aufstellung von
Luftschiffertruppen vorangegangen sind, wird am 1. Juni 1884 in Berlin ein
Détachement mit der Bezeichnung ‘Versuchsstation für Captivballons’ gebildet
und somit ein kaiserlicher Befehl vom März dieses Jahres umgesetzt. Der Dienst
sieht die Verwendung und Bedienung von Fessel- und Freiballonen vor.
Ein Jahr später,
1885, ist die preußische Festung Köln Ort einer Belagerungsübung, an der auch
die neu aufgestellte Truppe teilnimmt; im Oktober 1892 absolviert sie dort ein
Lehrkommando.
Bei dem 1904 in Köln
auf der Wahner Heide[72] stattfindenden
Artillerieschießen fungiert die Einheit der Berliner Luftschiffertruppe mit
ihren aufgelassenen Ballonen gleichsam als ‘fliegender Feuerleitstand’: hinter
den Batterien schwebend, beobachten und koordinieren sie das
Artillerieschießen. Unter diesen Soldaten befindet sich Erich Gensicke, der in
den kommenden Jahren in der Kölner Luftfahrt eine wichtige Rolle spielen wird;
er ist in den 1930er Jahren stellvertretender Direktor des Flughafens
„Butzweilerhof“.
Maßgeblich durch
Ferdinand Graf von Zeppelin bestimmt, vollzieht sich zu Beginn des 20. Jhs. die
Entwicklung „lenkbarer Ballone“, sog. Luftschiffe. Am 2. Juli 1900 gelingt dem
Grafen von Zeppelin mit dem von ihm konstruierten 128 m langen Luftschiff ‘LZ
1’[73] eine gesteuerte Fahrt.
Ein neuer Weg in der Luftfahrt wird damit beschritten. Die Fahrten, die bislang
mit den Ballonen unternommen wurden, waren Zufallsreisen. Erst die Erfindung
und der Einsatz des Benzinmotors ermöglichen den nun nicht mehr kugelrunden,
sondern stromlinienförmigen Luftschiffen eine gesteuerte Bewegung durch den
Luftraum. Dem ‘LZ 1’ folgen weitere starren Luftschiffe des Grafen Zeppelin. Im
Mai 1906 unterbreitet er, aus Amerika zurück gekehrt, dem deutschen Kriegsministerium ein Angebot, seine
gesamte Luftschiffproduktion an den Staat zu verkaufen. Insbesondere betont er
anhand einer beigefügten Studie die Vorteile des Luftschiffes bei einer
Mobilmachung.[74]
Auch das Luftschiff-Unglück des ‘LZ 4’, im August 1908 in
Stuttgart-Echterdingen, bedeutet keinesfalls das Ende der deutschen
Luftschifffahrt. Im Gegenteil, in einer nationalen Begeisterung werden
innerhalb weniger Monate über 7 Millionen Mark für den Fortgang und die
technische Weiterentwicklung des Luftschiffbaues von Bürgern gespendet. Die
hohe Summe dieser „Zeppelinspende“ belegt, dass sich in dieser Zeit der Graf
Zeppelin mit seiner Erfindung eines großen Rückhaltes in der Bevölkerung gewiss
sein konnte.
Auf Initiative des
CCfL wird die Stadt Köln aufgefordert, als erste deutsche Stadt dem Grafen
Zeppelin eine Luftschiffhalle mit technischen Anlagen bereitzustellen.[75] Den Bestrebungen des
Vereins entspricht die Kölner Bürgerschaft 1908 in Form einer finanziellen
Beteiligung an der neugegründeten Deutschen Luftschiffahrts A. G. in Frankfurt
a. Main (DELAG),[76]
dem ersten Luftverkehrsunternehmen der Welt. Zweck der Gesellschaft ist die
Durchführung eines planmäßigen Luftverkehrs mit Luftschiffen: „Diese Schiffe
sollten freilich keinen regelmäßigen Verkehr, etwa nach dem Beispiel der
Eisenbahnen erledigen, sondern waren für gelegentliche Vergnügungsfahrten
bestimmt …“[77]
Obwohl sich Köln um die Einbindung des Luftschiffhafens in den
DELAG-Luftverkehr energisch bemüht und die gleichen Interessen Düsseldorfs
bekämpft, entscheidet sich „in der DELAG-Aufsichtsratssitzung vom 28. Februar
1910 die Mehrzahl der Mitglieder zugunsten Düsseldorfs.“[78]
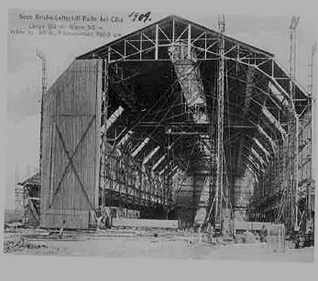 Im Spätsommer des für
den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das
Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August
trifft gegen 11.30 Uhr ‘LZ 5’, von
der ILA in Frankfurt a. Main kommend, in Köln ein.[79] „Die Begeisterung der
Kölner, die noch nie einen Zeppelin gesehen haben, kennt keine Grenzen: Bereits
am frühen Morgen machen sich unzählige Menschen auf den Weg nach Bickendorf …
Auch an anderen Orten, etwa vor dem Dom oder auf der Anhöhe bei Müngersdorf,
finden sich viele Kölner ein, um die ‘fliegende Zigarre’ beim Anflug zu sehen.
Die Kölner ‘Pänz’ bekommen sogar schulfrei.“[80] Vor seiner Landung in
Bickendorf umfährt der vom Grafen Zeppelin persönlich gesteuerte 136 m lange
‘LZ 5’ zweimal die Türme des Kölner Doms und präsentiert sich so den Kölner
Bürgern. Am Landeplatz in Köln-Bickendorf empfängt eine riesige, jubelnde
Menschenmenge den Grafen Zeppelin und seine Mannschaft. Eine Denkschrift an
einem Erker des Hauses Herwarthstr. 31, wo Graf Zeppelin übernachtete, erinnert
noch heute an diesen Besuch. Im Spätsommer des für
den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das
Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August
trifft gegen 11.30 Uhr ‘LZ 5’, von
der ILA in Frankfurt a. Main kommend, in Köln ein.[79] „Die Begeisterung der
Kölner, die noch nie einen Zeppelin gesehen haben, kennt keine Grenzen: Bereits
am frühen Morgen machen sich unzählige Menschen auf den Weg nach Bickendorf …
Auch an anderen Orten, etwa vor dem Dom oder auf der Anhöhe bei Müngersdorf,
finden sich viele Kölner ein, um die ‘fliegende Zigarre’ beim Anflug zu sehen.
Die Kölner ‘Pänz’ bekommen sogar schulfrei.“[80] Vor seiner Landung in
Bickendorf umfährt der vom Grafen Zeppelin persönlich gesteuerte 136 m lange
‘LZ 5’ zweimal die Türme des Kölner Doms und präsentiert sich so den Kölner
Bürgern. Am Landeplatz in Köln-Bickendorf empfängt eine riesige, jubelnde
Menschenmenge den Grafen Zeppelin und seine Mannschaft. Eine Denkschrift an
einem Erker des Hauses Herwarthstr. 31, wo Graf Zeppelin übernachtete, erinnert
noch heute an diesen Besuch.
Die Fahrt von ‘LZ 5’
am 5. August 1909 dient seiner Überführung an ein militärisches Vorauskommando,
welches sich seit April 1909 in der Festung Köln bzw. in Köln-Bickendorf
befindet und sich auf die Übergabe vorbereitet. Das Luftschiff erhält die
militärische Bezeichnung ‘Z II’, als Heeresschiff soll es überwiegend
Aufklärungs- und Beobachtungsaufgaben übernehmen.
Im selben Monat
beginnen unter Leitung des Militärbauamtes die viermonatigen Bauarbeiten am
Luftschifflandeplatz bzw. Luftschiffhafen. Zwischen der heutigen Venloer Straße
und dem Ossendorfer Weg wird eine Luftschiffhalle errichtet. Die Bauausführung
wird dem Werk Gustavsburg in Mainz, der Maschinenfabrik und Brückenbauanstalt
„Augsburg-Nürnberg AG“,[81] die in der Anlage von
Luftschiffhallen bereits Erfahrung vorweisen kann,[82] sowie dem in
Köln-Ehrenfeld ansässigen Bauunternehmer Stephan Pöttgen übertragen.[83] In unmittelbarer Nähe zur
Halle werden Gebäude für Mannschaften und Werkstätten angelegt. Im Zuge der
Baumaßnahmen am Luftschiffhafen wird in Köln-Ehrenfeld eine
Wasserstoff-Gasanstalt der städtischen Gaswerke errichtet, die der Betankung
des Luftschiffes dient.
Die Luftschiffhalle
des Kölner Luftschiffhafens ist als eine ‘Fahrt- bzw. Bergungshalle’
konzipiert. Sie entspricht im Hallengrundriss und Typ einer sog.
‘feststehenden, ortsfesten, einschiffigen Längshalle’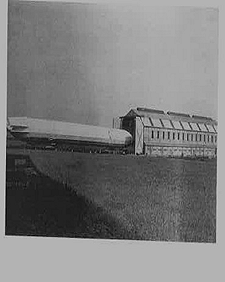 und weist eine einzelne
Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an
beiden Giebeln mit Toren versehen“[84] sein sollte. Dass sich die Militärs für diesen
Hallentypus entscheiden, läßt sich folgendermaßen begründen: Der Bau von
Längshallen gestaltet sich im Vergleich zu dem „aller anderen Hallen am
einfachsten und billigsten. Die Längshalle ist daher die gebräuchlichste und
üblichste Form der Luftschiffhalle.“[85] und weist eine einzelne
Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an
beiden Giebeln mit Toren versehen“[84] sein sollte. Dass sich die Militärs für diesen
Hallentypus entscheiden, läßt sich folgendermaßen begründen: Der Bau von
Längshallen gestaltet sich im Vergleich zu dem „aller anderen Hallen am
einfachsten und billigsten. Die Längshalle ist daher die gebräuchlichste und
üblichste Form der Luftschiffhalle.“[85]
Die Gebäude des
Luftschiffhafens lassen sich zusammenfassend wie folgt beschreiben: Im Äußeren
stellt sich die Luftschiffhalle als ein langgestreckter, längsrechteckiger
Baukörper dar. Er ist 152 m lang und 50 m breit, die Hallenöffnung weist eine
lichte Höhe von 27,5 m auf. Jeweils an beiden Seiten verlaufen entlang der
gesamten Hallenlänge niedrige, seitliche Anbauten mit Pultdach. Als Belichtung
dieses Hallenbereiches, in dem sich ein Teil der Werkstätten befindet, dienen
zwei- und dreiteilige Fenster mit oberen runden Abschlüssen; über Flügeltüren,
ebenfalls rundbogig, ist der Zutritt in die Halle möglich. In die Seitenwände
und die Dachschrägen (des überhöhten Hallenbereiches) der eigentlichen Halle
sind große, rechteckige Fenster eingeschnitten. Der Dachabschluß ähnelt der
Form eines Mansardengiebels. Entlang des Dachfirstes sind in drei Segmenten
dreiecksförmige Dachaufbauten als Oberlichter eingezogen.[86]
Die Halle besitzt
eine Eisenfachkonstruktion als Träger mit dem Vorteil einer insgesamt
geringeren äußeren Abmessung gegenüber Hallen aus Holz oder Eisenbeton und
einer kleineren Windangriffsfläche. Die Hallenverkleidung besteht aus großen,
miteinander verbundenen Metallbahnen.
Das Hallentor ist ein
kombiniertes Schwenk- und Drehtor, d. h. Falt-Drehtor[87], das über Führungsrollen
beweglich in ein rechteckiges Stahlgerüst vor der Halle eingesetzt ist. Bei der
Kombination von einer inneren Schwenk- und einer äußeren Drehtortafel handelt
es sich um eine technisch anspruchsvolle Konstruktion. Der Antrieb des
Hallentor-Mechanismus erfolgt ausschließlich unten an der Innenseite des
Drehtors, das Schwenktor läuft von selbst mit. Das durchfahrende Luftschiff
erhält dadurch ausreichenden Windschutz. Somit wird die wichtigste Aufgabe,
„die Hallen in kurzer Zeit für die Ein- und Ausfahrt eines Luftschiffes zu
öffnen und wieder zu schließen“[88] gelöst.
Um das gesamte
Bauensemble des Luftschiffhafens verläuft als räumliche Trennung vom
umliegenden Gelände eine Umfriedung in Form einer Mauer. Da dem Luftschiff nur
eine Hallenöffnung zur Ein- und Ausfahrt zur Verfügung steht, wird in ca. einem
Kilometer Entfernung zur Halle eine Vorrichtung zur Verankerung des
Luftschiffes installiert; so kann bei ungünstiger Wetterlage das Schiff
zunächst dort angelegt werden, um es anschließend in die Halle einzufahren. Im August 1909 wird
der „Reichsluftschiffhafen Cöln“[89] eröffnet und als
Zeppelinlandeplatz für militärische Zwecke genutzt. Dem Vorauskommando
des Luftschiffer-Bataillons Nr. 1, welches nun im Kölner Reichsluftschiffhafen
stationiert ist, folgen zwei Jahre später weitere Einheiten. Am 1. Oktober 1911
wird sowohl der Sitz des Stabes als auch die 1. Kompanie des neu gebildeten
Luftschiffer-Bataillons Nr. 3 in die Domstadt verlegt. Die Einheit wird
vorläufig bei Bocklemünd, in Fort IV des preußischen Festungsrings um Köln,
untergebracht.[90]
In den folgenden Jahren entsteht an der Frohnstraße 190 in Köln-Ossendorf eine
Luftschiffer-Kaserne. Viele Luftschiffer treten dem CCfL als aktive Mitglieder
bei. Zwischen dem Luftschiffer-Bataillon und dem Kölner Verein werden bald enge
Kontakte geknüpft, wodurch bereits in frühen Jahren „eine erfolgreiche
zivil-militärische Zusammenarbeit praktiziert“[91] wird. Die freundschaftliche
Zusammenarbeit hat für den Verein beispielsweise den Vorzug, dass die
CCfL-Ballone kostenlos mit dem aus dem Luftschiff abgelassenen Leuchtgas
gefüllt werden dürfen.
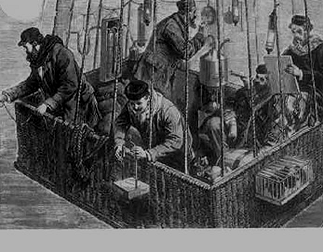 Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“[92]
Zwischen 1909 und
1912 finden in Köln von Frühjahr bis Herbst Luftschiff-Manöver statt.[93] Beteiligt sind neben den
Zeppelin-Luftschiffen, die der starren Bauweise zugeordnet sind, auch die
halbstarren Luftschiffe von Major Hans Gross mit der Bezeichnung ‘M’ sowie die
unstarren Prall-Luftschiffe mit der Bezeichnung ‘P’, die von Major August von
Parseval konstruiert wurden.[94] Ziel dieser Manöver ist
die feldmäßige Erprobung der Militär-Luftschiffe aller drei Konstruktionsarten;
vor allem geht es um die Feststellung der erreichbaren Maximal-Höhe. Beobachtet
werden die Testfahrten von Abgesandten der militärischen Kommission der
preußischen Heeresverwaltung. Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“[92]
Zwischen 1909 und
1912 finden in Köln von Frühjahr bis Herbst Luftschiff-Manöver statt.[93] Beteiligt sind neben den
Zeppelin-Luftschiffen, die der starren Bauweise zugeordnet sind, auch die
halbstarren Luftschiffe von Major Hans Gross mit der Bezeichnung ‘M’ sowie die
unstarren Prall-Luftschiffe mit der Bezeichnung ‘P’, die von Major August von
Parseval konstruiert wurden.[94] Ziel dieser Manöver ist
die feldmäßige Erprobung der Militär-Luftschiffe aller drei Konstruktionsarten;
vor allem geht es um die Feststellung der erreichbaren Maximal-Höhe. Beobachtet
werden die Testfahrten von Abgesandten der militärischen Kommission der
preußischen Heeresverwaltung.
Eines der größten
Luftschiff-Manöver erlebt Köln vom 25. Oktober bis zum 20. November 1909.[95] Die drei
Militär-Luftschiffe ‘Z II’, ‘M II’ und ‘P II’ sowie das Privatluftschiff ‘P
III’ absolvieren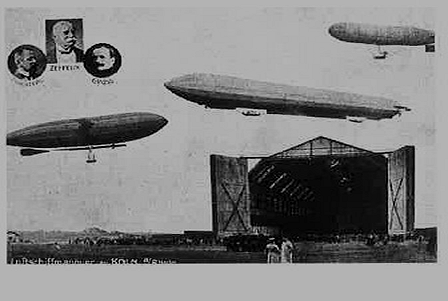 Fahrten unterschiedlichster Art: Geschwindigkeits-, Tief- und
Höhenfahrten sowie Formations-, Staffel und Nachtfahrten. Während der gesamten
Dauer des Manövers ist die Luftschiffhalle in Köln-Bickendorf von Zuschauern
und Berichterstattern in- und ausländischer Zeitungen umlagert. Die letzten
Manöverfahrten aller vier Luftschiffe zusammen finden am 6. November 1909 über
Köln statt. Fahrten unterschiedlichster Art: Geschwindigkeits-, Tief- und
Höhenfahrten sowie Formations-, Staffel und Nachtfahrten. Während der gesamten
Dauer des Manövers ist die Luftschiffhalle in Köln-Bickendorf von Zuschauern
und Berichterstattern in- und ausländischer Zeitungen umlagert. Die letzten
Manöverfahrten aller vier Luftschiffe zusammen finden am 6. November 1909 über
Köln statt.
Die Frühjahrsmanöver des Jahres 1910 beginnen am 7.
April. Außer den Militär-Luftschiffen ‘Z II‘, ‘M II’ und ‘P II’ nehmen an den
Erprobungsfahrten auch das Kölner Luftschiff ‘Clouth’ sowie das Luftschiff
‘Erbslöh’ aus Leichlingen als Gäste teil. Im Verlauf des Manövers strandet ‘Z
II’ führerlos am 24. April 1910 nahe Weilburg a. d. Lahn und wird durch einen
Sturm am Boden zerstört. Es hatte sich tags zuvor aus seiner Verankerung
gerissen. Die dadurch entstandenen Schäden am Luftschiff sind irreparabel; nach
insgesamt 16 Fahrten (2478 km) wird ‘Z II’ abgewrackt.[96]
Am 23. November 1911 erreicht das von Graf Zeppelin
persönlich von Friedrichshafen nach Köln überführte (Ersatz-)Luftschiff ‘Z II’[97] (LZ 9) die Domstadt. Das
Luftschiff trifft mit erheblicher Verspätung zu dem schon seit Anfang November
stattfindenden Luftschiff-Manöver ein. Die Militärs sind von den bisherigen
Ergebnissen des Manövers, an dem u. a. auch das Militär-Luftschiff ‘M II’
teilnimmt, enttäuscht. Auch die Hoffnung, dass sich durch die Teilnahme von
‘(Ersatz-)Z II’ die Luftschiff-Manöver besser entwickeln würden, wird aufgrund
der schlechten Witterung nicht erfüllt; das Manöver endet Anfang Dezember. Nach
Meinung der Militärs stehen die Erfolge in keinem Verhältnis zu den
Erwartungen. Das Luftschiff ‘(Ersatz-)Z II’ bleibt nach Abschluss des
Luftschiff-Manövers in der Festungsstadt Köln stationiert.
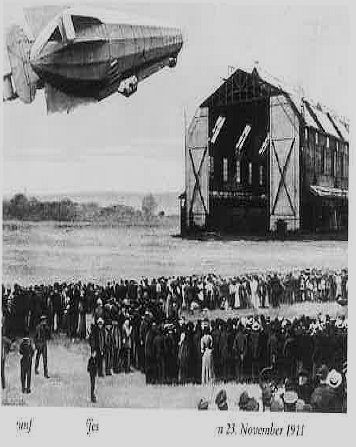 Der Status der
Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen
Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.[98] Hintergrund des Verbotes
ist die Befürchtung, dass durch feindliche Agenten das Gelände ausspioniert
werden könnte. So muss z. B. das Luftschiff ‘Ersatz-Deutschland’ (LZ8) auf
seiner Fahrt nach Düsseldorf am 12. April 1911 die Festungsstadt Köln meiden.
Den Zeppelin-Passagierluftschiffen ist ein Überfliegen sowie eine Landung
innerhalb der Festungsgrenzen der Stadt nicht gestattet; Köln ist somit aus den
neuen Linien des Luftschiff-Verkehrs der DELAG ausgeschlossen.[99] Die Gefahr, dass sich
aufgrund dieses Verbotes auch der CCfL auflösen müsse, besteht hingegen nicht.
Der Festungsgouverneur macht den Mitgliedern des CCfL ein großes Zugeständnis:
Auch weiterhin seien Aufstiege im Freiballon und im Flugzeug innerhalb des
Festungsbereiches Köln erlaubt.[100] Somit bleibt zumindest
für die Mitglieder des CCfL die Ausübung des Luftsportes innerhalb der Domstadt
gewährleistet. Für Privatpiloten bzw. Gesellschaften, die die Fliegerei
geschäftlich betreiben, gilt diese Ausnahme jedoch nicht. Der Status der
Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen
Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.[98] Hintergrund des Verbotes
ist die Befürchtung, dass durch feindliche Agenten das Gelände ausspioniert
werden könnte. So muss z. B. das Luftschiff ‘Ersatz-Deutschland’ (LZ8) auf
seiner Fahrt nach Düsseldorf am 12. April 1911 die Festungsstadt Köln meiden.
Den Zeppelin-Passagierluftschiffen ist ein Überfliegen sowie eine Landung
innerhalb der Festungsgrenzen der Stadt nicht gestattet; Köln ist somit aus den
neuen Linien des Luftschiff-Verkehrs der DELAG ausgeschlossen.[99] Die Gefahr, dass sich
aufgrund dieses Verbotes auch der CCfL auflösen müsse, besteht hingegen nicht.
Der Festungsgouverneur macht den Mitgliedern des CCfL ein großes Zugeständnis:
Auch weiterhin seien Aufstiege im Freiballon und im Flugzeug innerhalb des
Festungsbereiches Köln erlaubt.[100] Somit bleibt zumindest
für die Mitglieder des CCfL die Ausübung des Luftsportes innerhalb der Domstadt
gewährleistet. Für Privatpiloten bzw. Gesellschaften, die die Fliegerei
geschäftlich betreiben, gilt diese Ausnahme jedoch nicht.
Im Verlauf der Jahre 1911/12 erkennt die deutsche
Militärführung die unzureichende Wirksamkeit der Luftschiffe als Waffe bei der
Luftkriegsführung: „Nach dem heutigen Stande werden Luftschiffe im Kriege der
Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der
Aufklärung.“[101]
Anfang 1912 entschließt sich das Kriegsministerium zu einem beschleunigten
Aufbau der Heeresfliegertruppe. Mit einer „Nationalflugspende“ werden die
deutschen Bürger aufgerufen, die Entwicklung des Flugzeuges finanziell zu
unterstützen. Stande werden Luftschiffe im Kriege der
Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der
Aufklärung.“[101]
Anfang 1912 entschließt sich das Kriegsministerium zu einem beschleunigten
Aufbau der Heeresfliegertruppe. Mit einer „Nationalflugspende“ werden die
deutschen Bürger aufgerufen, die Entwicklung des Flugzeuges finanziell zu
unterstützen.
Die Kölner Militärverwaltung sieht von 1911 an von der
Anlage eines zivilen Flughafens ab und verfolgt – entsprechend den Plänen des
Kriegsministeriums – den Aufbau einer militärischen Fliegerstation.[102] 1912 wird zwischen der
Stadt Köln und dem Reichsfiskus ein Vertrag abgeschlossen, der die Verpachtung
und militärische Nutzung eines Geländes am Butzweiler Hof auf 20 Jahre
festgelegt. Das Gelände „liegt besonders günstig, da es unmittelbar an die in Ossendorf erbaute Militärluftschiffhalle … grenzt.“[103] Das Militär übernimmt
die Anlage des Rollfeldes und die Errichtung der Flugplatzanlagen; die Stadt
sichert die Schaffung einer Straßenbahnverbindung zu. Um nicht eine zivile
Nutzung des Geländes vollends auszuschließen, regt der CCfL an, im
Einverständnis mit dem Kommandeur der Fliegerstation, Flugveranstaltungen auf
dem Platz durchführen zu können.[104]
Am 15. September 1912
wird der Grundstein zur militärischen Fliegerstation „Butzweiler Hof“ gelegt.
Das militärische Vorkommando, welches am 1. Dezember 1912 bezeichnenderweise
ohne Flugzeuge in Köln eintrifft, beginnt mit den ersten Arbeiten für die
Anlage und Errichtung einer militärischen Fliegerstation.[105
III.
Schlußbemerkung
Das zeithistorische
Phänomen von der Eroberung des Luftraumes lässt sich anhand der frühen Kölner
Luftfahrtgeschichte anschaulich verdeutlichen; es erweist sich als sehr
vielseitig, so lassen sich die unterschiedlichen Facetten des Ballons z. B. als
Attraktion sowie als Sportgerät dabei wiederfinden; später ist es der Einsatz
der Luftschiffe für militärische Zwecke sowie der Beginn der Motorfliegerei.
Noch im 18. Jh., nur wenige Jahre nach dem erfolgreichen Start einer
Montgolfiere, ist in Köln der Aufstieg eines bemannten Ballons nachweisbar: Am
29. Juni 1795 wird von französischen Truppen ein militärischer
Beobachtungsballon vor den Toren der Stadt aufgelassen.
Im Verlauf des 19.
Jhs. finden zahlreiche Ballonaufstiege in der Domstadt statt, so u. a. von den
Luftschiffern Sinval und Guerin 1808 und 1847 von dem berühmten Ballonfahrer
Charles Green. In diesem Zeitraum sind es – entsprechend der Stellung ihrer
Nationen innerhalb der allgemeinen Ballongeschichte – vorwiegend Franzosen und
Engländer, die die Domstadt besuchen und Ballonaufstiege vorführen.
Spektakuläre Ballonaufstiege finden zum Ende des 19. Jhs. im sog. „Goldenen
Eck“ in Köln-Riehl statt. Der Aeronaut Maximilian Wolff führt dort als ständige
Attraktion Ballonfahrten mit Passagieren zu gewerblichen Zwecken durch.
Der um die
Jahrhundertwende 19./20. Jh. einsetzende Wandel des Ballons vom reinen
Schauobjekt mit Volksfestcharakter zum Sportgerät einer exklusiven
Gesellschaftsgruppe vollzieht sich in Köln wahrnehmbar am 6. November 1906 mit
der Gründung des „Cölner Aero-Club“, dem späteren „Cölner Club für Luftschiffahrt
e. V.“ (CCfL). Damit wird der Grundstein für die Entwicklung des Luftsportes
innerhalb der Rheinmetropole gelegt.
Darüber hinaus gehen von Köln wichtige Impulse für die Entwicklung
der Ballon- und Zeppelintechnik aus: die Kölner Firma Clouth entwickelt 1907
ein lenkbares, motorgetriebenes Luftschiff. Die in diesem Zusammenhang
errichtete Luftschiffhalle kann gleichzeitig als die erste
Luftverkehrsarchitektur in Köln angesehen werden.
Das Jahr 1909 bildet
mit der „Internationalen Ballonwettfahrt“ und der „Internationalen Flugwoche“
Höhepunkte innerhalb der Anfänge der Kölner Luftfahrtgeschichte. In diesem Jahr
können die Kölner Bürger erstmals Flugzeuge im Rahmen einer derartigen
Veranstaltung erleben und bewundern. Austragungsorte Kölner Luftsportaktivitäten
sind anfangs das Gelände des heutigen Aachener Weihers sowie die Pferderennbahn
im heutigen Köln-Weidenpesch.
Im selben Jahr münden
in der Festungsstadt Köln die militärischen Interessen an der Luftfahrt in der
Gründung und Anlage eines Luftschiffhafens in Köln-Bickendorf sowie der
Stationierung eines Militär-Luftschiffes. Die dabei errichtete Luftschiffhalle
zählt zu den allerersten baulichen Zeugnissen einer Luftverkehrsarchitektur im
Kölner Stadtgebiet und ist gleichzeitig eine durchaus bemerkenswerte
Ingenieurleistung dieser Zeit.
In den folgenden
Jahren wird Köln Ort von zahlreichen Luftschiff-Manövern. Obwohl der
Festungscharakter der Stadt eine weitere Expansion des städtischen Luftsportes
durch Überflugs- und Fotografierverbote eher bremst, besteht auf diesem Gebiet
eine zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen dem CCfL und dem stationierten
Luftschiffer-Bataillon; eine Einbeziehung Kölns in ein nationales
Luftschiff-Verkehrsnetz wird aufgrund der militärischen Bestimmungen
verhindert.
1912 ist das Jahr der
Grundsteinlegung für die militärische Fliegerstation „Butzweiler Hof“ und
gleichzeitig die Ausgangsbasis für alle weiteren fliegerischen Ambitionen in
Köln.Zusammenfassend ist
festzustellen, dass die Ereignisse der frühen Jahre Kölner Aviatik auch im
Hinblick auf die allgemeine Luftfahrt aufschlussreich sind. Die hier
angeführten Geschehnisse der zivilen und militärischen Luftfahrt in Köln
dokumentieren gewiss nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der allgemeinen
deutschen Luftfahrtgeschichte. Sie haben aber sehr wohl repräsentativen
Charakter, denn an ihnen lassen sich die Entwicklungen der allgemeinen
Luftfahrt in Deutschland bis zum Beginn des 20. Jhs. nachvollziehen.
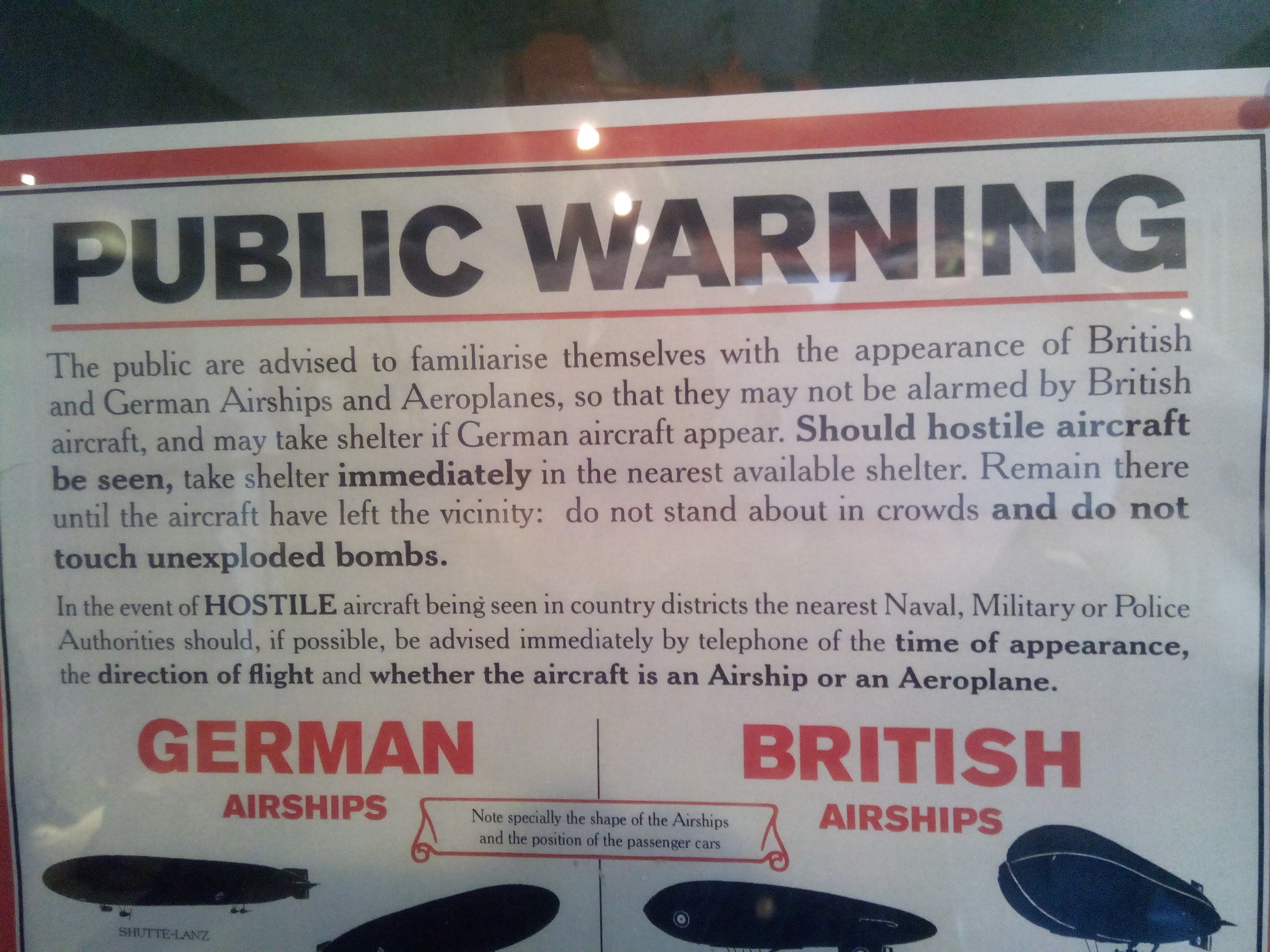 Konsequenterweise
stellt sich letztlich natürlich die Frage, warum die Luftschifffahrt nicht mehr
weiter ausgebaut wurde, obwohl sie heute gerade eine Wiederbelebung erlebt, die
mit wesentlich moderner konstruierten Luftschiffen erneut Erfolgsaussichten für
den Einsatz von Luftschiffen mit sich bringt. Auch stellt sich die Frage, warum
nach dem ersten Luftschiff nach dem Konsequenterweise
stellt sich letztlich natürlich die Frage, warum die Luftschifffahrt nicht mehr
weiter ausgebaut wurde, obwohl sie heute gerade eine Wiederbelebung erlebt, die
mit wesentlich moderner konstruierten Luftschiffen erneut Erfolgsaussichten für
den Einsatz von Luftschiffen mit sich bringt. Auch stellt sich die Frage, warum
nach dem ersten Luftschiff nach dem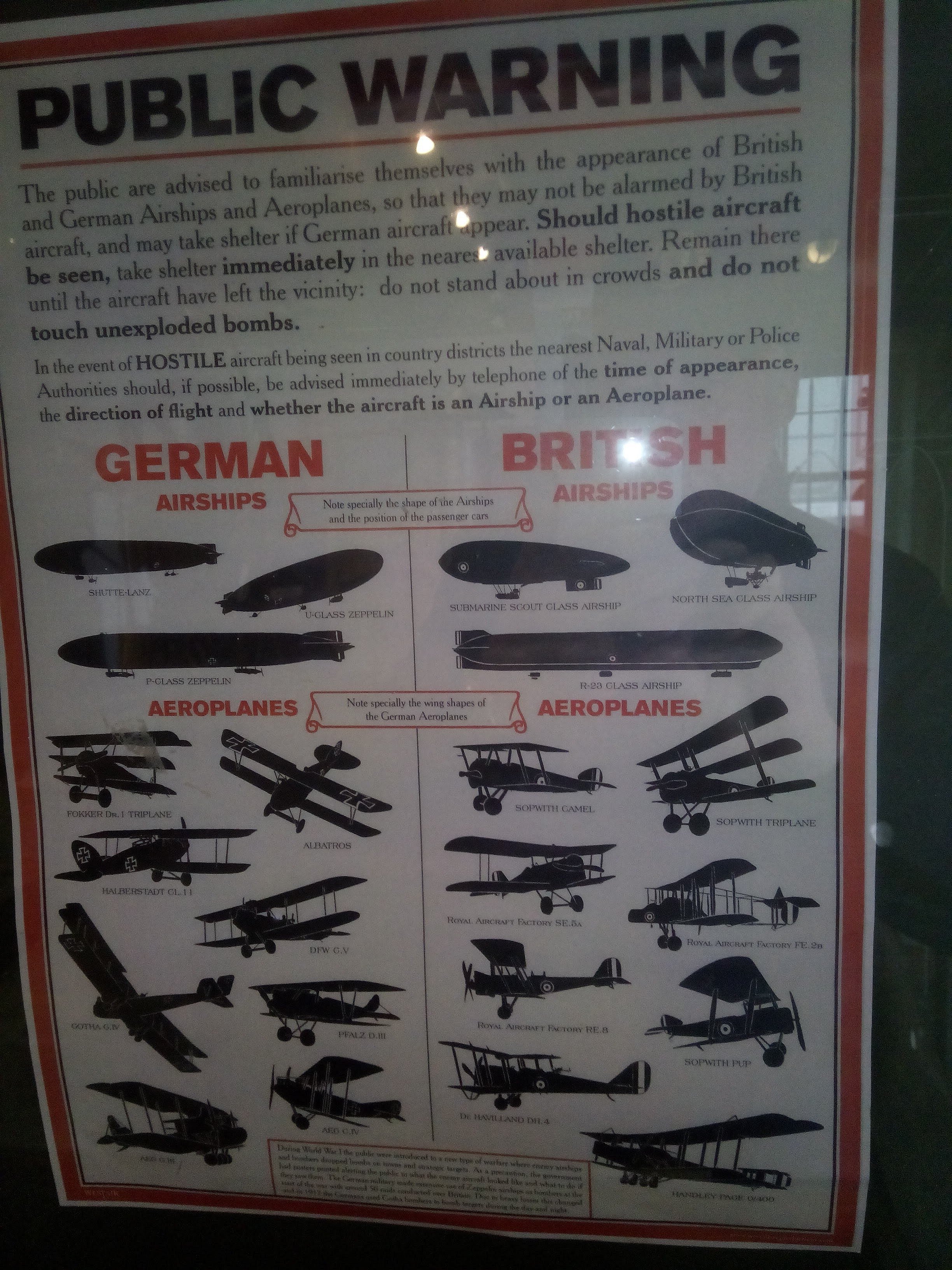 Tode von Franz Clouth nicht dass ursprünglich vorgesehene Luftschiff 2
konstruiert und aufgebaut wurde. Von 1912-1915 verging nicht viel Zeit, dem
vorausschauenden Kaufmann der damaligen Zeit, nach dem Tode von Franz Clouth
sein ältester Sohn Max, blieb der heraufziehende Modernisierungsschub in Bezug
auf Flugzeuge nicht unerkannt. Letztlich hatten sich dieses bereits bei der
Veranstaltung in Köln im Jahre 1909/1910 angedeutet und war sicherlich auch von
dem Militär als interessiertem Einkäufer angesprochen worden, weil diese für
vorgesehene Luftkämpfe wendiger und auch ansonsten beweglicher als die
Luftschiffe waren.
Tode von Franz Clouth nicht dass ursprünglich vorgesehene Luftschiff 2
konstruiert und aufgebaut wurde. Von 1912-1915 verging nicht viel Zeit, dem
vorausschauenden Kaufmann der damaligen Zeit, nach dem Tode von Franz Clouth
sein ältester Sohn Max, blieb der heraufziehende Modernisierungsschub in Bezug
auf Flugzeuge nicht unerkannt. Letztlich hatten sich dieses bereits bei der
Veranstaltung in Köln im Jahre 1909/1910 angedeutet und war sicherlich auch von
dem Militär als interessiertem Einkäufer angesprochen worden, weil diese für
vorgesehene Luftkämpfe wendiger und auch ansonsten beweglicher als die
Luftschiffe waren.
Das endgültige Aus
dürfte damals mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges 1915 gekommen sein. Hier
hatten die Luftschiffe noch erhöhte militärische Einsatzbereitschaft, es zeigte
sich aber schnell, dass für derartige Einsätze keine Zukunft mehr abzusehen war.
Dies war jedoch erst im Rahmen der verschiedenen Kampfhandlungen im Ersten
Weltkrieg um Anfang 1915 zunächst so nicht abzusehen, wurde dann aber rasch im
Rahmen von Kampfhandlungen mit England offenkundig.
Deutschland hatte
damals Anfang 1915 fünf Luftschiffe nach England zur Bombardierung in den
Kriegseinsatz geschickt, diese hatten auch mit Erfolg London, insbesondere
das Londoner Westend,
bombardiert und sich auch ansonsten auf den britischen Nord Osten konzentriert,
wo insbesondere in Nachfolge von Armstrong, dem englischen Krupp, die
wesentlichen Produktionsstätten für die Fertigung englischer Kampfmaschinen
bestanden. Der 20-fache Einsatz der Luftschiffe mit 181 Toten kam für die Engländer zunächst völlig
überraschend, weil bis dahin als solches Einsatzmittel unbekannt, weshalb es
auch zunächst keine ernsthaften kampfmilitärischen Antworten damals gab. Ihre
BE2c-Flugzeuge
bestanden nur aus Holz mit Stoffbespannung und führten nur 1 Maschinengewehr mit
sich. Diese Maschinen
starteten erstmals 1912, wurden später
jedoch zwecks Verbesserung ihrer Stabilität von den Engländern im ersten
Weltkrieg modifiziert und trugen seitdem den Spitznamen „Stability Jane“.
Obgleich dieses im Prinzip ein bewundernswertes Flugzeug für friedliche
Aufklärungsflüge aus ihr machte, war sie als Kampfplattform gänzlich
unbrauchbar. Ursprünglich unbewaffnet, zumindest im Jahre 1917, hatte die BE2c
einen Beobachter an Bord, der mit seiner Lewis-Gun für den Schutz der Maschine
sorgen sollte. Da er jedoch im vorderen Cockpit saß, hatte er ein nur begrenztes
Schußfeld. 1915 als "Fokker-Futter" gebrandmarkt, erfuhr die BE2c mit 75
Abschüssen ihre größten Verluste im blutigen April 1915. Im Oktober 1915 kam
es dann 1916 zu einem zweiten Massiv-Angriff durch deutsche Zeppeline, auch diesmal
primär auf London. Diesmal wurde die "Louis
Gun", die 550 Schuß/Minute abgeben konnte, in allen englischen
Flugzeugen eingesetzt. Damit erfolgten die ersten erfolgreichen Abwehrangriffe durch die Engländer, die
 zweifellos
aus den bitteren Erfahrungen des ersten Angriffs gelernt hatten. Man hatte sich
dafür zusätzlich im Bodeneinsatz eine 75 mm Kanone aus Frankreich besorgt, wohl gesagt „eine“, die
aber auch erste Abschusserfolge erzielte. Somit wurden zumindest besser bewaffnete Flugzeuge
eingesetzt, die im September 1916 zwei maßgebliche Abschüsse von deutschen Zeppelinen erzielten und
damit den Deutschen klarmachen sollten, dass aufgrund der Unbeweglichkeit der
Luftschiffe im Vergleich zum Flugzeug Erstere den Kürzeren ziehen würden. Die
Deutschen antworteten mit einem 196 m langen Superluftschiff, geführt durch
Luftkapitän Mathy, dessen Luftgefährt dann mit Leuchtspurmunition abgeschossen
wurde. Er kam bei diesem 15. Luftangriff um. Die
Engländer setzten als effektivere Flugmaschinen künftig den
Typ
Sopwith
Camel-Jäger ein, die in der Folge 15
deutsche Zeppeline erfolgreich vom Himmel
holten,
die Deutschen setzten nach dieser Niederlage in Folge
Gotha G.IV
Flugzeuge als Ersatzkampfgeräte für ihre Zeppeline ein. Als die Deutschen so
erkennen mussten, dass wegen der hohen Beweglichkeit die Zeppeline künftig keine
erfolgreiche Einsatzmöglichkeit mehr angezeigt waren, wurden nach den
erfolgreichen Abwehrmaßnahmen der Engländer die Zeppelinangriffe um 1916 völlig
eingestellt. zweifellos
aus den bitteren Erfahrungen des ersten Angriffs gelernt hatten. Man hatte sich
dafür zusätzlich im Bodeneinsatz eine 75 mm Kanone aus Frankreich besorgt, wohl gesagt „eine“, die
aber auch erste Abschusserfolge erzielte. Somit wurden zumindest besser bewaffnete Flugzeuge
eingesetzt, die im September 1916 zwei maßgebliche Abschüsse von deutschen Zeppelinen erzielten und
damit den Deutschen klarmachen sollten, dass aufgrund der Unbeweglichkeit der
Luftschiffe im Vergleich zum Flugzeug Erstere den Kürzeren ziehen würden. Die
Deutschen antworteten mit einem 196 m langen Superluftschiff, geführt durch
Luftkapitän Mathy, dessen Luftgefährt dann mit Leuchtspurmunition abgeschossen
wurde. Er kam bei diesem 15. Luftangriff um. Die
Engländer setzten als effektivere Flugmaschinen künftig den
Typ
Sopwith
Camel-Jäger ein, die in der Folge 15
deutsche Zeppeline erfolgreich vom Himmel
holten,
die Deutschen setzten nach dieser Niederlage in Folge
Gotha G.IV
Flugzeuge als Ersatzkampfgeräte für ihre Zeppeline ein. Als die Deutschen so
erkennen mussten, dass wegen der hohen Beweglichkeit die Zeppeline künftig keine
erfolgreiche Einsatzmöglichkeit mehr angezeigt waren, wurden nach den
erfolgreichen Abwehrmaßnahmen der Engländer die Zeppelinangriffe um 1916 völlig
eingestellt.
Flugobjektgewebe
blieben damals deshalb kriegerisch gesehen nur für die Fertigung von
Sperr- und
Fesselballonen interessant und weiter genutzt.
Ein Sperr- oder Fesselballon war mit einem
Kabel fest mit dem Boden verbunden, auch in bemannter Form.
In Reihen und in großen Höhen eingesetzt,
diente er zur Behinderung von Fliegerangriffen. Die Kabel der Ballons bildeten
Lufthindernisse, die kein Flugzeug unbeschadet durchfliegen konnte. Sie wurden
auch im Zweiten Weltkrieg noch verwendet, u.a. von Kriegsschiffen. Rammte ein
Flieger das Kabel oder den Ballon, war er für gewöhnlich verloren. Ein beliebter
Trick war, den Ballon unsichtbar in den Wolken schweben zu lassen, so daß die
Flieger ohne Warnung in die Kabel flogen.
Mit anderen Worten: das Militär legte im Grunde genommen fortan keine Werte mehr
auf Zeppelineinsätze für Kampfeinsätze und kaufte deshalb auch keine, vielmehr
immer vermehrter Flugzeuge und Sperrballons. wurden
auch im Zweiten Weltkrieg noch verwendet, u.a. von Kriegsschiffen. Rammte ein
Flieger das Kabel oder den Ballon, war er für gewöhnlich verloren. Ein beliebter
Trick war, den Ballon unsichtbar in den Wolken schweben zu lassen, so daß die
Flieger ohne Warnung in die Kabel flogen.
Mit anderen Worten: das Militär legte im Grunde genommen fortan keine Werte mehr
auf Zeppelineinsätze für Kampfeinsätze und kaufte deshalb auch keine, vielmehr
immer vermehrter Flugzeuge und Sperrballons.
Aus kaufmännischer
Sicht dürfte diese Entwicklung auch Max Clouth klar geworden sein, zumal
offensichtlich die Einkäufe von Zeppelinen damals zurück gegangen sein dürften.
Deshalb wurden auch keine Stoffe mehr direkt für Fremd-Zeppeline bei Clouth gefertigt
und auch kein eigener zweiter Zeppelin,
wohl aber für die Sperrballoneinsätze als neuem Geschäftsfeld.
Wohlgemerkt,
diese Darstellung ist in Bezug auf das Clouth-Werk und dessen Gewebeproduktion
für Ballone eine Mutmaßung, allerdings kaufmännisch anhand der erkennbaren
Fakten zwingend als Ausweichprodukt für eine laufende Gewebe-Produktion geboten
gewesen auf der Grundlage der Erkenntnisse um die riskanten Einsätze der Zeppeline
im Kampf mit gegnerischen
Flugzeugen, wobei letztere für Kampfeinsätze für Jeden erkennbar künftig die besten militärischen
Voraussetzungen boten. So behielt man als Fabrikant durch schnellen Produktionswechsel
jedenfalls seinen Großkunden, das Militär.
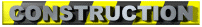
[1]
ECKERT, Alfred: Zur Geschichte der Ballonfahrt. In: Leichter als Luft, 1978, S.
15–133, hier S. 67 (= Ausst.-Kat. Leichter als Luft. Zur Geschichte der
Ballonfahrt. 24.09.–26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte, bearb. von Bernard Korzus. Greven 1978). Eine Ausnahme unter
den deutschen Landesherren ist der wissenschaftlich interessierte Herzog von
Braunschweig. Auf dessen Veranlassung wird ein Gasballon konstruiert, der am
28. Januar 1784 in Braunschweig aufsteigt.
[2]
Vgl. ECKERT (1978), S. 67.
[3]
Vgl. ECKERT (1978), S. 84.
[4]
Vgl. ECKERT (1984), S. 84. Die Rundreise in Deutschland umfaßt insgesamt 10
Städte; weitere Stationen sind u. a.: Hamburg (23. August 1786), Leipzig (29.
September 1787), Nürnberg (12. November 1787), Braunschweig (10. August 1788),
Wien (9. März.1791, mißglückter Start); erst mit Blanchards Abreise nach
Amerika 1792 enden diese Vorstellungen.
[5]
Vgl. MAYER, Edgar, MÜLLER-AHLE, Monika: o. T. - Unveröff. Typoskript. o. D;
SUNTROP, Heribert: Der Butzweilerhof und die Kölner Luftfahrt. Chronik. Eine
Arbeitsgrundlage für die Geschichtsschreibung. Unveröff. Typoskript, Bd. 1.
2001.
[6]
Vgl. HAStK, Best. Ratsprotokolle, Nr. 232; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 2.
[8]
Vgl. MAYER, MÜLLER-AHLE
(o. D.), S. 2.
[9]
Vgl. VOGT, Hans: Seidene Kugel und Fliegende Kiste. Eine Geschichte der
Luftfahrt in Krefeld und am Niederrhein. Krefeld 1993 (= Krefelder Studien, Bd.
7, hrsg. vom Stadtarchiv Krefeld), hier S. 11. Bereits Anfang 1785 erfolgt in
Düsseldorf ein Aufstieg einer Charlière.
[10]
Entweder handelt es sich um einen dreimaligen Aufstieg eines einzigen Ballons
oder um einen einmaligen Aufstieg von insgesamt drei Ballonen. Ob diese
Ballonaufstiege mit oder ohne menschliche Besatzung stattfinden, ist nicht mehr
eindeutig zu klären.
[11] Vgl.
Cölnischer Staatsboth, 13. Junius 1788, 73tes Stuck und 4. Julius 1788, 83tes
Stuck; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 3.
[12]
Deutz ist Bestandteil der Stadterweiterung Kölns von 1888; erst seitdem ist es
Stadtteil der Rheinmetropole.
[13] Die Aussicht
auf wirtschaftlichen Profit durch zahlende Zuschauer scheint die anfänglich
ablehnende Haltung des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten revidiert zu haben.
[14]
Vgl. Rheinischer Merkur, 24. Juli 1911; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 3.
[15] ECKERT (1978), S. 86.
[16] ECKERT (1978), S. 105.
[17] Vgl. Gazette de Française de Cologne, 20.
April 1808, 8. Mai 1808, 14. Mai 1808; Der Verkündiger 24. April 1808,
Nr. 581, 1. Mai. 1808, Nr. 583; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 7.
[18]
Vgl. ECKERT (1984), S. 104; MACKWORTH-PRAED, Ben: Pionierjahre der Luftfahrt.
Stuttgart 1993, hier S. 54. Charles Green (1785-1870) gehört zu den
berühmtesten Ballonfahrern seiner Zeit. Ihm sollen über fünfhundert Aufstiege
gelungen sein. Besondere Verdienste kommen ihm für die Weiterentwicklung des
Ballons durch Einführung des Kohlenstoffgases zu. Green beschränkte sich in
seiner Luftfahrertätigkeit nicht ausschließlich auf Schaufahrten, sondern
verband damit auch wissenschaftliche Ambitionen.
[19]
Vgl. Rheinischer Beobachter, 2. Mai 1847, Nr. 153; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 7.
[20]
Vgl. HStA Düsseldorf, Best. Polizeipräsidium Köln, Nr. 49 (Schreiben von
Gustave Landreau an den Polizeipräsidenten von Köln vom 19. März 1878); MAYER,
MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 7.
[21] Vgl. HOHMANN,
Ulrich: Beiträge zur Geschichte des Ballonsportes in Deutschland. Die Zeit von
1900 bis 1939, Bd. 1 (hrsg. vom Deutschen Freiballonsport-Verband e. V.). o. O.
1993, hier S. 8. Später wird der Verein in „Berliner Verein für Luftschiffahrt
e. V.“ umbenannt.
[22]
Vgl. HStA Düsseldorf, Best. Polizeipräsidium Köln, Nr. 49 (Briefkopf eines
Schreibens bzw. Schreiben von Maximilian Wolff an den Polizeipräsidenten von
Köln, 6. Juni 1889 und 7. Juni 1890); MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 8.
[23]
Der sog. altkölnische Festplatz zwischen Flora und dem zoologischen Garten wird
vom Volksmund wegen der vielen Vergnügungsgärten das „Goldene Dreieck“ genannt.
[24]
Vgl. DIETMAR, Carl: Die Chronik Kölns. Dortmund 1991, hier S. 273. Die
Ausstellung dauert vier Monate an und findet im Vergnügungspark „Kaisergarten“
des „Goldenen Dreiecks“ statt.
[25]
Vgl. Kölner Local-Anzeiger, 11. Juni 1889, Nr. 56; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 9.
[26]
Die Ausstellung dauert vom 16. Mai bis 15. Oktober 1889 an und findet im
heutigen nördlichen Teil des Zoologischen Gartens, in Nähe der Flora, statt.
[27]
Vgl. Kölner Local-Anzeiger, 11. Juni 1889, Nr. 56; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 9.
[28]
Vgl. Kölnische Nachrichten, 9. Juli 1890, Nr. 154; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 10.
[29]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 9; Diese Ereignisse vom 7. Juli 1890 werden in 27
weiteren Zeitungen in ganz Deutschland veröffentlicht.
[30]
Vgl. HStA Düsseldorf, Best. Polizeipräsidium Köln, Nr. 49; MAYER, MÜLLER-AHLE
(o. D.), S. 11.
[31] Vgl. SUNTROP (2001), S. 10.
[32] Vgl. VOGT (1993), S. 24–32.
[34]
Vgl. Rheinisch-Westfälische Zeitung, Nr.1238, 27. Juni 1910; MAYER, MÜLLER-AHLE
(o. D.), S. 8.
[35] Vgl. MACKWORTH-PRAED (1993), S. 83.
[36] Vgl. FRANZ CLOUTH. RHEINISCHE
GUMMIWARENFABRIK AG (Hrsg.): 90 Jahre Franz Clouth. 1862-1952. Köln o. D., hier
S. 13. Die Firma Clouth liefert u. a. 1899 den Ballonstoff für das erste
Luftschiff des Grafen Zeppelin ‘LZ 1’.
[37]
Vgl. FRANZ CLOUTH (o. D.), S. 14. Der Bau besteht mindestens bis 1912. Aus
welchem Material die Halle besteht, ist nicht zu sagen; sie brennt Jahre später
ab.
[38]
Vgl. CLOUTH GmbH, Firmenarchiv, Liste der Zeitungsartikel im Zusammenhang mit
der Brüsselfahrt des Luftschiffes ‘Clouth’ vom 20. Juni 1910. An dieser Stelle
bedankt sich der Autor bei Herrn Wolfgang Beier, der u. a. das Archiv der
„Clouth GmbH“ leitet, für seine Hilfe und zahlreichen Hinweise.
[39]
Vgl. CLOUTH GmbH, Firmenarchiv (Liste der angefertigten Bauteile). Einige
Dokumente im Archiv der Firma „Clouth“ belegen jedoch die Absicht vom Bau eines
zweiten Luftschiffes. Obwohl bereits verschiedene Bauteile angefertigt wurden,
wurde die Konstruktion anschließend nie abgeschlossen.
[40]
Vgl. FRANZ CLOUTH (o. D.), S. 13.
[41]
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 12.
[42]
MACKWORTH-PRAED (1993), S. 51.
[43]
MAYER, Edgar: Glanzlichter der frühen Luftfahrt in Köln. 75 Jahre
Butzweilerhof. Oldenburg 2001 (= Luftfahrtgeschichte von Köln und Bonn, Bd. 1,
hrsg. von der Fördergesellschaft für Luftfahrtgeschichte im Kölner-Raum e. V.),
hier S. 89.
[44]
HOHMANN (1993), S. 12.
[45]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 53. Dort ist eine nach dem jeweiligen Gründungsdatum
chronologisch angeordnete Liste der Vereine (bis 1910) zu finden.
[46]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 11; VOGT (1993), S. 32–36.
[47]
Vgl. KÖLNER KLUB FÜR LUFTSPORT e. V. (Hrsg.): Festschrift zum 75jährigen Bestehen
des Kölner Klub für Luftsport e. V. Köln o. D, hier S. 17.
[48]
Vgl. MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 14; KÖLNER KLUB FÜR LUFTSPORT e. V. (o.
D.), S. 17.
[49]
HOHMANN (1993), S. 12.
[50]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 120/121.
[51]
Vgl. STADE, Hermann (Hrsg.): Jahrbuch des Deutschen Luftschiffer-Verbandes
1911. Berlin 1911, hier S. 150/151.
[52]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 53.
[53]
MAYER (2001), S. 18.
[54]
Preise, jeweils Tageskarte: Korbplatz/Herren 10, Damen 8 und Kinder 4 Mark;
Promenadenplatz/5, 3 und 1,50 Mark; Rasenplatz/alle 0,75 Mark. Der Stundenlohn eines beispielsweise Kohlentransportarbeiters beträgt 0,43
Mark.
[55]
Vgl. Rheinische Zeitung, 22. Juni 1909, Nr. 141 und 26. Juni 1909, Nr. 145;
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 17.
[56]
Vgl. das „Fest-Programm zur grossen internationalen Flug-Woche, Cöln am Rhein
vom 30. September bis 6. Oktober 09“.
[57]
Bisweilen ist auch die Schreibweise mit doppeltem „e“ – „Meerheim“ sowie mit
„h“ – „Mehrheim“ – zu finden.
[58]
Blériots Geschwindigkeitsrekord liegt bei ca. 60 km/h.
[59]
Die erste bedeutende Veranstaltung findet am 23. Mai 1909 auf dem Flugfeld
Port-Aviation, südlich von Paris, statt.
[60]
In Johannisthal, südöstlich von Berlin, werden 1909 bzw. 1908 beispielsweise
von den Pferderennbahnen Holztribünen übernommen; in Brookland/England finden
ab 1909 die Flugschauen unweit der 1907 gebauten Rennstrecke statt.
[61]
GÄRTNER, Ulrike: Flughafenarchitektur der 20er und 30er Jahre in Deutschland.
Diss. Marburg/Lahn 1990, hier S. 11: „Inoffiziell beschäftigte sich aber auch
das deutsche Militär seit 1909 mit der Konstruktion eines Flugzeugs.“
[62]
Eine eingehende Darstellung der Kölner Flugpioniere kann im Rahmen der
vorliegenden Ausführungen nicht geleistet werden. Dazu bedarf es einer
eigenständigen Schilderung, um diesem Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte gerecht
zu werden.
[63]
Die Veranstaltung beinhaltet Preise in Höhe von 100000 Mark, gestiftet von der
Berliner Zeitung/Ullstein-Verlag, sowie Geldpreise des Preußischen
Kriegsministeriums, von Flugsportvereinen, Städten und Gemeinden. Bei dieser
Veranstaltung, bei der nur deutsche Flieger zugelassen sind, werden insgesamt
13 Tagesetappen mit 1854 km zurückgelegt.
[64]
Vgl. DIETMAR (1991), S. 228. Zu Beginn der preußischen Herrschaft wird Köln von
König Friedrich Wilhelm III. zur Festung erklärt.
[65]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 54. Die Stadt beabsichtigt den bestehenden Pachtvertrag
mit dem Landwirt des Butzweiler Hofs zu kündigen, um
das Feld uneingeschränkt für die Fliegerei zur Verfügung zu stellen.
[66]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 60.
[67]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 65.
[68]
Vgl. THIEME, Ulrich, BECKER, Felix: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,
22. Bd. (Krügner-Leitch). Leipzig 1928, S. 377. Bei dem Künstler handelt es
sich vermutlich um Franz Xaver Laporterie (geb. 1754 in Bonn, gest. ?), dem ersten Sohn von Peter Laporterie. Franz Xavers
künstlerische Tätigkeit in Köln - vorwiegend als Stecher - ist dort seit 1780
bezeugt.
[69]
Vgl. HAStK, Best. Franz. Verw., Nr. 5012; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 4.
[70] Vgl. LOCHER,
Walter: Militärische Verwendung des Ballons. In: Leichter als Luft, 1978, S.
238–250, hier S. 238 (= Ausst.-Kat. Leichter als Luft. Zur Geschichte der
Ballonfahrt. 24.09.–26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte, bearb. von Bernard Korzus. Greven 1978).
[71]
LOCHER (1978), S. 243.
[72]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 3. Der „Revue- und Schiessplatz“ Wahner Heide wird im
Frühjahr des Jahres 1817 auf Weisung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm
III. angelegt. In den nachfolgenden Jahren wird der Übungsplatz immer wieder
vergrößert.
[73]
Zur allgemeinen Kennzeichnung der deutschen Luftschiffe: LZ =
Zeppelin-Luftschiff; PL = Parseval-Luftschiff. Militärluftschiffe tragen
zunächst ein „Z“, später zusätzlich ein „L“ vor der Ordnungsnummer.
[74]
Vgl. SCHMITT, Günter: Als die Oldtimer flogen. Die Geschichte des Flugplatzes
Johannisthal. Berlin (DDR) 19872, hier S. 16.
[75]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 18.
[76]
Die Gründung der „Deutschen Luftschiffahrts AG Frankfurt a. M.“ (DELAG) erfolgt
am 16. November 1909.
[77]
ENGBERDING, Dietrich: Luftschiff und Luftschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Berlin 1926, hier S. 239.
[78]
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 28.
[79]
Diese Fahrt ist der dritte Versuch, Köln zu erreichen; am 2. bzw. 4. August
musste ‘LZ 5’ wegen schlechten Wetters bzw. eines technischen Defekts
unfreiwillig die Rückfahrt antreten.
[80]
DIETMAR (1991), S. 313.
[81] Vgl. SONNTAG,
Richard: Über die Entwicklung und den heutigen Stand des deutschen
Luftschiffhallenbaus. In: Zeitschrift für Bauwesen, Heft 62, 1912, S. 571–614,
hier S. 599.
[82]
Ein Wettbewerb, der die Gestaltung einer Luftschiffhalle klären sollte, wurde
im Oktober 1908 in Deutschland ausgeschrieben; der Entwurf der
Brückenbauanstalt „Augsburg-Nürnberg AG“ erhält den dritten Preis.
[83]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 25.
[84]
SONNTAG (1912), S. 574.
[85]
SONNTAG (1912), S. 574.
[86]
Vgl. Endnote 37. Formal ist die Luftschiffhalle in Bickendorf
durchaus mit der Luftschiffhalle der Firma Clouth von 1907 vergleichbar.
[87]
Vgl. SONNTAG (1912), S. 596.
[88]
SONNTAG (1912), S. 582. Die Dauer des Vorgangs ‘Öffnen/Schließen’ einer
Luftschiffhalle mit maschinenbetriebener Hallenöffnung betrug damals ca. 15
Minuten.
[89]
Vgl. VON TSCHUDI, Georg: Luftschiffhäfen, Ankerplätze und Flugplätze. In:
Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift, Nr. 15, Jg. XVI, 1912, S. 361-364, hier S.
362. Eine Auflistung aller bis einschließlich 1912 existierenden
Luftschiffhallen, Flugplätze, Flugfelder und Landungsplätze in Deutschland ist
dort zu finden.
[90] Vgl. SUNTROP (2001), S. 53.
[91] MAYER (2001), S. 15.
[92]
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 22.
[93]
Vgl. MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 22–24.
[94]
Vgl. MACKWORTH-PRAED (1993), S. 140.
[95]
Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger, Nr. 494/495, 28./29. Oktober 1909 sowie Nr.
505–507, 4.–6. November 1909; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 23; SUNTROP (2001),
S. 34.
[96]
Vgl. KNÄUSEL, Hans G. (Hrsg.): Zeppelin. Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Bonn
1988, S. 161.
[97]
Vgl. KNÄUSEL (1988), S. 163. ‘(Ersatz-)Z II’ ist die offizielle
Betriebsbezeichnung des Luftschiffes.
[98]
Vgl. SUNTROP (2001), S.44 u. 52.
[99] Vgl.
Kölner Stadt-Anzeiger, 1. Mai 1912, Nr. 199; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 30.
[100]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 49. Die Erlaubnis ist an die Bedingung geknüpft, dass
fotografische Apparate nicht mitgeführt werden dürfen. Zudem muss zu jedem
Aufstieg ein Vorstandsmitglied des CCfL anwesend sein.
[101]
VON KLEIST, Ewald: Militär und Luftschiffahrt. In: Wir Luftschiffer, 1909, S.
285–306, hier S. 306.
[102]
Vgl. VON TSCHUDI (1912) S. 362/363. Im Jahr 1911 sind bereits in u. a. in
Straßburg und Metz Militär-Fliegerstationen errichtet worden.
[103]
SUNTROP (2001), S. 65.
[104] TÜRK, Oskar:
Der Flughafen Köln in der Geschichte der Kölner Luftfahrt. In: Deutsche
Flughäfen, Heft 6/7, 4. Jg., 1936, S. 7–15, hier S. 10.
[105] Vgl. TÜRK
(1936), S. 10.
Zeitlose Luftfahrt? Wohl kaum,
neue "Flugzeuge" erwiesen sich mehr und mehr als flexibler und moderner.
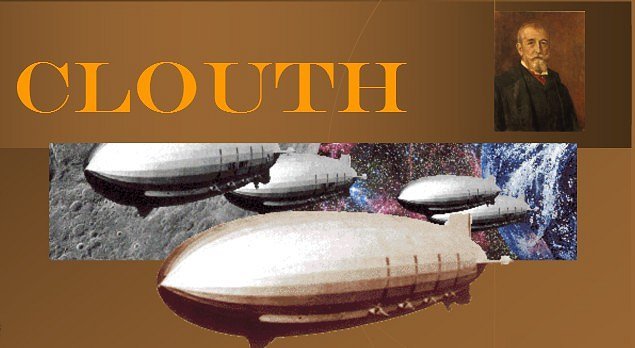
Franz Clouth und Graf Zeppelin
Im Rahmen der Ereignisse 1909-1911 muß
Franz Clouth klar geworden sein, daß als militärisches Kampfobjekt der Zeppelin
für die Zukunft keine große Bedeutung mehr haben werde, allenthalben zum Zwecke
der militärischen Aufklärung. Die aufkommenden Flugzeuge, erstmals richtig
bedeutend bereits auf der Kölner Ausstellung 1909 erkennbar, ließen einen
Geschäftsmann wie ihn diese Lage klar erkennen und als Zeppelinfabrikant sicher
nicht mehr gut schlafen. Auch an dem Zeppelintreffen von 1909 war er zumindest
vorarbeitend tätig. Da er völlig unerwartet und ohne Vorzeichen 1910 verstarb,
mag er sich mit den Ereignissen und der Erkennungssorge der aufkommenden
Bedeutung der Flugzeuge übernommen haben, Vieles spricht dafür auch im
Zusammenhang mit dem Verlust der Seekabelproduktion, Details sind aber nicht
überliefert. Die Nichtfertigstellung des lenkbaren Luftschiffes II bekräftgt
darüber hinaus diese Vermutung, denn bereits 1910 beginnt sich die Firma Clouth
deutlichaus dem Bereich der Luftschifffahrt zurückzuziehen.
(Thorsten Krause, Luftfahrtgeschichte von Köln, Pulheimer beiträge Band 26 2002)
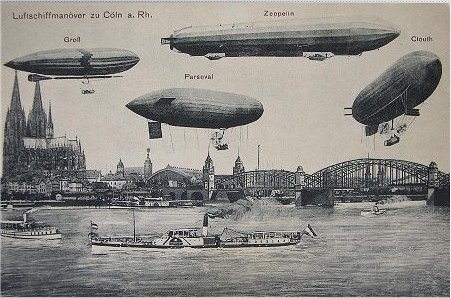
1909 Luftschiff-Riesen-Treffen in Cöln
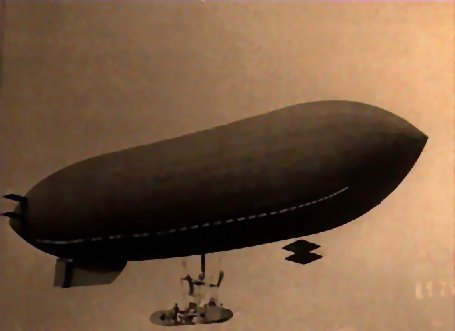
CLOUTH Luftschiff I.
Die ersten
Flugobjekte, die als Ballons oder als Zeppeline erstellt wurden, waren zunächst
völlig windabhängig, Windrichtungen mussten also im Rahmen des Starts mit
einkalkuliert werden, wollte man einen bestimmtes Ziel erreichen.
Lenkungsmöglichkeiten bestanden also nicht. Franz Clouth hatte sich
offensichtlich darüber Gedanken gemacht und zusammen mit seinen Konstrukteuren
das erste lenkbare Luftschiff gebaut, welches immer noch im Grunde
genommen Wind getrieben war, grundsätzlich aber Richtungsänderungen durch
Lenkung ermöglichte. Dies wurde nicht nur durch Seitenruder, vielmehr auch Motor
getrieben möglich.
Die Ballonfabrik
Franz Clouth im Köln baute so ein kleines Luftschiff, welches auf der ILA
(Internationale Luftfschiffahrt-Austellung) in Frankfurt
am Main 1909 zu sehen war.
Es ließ sich schnell
montieren und wieder abbauen, daher schien es auch für militärische Zwecke sehr
brauchbar zu sein. Außer Führer und Maschinisten konnte es vier Personen an Bord
nehmen, sowie Brennstoff für ca. 10 Flugstunden. Von Vereinen und Klubs wurde
dieses Modell gern gekauft.
Das Luftschiff machte
seine Jungfernfahrt zur Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung (ILA) 1909 nach
Frankfurt und bewies seine besondere Manövrierfähigkeit. Dabei leistete es sich
ungewollt das Husarenstück, in die Frankfurter Straßen zu geraten und, ohne etwas
zu beschädigen oder selbst Schaden zu erleiden, zwischen den Häusern hindurch zu
fahren, um sich wieder in stolze Höhen zu erheben. Wegen dieser eleganten
Leistung nannte man das Clouth'sche Luftschiff die "Familienkutsche der Zukunft".

Ballonfahrer Richard
Clouth
(im Korb links)
Abfahrt Köln Notlandung in den Straßen Frankfurts auf Weg zur ILA
 Groß war auch das Erstaunen, als
das von Hauptmann von Kleist gesteuerte Luftschiff und angemeldet am 21. Juni
1910 auf der Internationalen Industrieausstellung in Brüssel erschien. Für die
200 Kilometer lange Strecke hatte es fünf Stunden benötigt. Die Brüsseler und
viele andere ausländische Blätter würdigten das Ereignis in ausführlichen
Artikeln. Im Jahre 1910 wurde die Abteilung " Luftschiff-Bau " mit der
Luftfahrzeuggesellschaft mbH. in Berlin vereinigt, nachdem Clouth noch ein
zweites lenkbares Luftschiff nachdem halbstarren System "Parseval gebaut hatte.
Beide Luftschiff gingen in den Besitz der Berliner Gesellschaft über. Goldene
Medaillen sind die bis heute noch verbliebenen Auszeichnungen für die Erfolge,
die Clouth in der Luftschiff errang Groß war auch das Erstaunen, als
das von Hauptmann von Kleist gesteuerte Luftschiff und angemeldet am 21. Juni
1910 auf der Internationalen Industrieausstellung in Brüssel erschien. Für die
200 Kilometer lange Strecke hatte es fünf Stunden benötigt. Die Brüsseler und
viele andere ausländische Blätter würdigten das Ereignis in ausführlichen
Artikeln. Im Jahre 1910 wurde die Abteilung " Luftschiff-Bau " mit der
Luftfahrzeuggesellschaft mbH. in Berlin vereinigt, nachdem Clouth noch ein
zweites lenkbares Luftschiff nachdem halbstarren System "Parseval gebaut hatte.
Beide Luftschiff gingen in den Besitz der Berliner Gesellschaft über. Goldene
Medaillen sind die bis heute noch verbliebenen Auszeichnungen für die Erfolge,
die Clouth in der Luftschiff errang
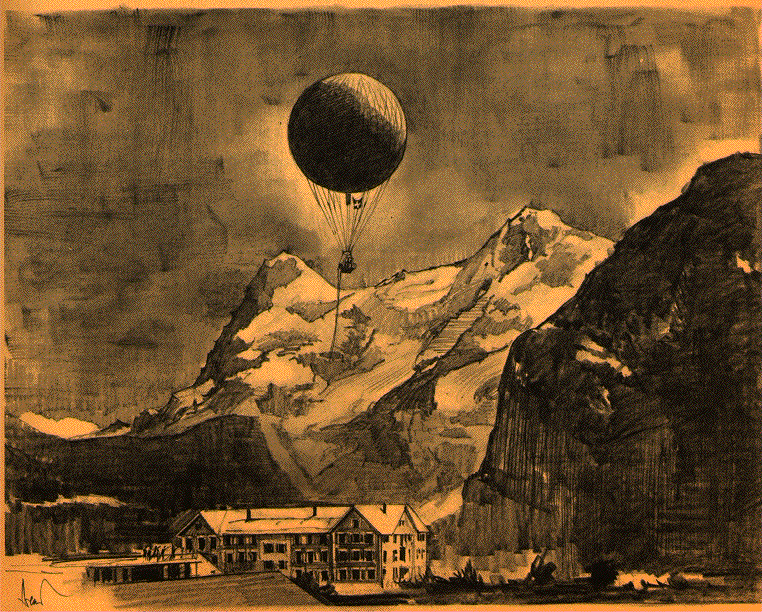
Erste Alpenüberquerung eines
Fesselballons durch Fesselballon "Sirius" von Clouth
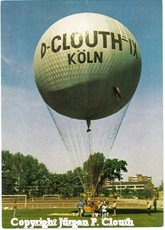

CLOUTH IX
.jpg)
CLOUTH IX
In der Tagespolitik wird von vielen
unterstellt, dass es sich bei Flugfahrt-Ballons und Zeppelinen um Altfahrzeuge
handelt, die historisch überholt sind. Dies ist jedoch ein grundlegender Irrtum,
da diese Luftfahrtgeräte nach wie vor erhebliche Vorteile bieten.
Im Rahmen der
technischen Entwicklung
ist heute technisch natürlich viel mehr möglich, als zu damaligen Zeiten,
außerdem ist der Erfahrungsschatz in der Erstellung und dem Betrieb von
Luftfahrtgeräten wesentlich vergrößert worden.
Der
Fortschritt der Moderne
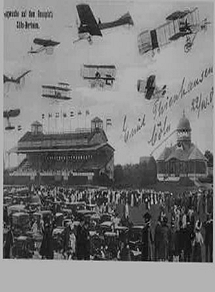
Postkarte von Flugwoche auf dem
Rennbahnplatz Cöln Mehrheim von 1909
Franz Clouth, der 1909 verstarb, hat
vielleicht nicht die richtigen Schlussfolgerungen aus weiteren Veranstaltungen
gezogen, es war wohl eher sein die Geschäfte übernehmen der Sohn Max Clouth. Die
Veranstaltung auf dem Rennbahnplatz in Cöln Mehrheimdies für den Kenner klar
erkennen, wohin die Reise, bezogen auf Luftfahrten, hin ging. Vor allem dem
militärischen Beobachter und Besucher zeigte sich die neue Luftfahrt durch
Flugzeuge als wesentlich wendiger, schneller und beherrschbaren bei riskanten
Aktionen.viele Gespräche waren noch zu Zeiten des Zeppelins mit dem Militär
geführt worden, sowohl Franz Clouth als auch der Sohn Max mussten aus diesen in
Erinnerung behalten, worauf es ankam, also auf Eigenschaften des Flugobjekts,
die im Vergleich von Flugzeug zu Zeppelin klar zulasten des Zeppelin
gehen.Insoweit war klar, dass weitere Zeppeline keine Chance mehr hatten. Ein
zweites Luftschiff wurde aller Wahrscheinlichkeit gerade aus diesem Grund nicht
mehr gebaut. Es verblieb also nur das Luftschiff 1.
Luftschiff-Fahrt der Moderne 2017
Die moderne sieht das
wiederum anders, der Zeppelin hat eine ganze Reihe von Vorteilen gerade im
Reisegewerbe, aber auch im militärischen Bereich, wie die neuerliche Entwicklung
zeigt. Interessant sind gerade im militärischen Bereich Zeppeline als behäbiger
Lastenträger in Luftbereichen, die bereits häufig wieder bei großen Baumaßnahmen
in den Höhenbereichen Als behäbige Lastenträgervon Vorteil sind. Ein Überleben
der Luftvehikel dürfte damit gesichert bleiben; sie können "weiterfahren"
(Ballons und Zeppeline fliegen nicht, sie fahren!).
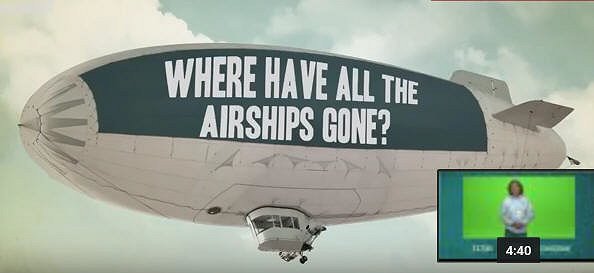
 


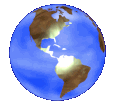
Luftschiffvorteile
 der Moderne
der Moderne


Von Evers, Marco
Kehrt der Zeppelin zurück? Firmen wie der
Rüstungskonzern
Lockheed Martin entwickeln gigantische
Luftschiffe für den Frachttransport.
Lange ist sie her,
die Zeit der großen Luftschiffe. Sie endete spätestens
am 6. Mai 1937, als die 245 Meter lange "Hindenburg" bei
der Landung in den USA explodierte.
Erst um die
Jahrtausendwende fuhr wieder ein Hauch von Leben in die
einst so stolze Branche. Da entwickelte die deutsche
Firma Cargolifter ein Riesenluftschiff für Schwerlasten.
Es sollte stark genug sein, um halbe Bohrinseln von
Ozean zu Ozean zu hieven. Doch schneller als der
Prototyp kam die Pleite; technisch und finanziell hatte
sich das Unternehmen übernommen.
Nun versucht sich
eine Reihe von Nachzüglern an der Cargolifter-Idee.
Sollten sie diesmal Erfolg haben, könnte dies
tatsächlich eine neue Ära der Luftschiffe einläuten:
Lautlose Hightech-Giganten könnten bald Maschinen oder
Container durch die Lüfte fliegen – und zwar sauberer
und billiger als Flugzeuge oder Hubschrauber.
Deutsche
Hersteller sind beim aktuellen Zeppelin-Revival nicht
dabei. Nahe Los Angeles baut die Firma Aeros mit Geld
des amerikanischen Verteidigungsministeriums ein
Flugungetüm von fast 200 Meter Länge, das senkrecht
starten und landen und 66 Tonnen Fracht bewegen soll.
Frühestens in fünf Jahren wird es fertig sein.
In England soll
der Konkurrenzflieger "Airlander 10" schon im kommenden
Frühjahr zu einem Testflug abheben. Auch dieses
Luftschiff wurde einst im Auftrag der US-Streitkräfte
entworfen, fiel dann aber dem Sparwillen zum Opfer. Eine
kleine britische Firma will es mithilfe von Crowdfunding
und Zuschüssen der Europäischen Union vollenden.
Das wohl
aussichtsreichste Luftschiff aber ist die LMH-1 des
US-Rüstungsgiganten Lockheed Martin. Über 20 Jahre
Entwicklungsarbeit stecken in dem Fluggerät, eine
verkleinerte Version ist bereits 2006 auf dem
kalifornischen Firmengelände zu Testflügen gestartet.
Weil das Militär kein Interesse mehr daran hat, sucht
Lockheed zivile Kunden – vor allem unter solchen Firmen,
die weit außerhalb der Zivilisation nach Bodenschätzen
suchen und oft Gerätschaften und Spezialisten tief im
Nirgendwo absetzen müssen, im Norden Kanadas etwa, in
der Arktis oder in unzugänglichen Regionen Afrikas.
"Dieses
Luftschiff", sagt Rob Binns, Chef des LMH-1-Vermarkters
Hybrid Enterprises, "ist das einzige weltweit, für das
bereits das Zulassungsverfahren läuft." Sollte Binns,
51, genügend Käufer finden, könnte sich das erste
Serienmodell bereits Ende nächsten Jahres der
obligatorischen Flugerprobung unterziehen.
Bisher kranken
Luftschiffe daran, dass ihr Auftrieb nur schwer zu
kontrollieren ist. Sie sind angewiesen auf gut
ausgebaute Bodenstationen. Dort müssen sie aufwendig
vertäut werden, weil das Traggas in ihrem Innern sie
permanent nach oben zieht. Wird ihre Fracht entladen,
müssen sie im Gegenzug einen mindestens ebenso schweren
Ballast an Bord nehmen, sonst zischen sie unkontrolliert
gen Himmel. Die Cargolifter-Macher sind auch an dieser
technischen Herausforderung gescheitert.
Die LMH-1
funktioniert auf faszinierende Weise anders, denn dies
wird ein sogenanntes Hybridluftschiff sein. Nur 80
Prozent ihres Auftriebs erhält sie durch das unbrennbare
Helium in ihrer Hülle. 20 Prozent aber gewinnt sie durch
aerodynamische Kräfte, denn die Hülle hat eine
tragflächenartige Wölbung. Sobald das Luftschiff auf
einer kurzen Startbahn mithilfe seiner vier Motoren
Fahrt aufnimmt, hebt es ab wie ein normales Flugzeug.
Wenn die LMH-1
landet – ganz gleich ob auf Sand, Geröll, Wiese, Eis,
Matsch oder selbst Wasser –, setzt sie auf drei
gewaltigen Luftkissen auf, die sie wie ein Hovercraft
auf ihrer Unterseite erzeugt. Auf ihnen schwebt der
Frachter weiter bis zu seiner Parkposition. Dort
aktiviert der Pilot eine Luftstromumkehr: Aus den
Luftkissen werden jetzt Saugnäpfe – Unterdruck hält das
Fluggerät sicher am Platz, selbst auf nicht präparierten
Böden. Zusätzlicher Ballast soll höchstens unter
Volllastbedingungen notwendig sein. All dies, so
versichert Binns, sei "erprobte Technologie" – auch wenn
es nach Raumschiff "Enterprise" klingt.
Verglichen mit
einem Flugzeug gleichen Transportvolumens, stoße das
Luftschiff pro Tonne Fracht und Meile nur ein Drittel
des Treibhausgases CO² aus. Der Lärmpegel eines Jets
liege sogar achtmal höher. "Dieses Ding könnte nachts am
Frankfurter Flughafen landen, und es gäbe keine
Beschwerden", verspricht Binns.
Sollte sich das
Einsteigermodell mit einer Kapazität von 20 Tonnen
Fracht plus 19 Passagieren zum Preis von rund 40
Millionen Dollar bewähren, so will Lockheed Martin mehr
Ehrgeiz wagen. Auf eine Variante von bis zu 90 Tonnen
Traglast würde ein womöglich vollautomatisch fliegendes
Riesenschiff folgen, das 500 Tonnen Fracht aufnehmen
kann – mehr als das Dreifache dessen, was der
Cargolifter leisten sollte.
Dieser Laster der
Lüfte hätte das Zeug, die globalen Verkehrsströme zu
verändern: Binnen drei Tagen könnte er Hunderte Autos
von Deutschland nach China fliegen – bisher verbringt
solche Fracht noch mehr als drei Wochen auf See.
DER
SPIEGEL 44/2015

Einsatzmöglichkeiten bei
Ballonen und
Zeppelinen gibt es gerade heutzutage zahlreichen
Lebensbereichen. Dies nicht nur in zivilen
Einsatzmöglichkeiten, vielmehr auch verstärkt in
militärischen, obwohl Ballone und Luftschiffe
deutlich träger als Flugzeuge und Raketen sind.
Clouthwerke, abgerissen im Jahre 2015 spielen dabei keine Rolle mehr,
gleichwohl doch durch
Conti-Tech, die den Bereich Ballon- und
Luftschiffstoffe als Filetstück aus dem damaligen Erwerb weiter vermarkten.

sog. "Blimp"
(Prall-Luftschiff ohne inneres Gerüst) ohne inneres Gerüst wie die starren Luftschiffe

Luftschiffahrt
1909
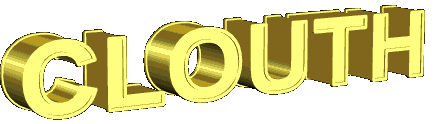
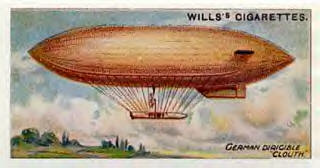
Die
Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis 1912
I.
Einleitung
 In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“[1]
finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“[1]
Die Geschichte der
frühen deutschen Ballonfahrt weist gegenüber dem klassischen Land der
Ballonfahrt Frankreich, wo aerostatische Unternehmungen und Experimente meist
den Höhepunkt von Feierlichkeiten, Gebäudeeinweihungen, Brückeneröffnungen und
Ausstellungen darstellen, nur wenige repräsentative Ereignisse auf. Gleichwohl sind für
das Jahr 1783 bereits Versuche mit unbemannten Ballonen in deutschen Städten
überliefert, so z. B. am 23. Dezember in Darmstadt und am 27. Dezember in
Berlin. Es handelt sich dabei allerdings vermutlich eher um Schauvorstellungen
als um ernsthafte aerostatische Experimente, wie sie z. B. der
Benediktinerpater Ulrich Schiegg mit seinem Heißluftballon in Ottobeuren/Bayern
am 9. und 22. Januar 1784 durchführt.[2]
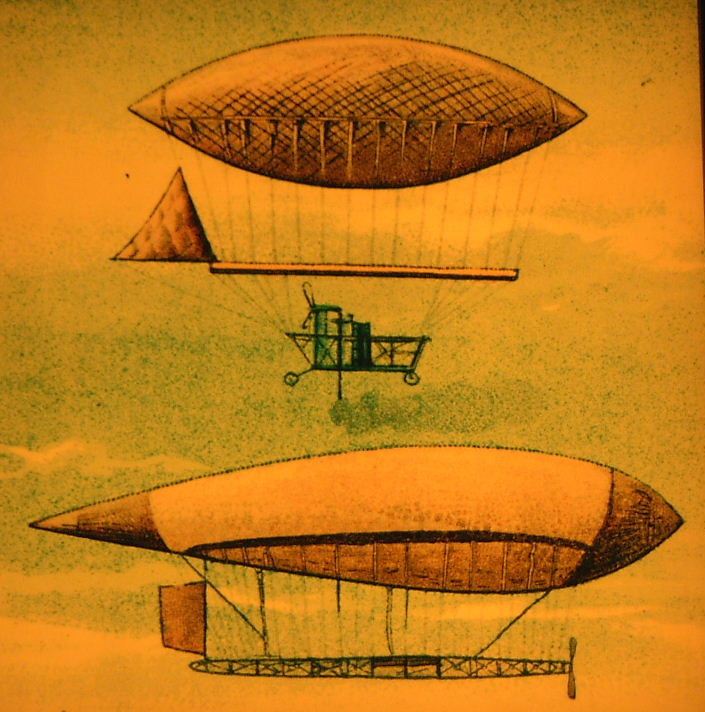 Erst am 3. Oktober
1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in
Deutschland.[3] Der Franzose Jean-Pierre Blanchard
leitet damit eine Reihe von Ballonvorführungen auf deutschem Boden ein und
macht damit die Ballonfahrt auch im Deutschen Reich allgemein bekannt.[4] Erst am 3. Oktober
1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in
Deutschland.[3] Der Franzose Jean-Pierre Blanchard
leitet damit eine Reihe von Ballonvorführungen auf deutschem Boden ein und
macht damit die Ballonfahrt auch im Deutschen Reich allgemein bekannt.[4]
Im folgenden
wird die Geschichte der Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis
1912 skizziert. Ausgehend vom Ende des 18. Jhs. schließt dieser chronologische
Abriß mit der Gründung der militärischen Fliegerstation „Butzweilerhof“ im
Jahre 1912 ab. Der Fokus der Schilderung liegt auf den Luftfahrzeugen „Leichter
als Luft“ und den damit verbundenen Ereignissen innerhalb der Domstadt.
Speziell der Freiballon ist bis zu Beginn des 20. Jhs. das einzige Luftfahrzeug
von Bedeutung; Luftschiffe oder Flugzeuge – später dominierend – sind noch
nicht ganz ausgereift, denn noch fehlt diesen Luftfahrzeugen ein geeigneter
Antrieb. Der Beginn der Motorfliegerei in Köln mit den Luftfahrzeugen „Schwerer
als Luft“ wird im Kontext dieser Betrachtung weitestgehend ausgenommen. Jenes
Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte bedarf einer separaten Darstellung, denn es
ist ebenso vielschichtig wie ereignisreich und von Flugpionieren geprägt, wie
dieses, welches hier geschildert werden soll.
Die vorliegende
Darstellung stützt sich hauptsächlich auf die von der Stiftung Butzweilerhof
Köln zusammengestellten und dort archivierten Dokumente und Aufzeichnungen.[5] Ergänzend werden
allgemeine Literatur zur Geschichte der Luftfahrt sowie entsprechende Dokumente
aus Archiven herangezogen, um das Bild abzurunden.
II.
Zivile und militärische Ballon- und Luftschifffahrt
1. Zivile Ballon- und Luftschifffahrt
Der erste Versuch, in
Köln die Luft zu erobern, der allerdings ergebnislos blieb, ist für Jahr 1785
überliefert. Als Jean-Pierre Blanchard auf seiner Rundreise durch das Deutsche
Reich am 21. Oktober 1785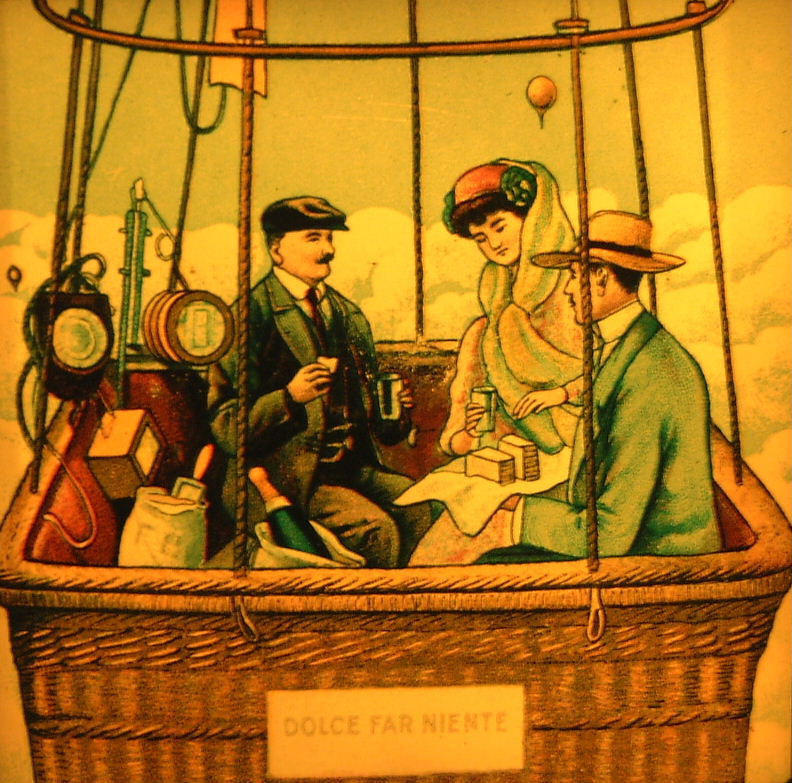 in Köln eintrifft, richtet dieser eine Anfrage an die
Stadt, in der rheinischen Metropole mit seinem Ballon aufsteigen zu dürfen. Der
Kölner Stadtrat lehnt Blanchards Gesuch ab: Die Stadtväter argumentieren, es
sei vermessen gegen Gottes Barmherzigkeit, derartiges zu unternehmen.[6] Die Stadt Köln erläßt ein
Startverbot und gestattet dem gelernten Mechaniker und Ingenieur lediglich eine
öffentliche Präsentation seines Ballons. Mit der Genehmigung des
Ballonaufstiegs zweieinhalb Wochen zuvor zeigte sich der Rat der Stadt
Frankfurt a. Main aufgeschlossener als die Domstadt.[7] in Köln eintrifft, richtet dieser eine Anfrage an die
Stadt, in der rheinischen Metropole mit seinem Ballon aufsteigen zu dürfen. Der
Kölner Stadtrat lehnt Blanchards Gesuch ab: Die Stadtväter argumentieren, es
sei vermessen gegen Gottes Barmherzigkeit, derartiges zu unternehmen.[6] Die Stadt Köln erläßt ein
Startverbot und gestattet dem gelernten Mechaniker und Ingenieur lediglich eine
öffentliche Präsentation seines Ballons. Mit der Genehmigung des
Ballonaufstiegs zweieinhalb Wochen zuvor zeigte sich der Rat der Stadt
Frankfurt a. Main aufgeschlossener als die Domstadt.[7]
Die ablehnende
Haltung der Kölner Ratsherren ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass
den Zeitgenossen der Ballon als Symbol der Aufklärung und des technischen
Fortschritts galt, manchen sogar als Menetekel für Umwälzung und Umsturz. Von
diesen politischen Dimensionen möchte die mehrheitlich bürgerlich konservative
Bevölkerung und die auf Ruhe und Ordnung bedachte Domstadt vermutlich Abstand
nehmen.[8]
Trotz dieser
Besorgnis seitens der Stadt lassen sich Ballonaufstiege nicht restlos aus dem
Kölner Umland bzw. dem Rheinland fernhalten.[9] Im Mai bzw. Juni und Juli
des Jahres 1788 läßt der Landphysiker des Amtes Monheim, Georg Haffner, in
Deutz einen Ballon eigener Bauart steigen;[10] sein Vorhaben hat Haffner
per Zeitungsanzeige im Vorfeld bekannt gegeben.[11] Erst nach Ausräumung
einiger Bedenken des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten Maximilian Franz,
erteilt ein Deutzer Amtmann - Deutz ist damals noch Nachbarstadt von Köln[12] - mit Zustimmung der
Kölner Stadtherren Haffner die Erlaubnis für seine Ballonvorführung.[13] Weitere Ballonaufstiege
von Haffner, ob ohne oder mit menschlicher Besatzung, scheinen ausgeblieben zu
sein. Dafür treffen nach Haffners Abreise aus Deutz beim dortigen Amtmann
mehrere Beschwerdebriefe ein, die dem Aeronauten Zahlungsversäumnisse
nachsagen.[14]
Ähnlich wie der
Franzose Jean-Pierre Blanchard, dem „Ballonfahrer der ersten europäischen
Luftfahrtbegeisterung,“[15] ist Georg Haffner einer
der wenigen professionellen Luftfahrer, die es zum Ende des 18. Jhs. in Europa
offenbar gegeben hat. Er gehört zu der Gruppe von Schausteller-Aeronauten, die
dem Vorbild Blanchards folgen und die Ballonfahrt aus echter Begeisterung
beruflich betreiben. Häufig müssen sie aus den Einnahmen ihrer Vorstellungen
den Bau ihrer Ballone selbst finanzieren. Zu dieser Zeit ist es nur wenigen
Personen vorbehalten, selbst aufzusteigen. Die Ballonfahrer nennen sich selbst
‘Aeronauten’ oder zu deutsch „Luftschiffer“; als
„Kapitäne“ „fahren“ sie im „Luftmeer“ und kleiden sich in Marineuniformen.
 Im Verlauf des 19.
Jhs. erfreuen sich Ballonvorführungen durch berühmte und weniger prominente
Aeronauten zunehmender Beliebtheit. Neben den Veranstaltungen in bekannten
Vergnügungszentren vor einem ‘gehobenen’ Publikum, spielt der Ballon auf
Jahrmärkten und Volksfesten ebenfalls eine attraktive Rolle. Durch eine
Bereicherung des bisherigen Flugprogramms, es kommen Fallschirmabsprünge und
Nachtfahrten hinzu, werden die Voraussetzungen für eine erhöhte und breitere
Publikumswirksamkeit des Ballons geschaffen. Anfangs sind es
vornehmlich ausländische Aviatiker, die in Deutschland Ballonvorführungen
durchführen: „Deutschland besaß auch im 19. Jahrhundert keine Ballonfahrer von
internationalem Ruf.“[16] Im Verlauf des 19.
Jhs. erfreuen sich Ballonvorführungen durch berühmte und weniger prominente
Aeronauten zunehmender Beliebtheit. Neben den Veranstaltungen in bekannten
Vergnügungszentren vor einem ‘gehobenen’ Publikum, spielt der Ballon auf
Jahrmärkten und Volksfesten ebenfalls eine attraktive Rolle. Durch eine
Bereicherung des bisherigen Flugprogramms, es kommen Fallschirmabsprünge und
Nachtfahrten hinzu, werden die Voraussetzungen für eine erhöhte und breitere
Publikumswirksamkeit des Ballons geschaffen. Anfangs sind es
vornehmlich ausländische Aviatiker, die in Deutschland Ballonvorführungen
durchführen: „Deutschland besaß auch im 19. Jahrhundert keine Ballonfahrer von
internationalem Ruf.“[16]
Entsprechend erfolgen
auch in Köln zahlreiche Aufstiege vorwiegend von französischen und englischen
‘Aeronauten’. Derartige Vorführungen könnten die Aeronauten Sinval und Guerin
im April und Mai des Jahres 1808 in Köln veranstaltet haben. In den Kölner
Zeitungen „Gazette Française de Cologne“ und „Der Verkündiger“ werden von ihnen
mehrfach Inserate geschaltet.[17] Darin geben sie ihre
Absicht bekannt, einen Ballon aufsteigen zu lassen, vom dem Monsieur Guerin
dann mit einem Fallschirm abspringen wird.
Anfang Mai 1847 gibt
der Engländer Charles Green[18] in der Domstadt ein
Gastspiel, bei dem er zwei Ballonstarts durchführt.[19] Während seines
Aufenthalts stellt Green seinen Ballon samt eines
verbesserten Fallschirms zur Besichtigung aus. Green zählt zu den
berühmtesten und erfolgreichsten Aeronauten des 19. Jhs. In seinem
selbstkonstruierten ‘Royal Vauxhall Ballon’ gelingt ihm am 7./8. November 1836
eine spektakuläre Fahrt von London bis in das Herzogtum Nassau.
Im März 1878 bittet
Gustave Landreau, ein Aviatiker aus Brüssel, beim Kölner Polizeipräsidenten um
die Erlaubnis, am 15. und 19. Mai 1878 gemeinsam mit seinem Kollegen Palont in
der Stadt aufsteigen zu dürfen.[20]
Eine bemerkenswerte
Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist
Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den
Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen
Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von
luftfahrtbegeisterten Menschen.[21] Im Jahre 1889 findet sich Wolff in
Köln als Ingenieur und schriftführender Vorsitzender des „Ballon-Sport-Clubs
Cöln, gegr. 1888“ wieder; 1890 gründet er als Pendant zum Berliner Vorgänger
den „Verein zur Förderung der Luftschiffahrt, Cöln“ und avanciert zum
Chefredakteur des Sammelwerks „Das Luftschiff“.[22] Seit den 1880er Jahren
führt der Aeronaut als ständige Attraktion im Riehler „Goldenen Eck“[23] Ballonfahrten mit
Passagieren durch, die ihn über die Grenzen Kölns bekannt machen. So nutzt
Wolff seine praktischen Kenntnisse auf dem Gebiet der Luftschifffahrt zum
Geldverdienen.
Spektakulär ist die
Vorführung am späten Abend des 10. Juni 1889 während der „Allgemeinen
Ausstellung für Hausbedarf und Nahrungsmittel“ im Riehler „Goldenen Eck“.[24] An einem ca. 50 m langen
Seil zieht sein Ballon ‘Hohenzollern’ eine „Zusammenstellung verschiedener
Feuerwerkskörper“ hinter sich her, so der Bericht einer Kölner Zeitung.[25] In einiger Höhe zündet
Wolff zahlreiche bunte Leuchtkugeln, die den Himmel über Köln illuminieren.
Zwei Tage zuvor
passierte Wolff im Rahmen der dort gleichzeitig stattfindenden „Internationalen
Sportausstellung“[26]
ein Missgeschick: Sein Ballon ‘Colonia’ platzte während des Füllens, in aller
Eile wurde der kleinere mit Namen ‘Schwalbe’ startklar gemacht.[27] Etwa ein Jahr später, am
7. Juli 1890, passiert Wolff erneut ein Malheur, diesmal mit schwerwiegenderen
Folgen: Auf einer Fahrt von Köln nach Bensberg wird sein Ballon ‘Stollwerck’
während der Landung von einer plötzlich auftretenden Windböe erfasst. Dieser
reißt einen der acht Landarbeiter, die bei der Landung helfen, den noch im Korb
befindlichen Passagier Peter Schmitz, der u. a. Präsident der Blauen-Funken
ist, sowie Wolff selbst mit sich in die Höhe. Kurz darauf stürzt der
Landarbeiter ab und verletzt sich schwer, Peter Schmitz und Wolff können später
unverletzt den Ballon verlassen. Im Anschluss an diese Ereignisse wird Wolff
seitens der Behörden vorgeworfen, das Leben seiner Passagiere fahrlässig aufs
Spiel zu setzen.[28]
 Offenbar hat die
Verbreitung dieser Ballon-Unfallgeschichte, die Gegenstand zahlreicher
Zeitungsartikel ist,[29] die Bevölkerung
sensibilisiert. Von den Behörden wird zunehmend verlangt, dass durch genaue
Prüfungen von Anfragen für Ballonaufstiege ähnliche Vorgänge zukünftig
vermieden werden sollen. So erreicht den Kölner Polizeipräsidenten am 19. Mai
1894 ein Brief, in dem davor gewarnt wird, dem Luftschiffer Robert Feller,
genannt Ferrel, die Erlaubnis für einen Ballonaufstieg in Köln zu erteilen.[30] Feller, so der Verfasser
des Briefes, gefährde wegen seiner Trinksucht seine Passagiere. Welche
konkreten Maßnahmen eingeleitet werden, ist nicht bekannt; ein Jahr später ist
Ferrel wieder bei seiner Berufsausübung im Riehler „Goldenen Eck“ anzutreffen.[31] Hier tritt „Kapitän“
Ferrel zusammen mit der bekannten Luftschifferin „Miss Polly“ auf. Zu „Miss
Pollys“ Attraktionen gehört der Aufstieg an einer Strickleiter, die unter dem
Ballonkorb hängt.„Miss Polly“, die mit
bürgerlichem Namen Luise Giese geb. Schleifer heißt, gehört, neben der
bekannteren Frankfurter Fallschirmartistin und Ballonfahrerin Käthe Paulus, zu
den wenigen Frauen in diesem Gewerbe.[32] Da beide Frauen in
Matrosenkostümen auftreten sowie den Künstlernamen „Miss (mit zwei ‘s’) Polly“
bzw. „Miß (mit ‘ß’) Polly“ tragen und somit nur anhand der unterschiedlichen
Schreibweise zu unterscheiden sind, werden sie häufig verwechselt. Beide
Aeronautinnen gastieren im Rheinland, daneben werden ihnen auch Engagements in
zahlreichen Städten des Auslandes angeboten. Offenbar hat die
Verbreitung dieser Ballon-Unfallgeschichte, die Gegenstand zahlreicher
Zeitungsartikel ist,[29] die Bevölkerung
sensibilisiert. Von den Behörden wird zunehmend verlangt, dass durch genaue
Prüfungen von Anfragen für Ballonaufstiege ähnliche Vorgänge zukünftig
vermieden werden sollen. So erreicht den Kölner Polizeipräsidenten am 19. Mai
1894 ein Brief, in dem davor gewarnt wird, dem Luftschiffer Robert Feller,
genannt Ferrel, die Erlaubnis für einen Ballonaufstieg in Köln zu erteilen.[30] Feller, so der Verfasser
des Briefes, gefährde wegen seiner Trinksucht seine Passagiere. Welche
konkreten Maßnahmen eingeleitet werden, ist nicht bekannt; ein Jahr später ist
Ferrel wieder bei seiner Berufsausübung im Riehler „Goldenen Eck“ anzutreffen.[31] Hier tritt „Kapitän“
Ferrel zusammen mit der bekannten Luftschifferin „Miss Polly“ auf. Zu „Miss
Pollys“ Attraktionen gehört der Aufstieg an einer Strickleiter, die unter dem
Ballonkorb hängt.„Miss Polly“, die mit
bürgerlichem Namen Luise Giese geb. Schleifer heißt, gehört, neben der
bekannteren Frankfurter Fallschirmartistin und Ballonfahrerin Käthe Paulus, zu
den wenigen Frauen in diesem Gewerbe.[32] Da beide Frauen in
Matrosenkostümen auftreten sowie den Künstlernamen „Miss (mit zwei ‘s’) Polly“
bzw. „Miß (mit ‘ß’) Polly“ tragen und somit nur anhand der unterschiedlichen
Schreibweise zu unterscheiden sind, werden sie häufig verwechselt. Beide
Aeronautinnen gastieren im Rheinland, daneben werden ihnen auch Engagements in
zahlreichen Städten des Auslandes angeboten.
Auch für die Entwicklung der Ballon- und
Luftschifftechnik gehen von Köln im 19. Jh. sowie zu Beginn des 20. Jhs.
wichtige Impulse aus. Bereits 1861 beschäftigt sich Paul Haenlein, Mitglied des
„Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“,[33] angeblich in
Köln-Bayenthal mit dem Bau eines Luftschiffmodells, mit dem ihm im Oktober 1871
einige Flugversuche gelungen sein sollen.[34] Haenlein, dessen
grundlegende Bedeutung seiner Arbeiten für die Entwicklung und den Bau von
Luftschiffen allerdings weithin unbeachtet geblieben ist, wird 1872 mit dem Bau
eines lenkbaren Luftschiffes bekannt.[35]
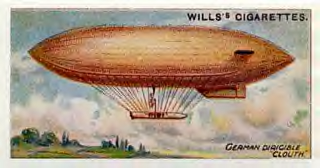 Einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Kölner als auch zur allgemeinen Entwicklung der
Luftfschifffahrt sowie zum städtischen Industrialisierungsprozess leistet der
Kölner Fabrikant Franz Clouth mit seiner Firma „Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik
Cöln-Nippes“. Zum Ende des 19. Jhs widmet sich das 1862 gegründete
Unternehmen, welches bisher Kautschuk-Produkte aller Art produziert, der
Herstellung von Ballonstoffen und kompletter Ballone sowie der Entwicklung und
dem Bau eines lenkbaren Luftschiffes.[36] Bereits 1908 unternimmt
das Luftschiff ‘Clouth I’ über Nippes
seine Jungfernfahrt. Für die Entwicklung und Konstruktion des Luftschiffes
werden ca. eineinhalb Jahre benötigt, alle Teile mit Ausnahme des Motors sind
Eigenanfertigungen der Firma Clouth. Zum Bau von ‘Clouth I’ entsteht 1907 auf
dem Werksgelände in Köln-Nippes das vermutlich erste architektonische Zeugnis
einer – im weitesten Sinne – Luftverkehrsarchitektur in Köln: Es wird eine 45 m
lange, 29 m breite und 17 m hohe Luftschiffhalle errichtet, die den
firmeneigenen Ballonen und dem Luftschiff später als „Heimathafen“ dient.[37] 1909 ist das Clouthsche Luftschiff
auf der „Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung“ (ILA) in Frankfurt a. Main
neben Konstruktionen von Zeppelin, Parseval und Ruthenberg zu besichtigen. Bei
den zahlreichen Aufstiegen während des Ausstellungsbesuches stellt sich heraus,
dass die Steuerung des Luftschiffes modifiziert werden muss. Bereits in
Frankfurt werden einige provisorische Änderungen vorgenommen, Einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Kölner als auch zur allgemeinen Entwicklung der
Luftfschifffahrt sowie zum städtischen Industrialisierungsprozess leistet der
Kölner Fabrikant Franz Clouth mit seiner Firma „Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik
Cöln-Nippes“. Zum Ende des 19. Jhs widmet sich das 1862 gegründete
Unternehmen, welches bisher Kautschuk-Produkte aller Art produziert, der
Herstellung von Ballonstoffen und kompletter Ballone sowie der Entwicklung und
dem Bau eines lenkbaren Luftschiffes.[36] Bereits 1908 unternimmt
das Luftschiff ‘Clouth I’ über Nippes
seine Jungfernfahrt. Für die Entwicklung und Konstruktion des Luftschiffes
werden ca. eineinhalb Jahre benötigt, alle Teile mit Ausnahme des Motors sind
Eigenanfertigungen der Firma Clouth. Zum Bau von ‘Clouth I’ entsteht 1907 auf
dem Werksgelände in Köln-Nippes das vermutlich erste architektonische Zeugnis
einer – im weitesten Sinne – Luftverkehrsarchitektur in Köln: Es wird eine 45 m
lange, 29 m breite und 17 m hohe Luftschiffhalle errichtet, die den
firmeneigenen Ballonen und dem Luftschiff später als „Heimathafen“ dient.[37] 1909 ist das Clouthsche Luftschiff
auf der „Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung“ (ILA) in Frankfurt a. Main
neben Konstruktionen von Zeppelin, Parseval und Ruthenberg zu besichtigen. Bei
den zahlreichen Aufstiegen während des Ausstellungsbesuches stellt sich heraus,
dass die Steuerung des Luftschiffes modifiziert werden muss. Bereits in
Frankfurt werden einige provisorische Änderungen vorgenommen,
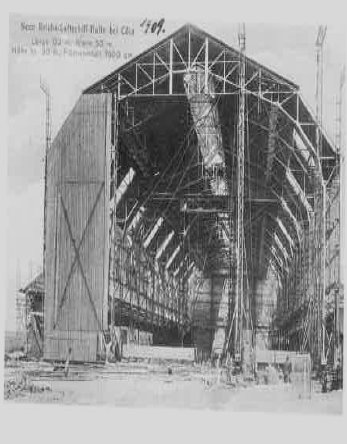 doch erst nach
der Rückkehr nach Köln erhält das Luftschiff eine komplett überarbeitete
Steuerung; das Schiff gewinnt dadurch erheblich an Manövrierfähigkeit. Auch zur
Weltausstellung 1910 in Brüssel doch erst nach
der Rückkehr nach Köln erhält das Luftschiff eine komplett überarbeitete
Steuerung; das Schiff gewinnt dadurch erheblich an Manövrierfähigkeit. Auch zur
Weltausstellung 1910 in Brüssel
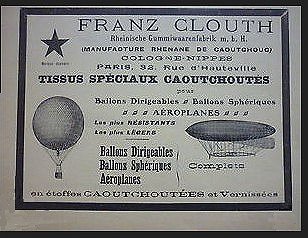 unternimmt das Luftschiff eine Fahrt, wo es
mehrere Rundfahrten absolviert und vom Flugkomitee der Ausstellung mit dem
Preis für Luftschiffe ausgezeichnet wird.[38] Insgesamt hat das
Luftschiff ‘Clouth I’ über 40 Fahrten durchgeführt und dabei fast 2000
Kilometer zurückgelegt; dieser Umstand beweist die Betriebssicherheit und
Brauchbarkeit dieses Typs. Ein zweites Luftschiff wird nie entwickelt, denn
bereits 1910 beginnt sich die Firma Clouth aus dem Bereich der Luftschifffahrt
zurückzuziehen.[39]
Neben der Konstruktion eines eigenen Luftschiffes, sind es ebenfalls einige Ballone
aus der Clouthschen Produktion, die in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen
sind und Pionierarbeit geleistet haben.[40] unternimmt das Luftschiff eine Fahrt, wo es
mehrere Rundfahrten absolviert und vom Flugkomitee der Ausstellung mit dem
Preis für Luftschiffe ausgezeichnet wird.[38] Insgesamt hat das
Luftschiff ‘Clouth I’ über 40 Fahrten durchgeführt und dabei fast 2000
Kilometer zurückgelegt; dieser Umstand beweist die Betriebssicherheit und
Brauchbarkeit dieses Typs. Ein zweites Luftschiff wird nie entwickelt, denn
bereits 1910 beginnt sich die Firma Clouth aus dem Bereich der Luftschifffahrt
zurückzuziehen.[39]
Neben der Konstruktion eines eigenen Luftschiffes, sind es ebenfalls einige Ballone
aus der Clouthschen Produktion, die in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen
sind und Pionierarbeit geleistet haben.[40]
Die Kunst des
Ballonfahrens breitet sich zu Beginn des 19. Jhs. innerhalb und außerhalb
Europas schnell aus. Der Nachteil allerdings ist, dass sie bald hauptsächlich
von Schaustellern mit ihren öffentlichen Aufstiegen in Freiballonen beherrscht
wird und weniger von Erfindern, die sich um technologische Fortschritte
bemühen. Meist wird das Ballonfahren von Abenteurern oder Angehörigen des
Schaustellergewerbes betrieben, doch „stets haftete ihrem Tun ein Hauch von
Unseriosität an.“[41]
Die Ausnahme hiervon bilden indes Frankreich und England, „wo private Aufstiege
immer mehr zunahmen und Berufsaeronauten häufig von Amateuren begleitet oder
durch sie ersetzt“[42] werden.
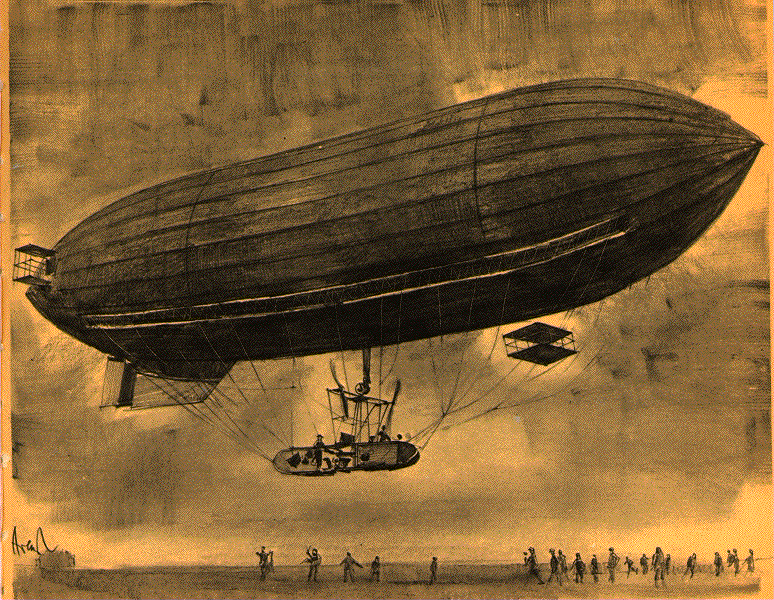 Im Verlauf des 19.
bzw. am Anfang des 20. Jhs. ändert sich dies. Zu dieser Zeit wandelt sich der
Ballon von einem reinen Schauobjekt zu einem Sportgerät, die Entwicklung des
Luftsportes „im Sinne eines für jedermann zugänglichen Breitensportes“[43] nimmt hier ihren Ausgang.
Auch Mitglieder der oberen Gesellschaftsschichten entdecken nun ihr praktisches
Interesse an der Ballonfahrt. Einen wichtigen Beitrag zur Entstehung dieser
Sportart leistet der Amerikaner James Gordon Bennett. Als Zeitungsherausgeber,
der „auf steter Suche nach einer Schlagzeile für sein Blatt“[44] ist, fördert er die
Entwicklung der Luftfahrt finanziell. 1906 startet in Paris die nach ihm
benannte und in Nachfolge alljährlich ausgeschriebene, internationale „Gordon-Bennett-Wettfahrt“
für Freiballone mit einem überwältigenden Erfolg. Im Verlauf des 19.
bzw. am Anfang des 20. Jhs. ändert sich dies. Zu dieser Zeit wandelt sich der
Ballon von einem reinen Schauobjekt zu einem Sportgerät, die Entwicklung des
Luftsportes „im Sinne eines für jedermann zugänglichen Breitensportes“[43] nimmt hier ihren Ausgang.
Auch Mitglieder der oberen Gesellschaftsschichten entdecken nun ihr praktisches
Interesse an der Ballonfahrt. Einen wichtigen Beitrag zur Entstehung dieser
Sportart leistet der Amerikaner James Gordon Bennett. Als Zeitungsherausgeber,
der „auf steter Suche nach einer Schlagzeile für sein Blatt“[44] ist, fördert er die
Entwicklung der Luftfahrt finanziell. 1906 startet in Paris die nach ihm
benannte und in Nachfolge alljährlich ausgeschriebene, internationale „Gordon-Bennett-Wettfahrt“
für Freiballone mit einem überwältigenden Erfolg.
Die Wirkung dieses
Luftsportereignisses schlägt sich Deutschland in der Form nieder, dass nun eine Welle von Gründungen neuer Vereine für
Luftschifffahrt einsetzt.[45] Durch Einführung einer
Ballonfahrerlizenz, Veranstaltung von Wettbewerben und Ballonrennen sowie
Herausgabe von Wettbewerbsregeln tragen speziell diese Vereine zur Etablierung
und Popularität des Ballonsportes bei. Der erste Verein im Rheinland ist der am
15. Dezember 1902 ins Leben gerufene „Niederrheinische Verein für
Luftschiffahrt“ (NVfL).[46]
In Köln erfolgt am 6.
November 1906 im Hause Kattenbug 1–3 die Gründung des „Cölner Aero-Club“, der
aber bereits auf der ersten Generalversammlung am 15. Januar 1907 in „Cölner
Club für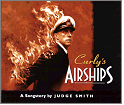 Luftschiffahrt e. V.“ (CCfL) umbenannt wird.[47] Die wichtigsten Ziele des
Vereins sind die Etablierung der Luftschifffahrt in gebildeten Kreisen sowie
die Ausübung und Pflege des Luftsportes. Zu den Gründungsmitgliedern des
Vereins gehören Persönlichkeiten der domstädtischen Wirtschaft, Kultur,
Gesellschaft und dem Militär. Zu den Gründungsinitiatoren zählen der
Rechtsanwalt Dr. Cornelius Menzen, Fabrikbesitzer Hans Hiedemann,
Rechtsreferendar Dr. Otto Nourney sowie eine Reihe von Mitgliedern des „Kölner
Automobilclubs“. Ende 1907 hat der CCfL bereits 270 Mitglieder. Darunter
befinden sich so bekannte Namen wie Clouth, Greven und Stollwerck; mit 47
Mitgliedern bilden die Offiziere die größte Berufsgruppe innerhalb des Vereins.
1908 übernimmt der damalige Studiendirektor der Kölner Handelshochschule und
Mitbegründer der Kölner Universität, Prof. Christian Eckert, den
Vereinsvorsitz. Im Jahre 1910 verzeichnet der Kölner Verein 700 Mitglieder. Luftschiffahrt e. V.“ (CCfL) umbenannt wird.[47] Die wichtigsten Ziele des
Vereins sind die Etablierung der Luftschifffahrt in gebildeten Kreisen sowie
die Ausübung und Pflege des Luftsportes. Zu den Gründungsmitgliedern des
Vereins gehören Persönlichkeiten der domstädtischen Wirtschaft, Kultur,
Gesellschaft und dem Militär. Zu den Gründungsinitiatoren zählen der
Rechtsanwalt Dr. Cornelius Menzen, Fabrikbesitzer Hans Hiedemann,
Rechtsreferendar Dr. Otto Nourney sowie eine Reihe von Mitgliedern des „Kölner
Automobilclubs“. Ende 1907 hat der CCfL bereits 270 Mitglieder. Darunter
befinden sich so bekannte Namen wie Clouth, Greven und Stollwerck; mit 47
Mitgliedern bilden die Offiziere die größte Berufsgruppe innerhalb des Vereins.
1908 übernimmt der damalige Studiendirektor der Kölner Handelshochschule und
Mitbegründer der Kölner Universität, Prof. Christian Eckert, den
Vereinsvorsitz. Im Jahre 1910 verzeichnet der Kölner Verein 700 Mitglieder.
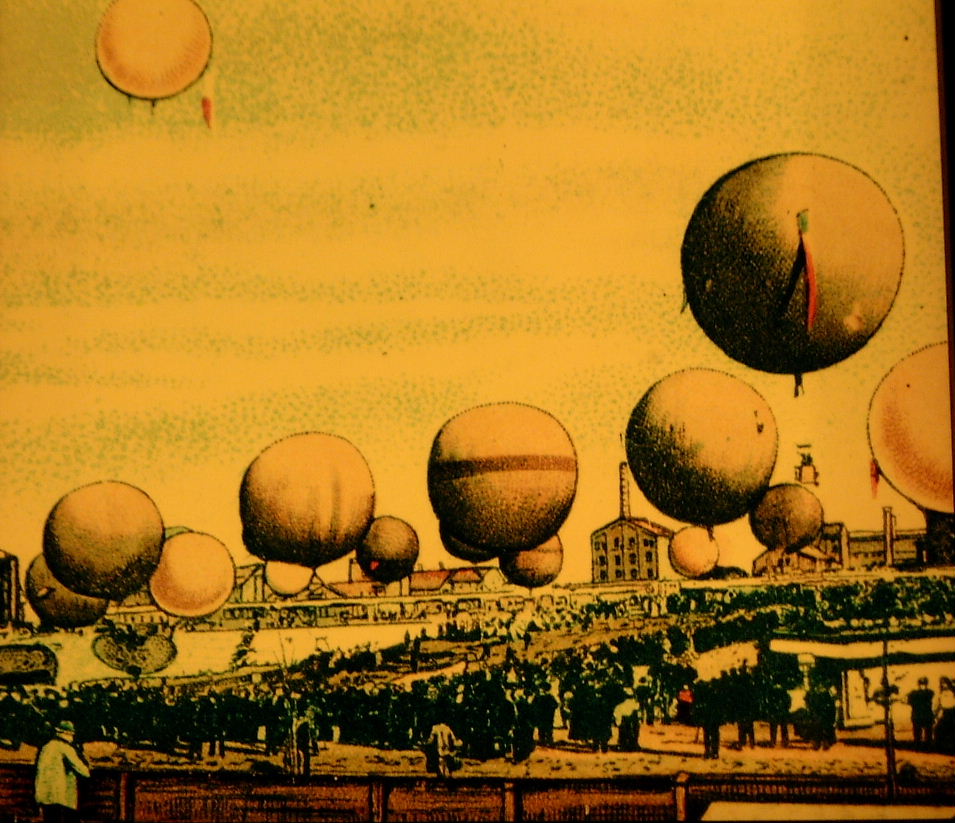 Am 9. Februar 1907
findet in Deutz der erste Ballonstart des Vereins statt. Alle weiteren
Aufstiege erfolgen vom Jugendspielplatz am Lindentor, dem Gelände des heutigen
Aachener Weihers; das 7750 qm große Areal ist mit 36 Füllstellen ausgestattet.[48] Am 9. Februar 1907
findet in Deutz der erste Ballonstart des Vereins statt. Alle weiteren
Aufstiege erfolgen vom Jugendspielplatz am Lindentor, dem Gelände des heutigen
Aachener Weihers; das 7750 qm große Areal ist mit 36 Füllstellen ausgestattet.[48]
Zunächst müssen die
ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone
unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein
für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907
feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,
Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April
1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein
erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in
St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser
Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im
ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig
demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung
ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte
Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“[49] – hat Hiedemann mit
seinem Mitfahrer Dr. Niemeyer Glück im Unglück: Zwar legen die Ballonfahrer in
Hiedemanns Ballon ‘Busley’ die zweitlängste Strecke mit der zweitlängsten
Fahrtdauer zurück, doch müssen die beiden Aeronauten zwischen Norwegen und
Schottland auf hoher See notwassern; erst nach 26 Stunden werden sie von einem
Schiff gerettet. Da die Wettbewerbs-Jury ausschließlich Bodenlandungen wertet,
bleibt der Verdienst der beiden Kölner unberücksichtigt.[50]
Der CCfL verfügt bald
über eine ansehnliche Anzahl sowohl klubeigener als auch privater Freiballone
und kleinerer Luftschiffe, die an zahlreichen Wettbewerben und Ausstellungen
teilnehmen. Im Jahr 1909 besitzt der Kölner Verein zahlreiche Ballone; darunter
sind allein fünf Aerostaten der in Köln ansässigen Firma Clouth – ‘Clouth I bis
V’ – , die alle dem Klub zur Verfügung stehen.[51] Seit seiner Gründung bis
zum Jahr 1914 verzeichnet der CCfL insgesamt 616 Ballonfahrten. Wie engagiert
die Mitglieder des CCfL sind, zeigt sich daran, dass der Kölner Klub bereits im
zweiten Jahr seines Bestehens, 1907, die Tagung des „Deutschen
Luftschiffer-Verbandes“ (DLV), der 1902 in Augsburg gegründeten
Dachorganisation aller Luftfahrt-Vereine, in der Domstadt ausrichtet. Der CCfL
wird als zehnter Klub in den DLV aufgenommen.[52] 1909 besitzt der Kölner Verein zahlreiche Ballone; darunter
sind allein fünf Aerostaten der in Köln ansässigen Firma Clouth – ‘Clouth I bis
V’ – , die alle dem Klub zur Verfügung stehen.[51] Seit seiner Gründung bis
zum Jahr 1914 verzeichnet der CCfL insgesamt 616 Ballonfahrten. Wie engagiert
die Mitglieder des CCfL sind, zeigt sich daran, dass der Kölner Klub bereits im
zweiten Jahr seines Bestehens, 1907, die Tagung des „Deutschen
Luftschiffer-Verbandes“ (DLV), der 1902 in Augsburg gegründeten
Dachorganisation aller Luftfahrt-Vereine, in der Domstadt ausrichtet. Der CCfL
wird als zehnter Klub in den DLV aufgenommen.[52]
Für Köln ist der 1906
gegründete CCfL der entscheidende Ausgangspunkt und Grundlage für eine
anschließend jahrzehntelange Ballon- bzw. Luftsportgeschichte der Stadt; damit
findet die allgemeine Luftfahrt in Köln eine konkrete Organisationsform: „… als
einer der aktivsten Luftschiffahrtsvereine Deutschlands führte [der CCfL]
zahlreiche Ballonfahrten durch, die große sportliche Leistungen darstellten,
aber auch der wissenschaftlichen Erforschung der Atmosphäre dienten.“[53] Der Verein und seine
Mitglieder verhelfen der am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Sportart zu
einer ungemein großen Popularität innerhalb Kölns. Die praktische Ausübung des
Luftsportes erstreckt sich anfangs auf Freiballone und Luftschiffe. Auf die
Bürger der Domstadt ist der Eindruck der neuen Sportart so beträchtlich und von
so großer Begeisterung geprägt, dass die Veranstaltungen des Kölner Klubs auf
dem Ballonaufstiegsplatz vor dem Lindentor stets zu Ereignissen mit
Volksfestcharakter werden. In der Folgezeit erweist sich der CCfL als
Ausrichter bedeutender luftsportlicher Veranstaltungen.
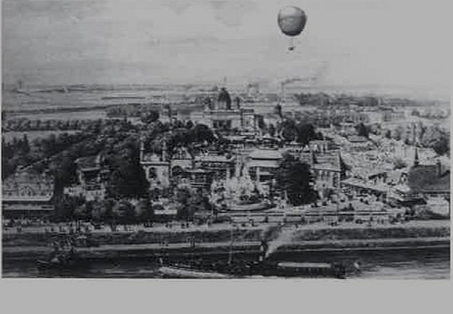 Eine der Höhepunkte
der frühen Ballonsportgeschichte ist zweifellos die vom Kölner Verein
veranstaltete „Internationale Ballonwettfahrt“ am 27. und 29. Juni 1909. An
diesem größten internationalen Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.
zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten
Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35
Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer
Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als
Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den
Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten
Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich
tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der
Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine
Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der
hohen Eintrittspreise unerschwinglich.[54] Der Erlös aus den
verkauften Eintrittskarten deckt nicht die vom CCfL für die Veranstaltung
aufgebrachten 16000 Mark. Aus diesen und weiteren Gründen ist die Resonanz auf
die Veranstaltung in der Presse eher verhalten.[55] Eine der Höhepunkte
der frühen Ballonsportgeschichte ist zweifellos die vom Kölner Verein
veranstaltete „Internationale Ballonwettfahrt“ am 27. und 29. Juni 1909. An
diesem größten internationalen Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.
zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten
Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35
Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer
Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als
Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den
Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten
Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich
tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der
Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine
Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der
hohen Eintrittspreise unerschwinglich.[54] Der Erlös aus den
verkauften Eintrittskarten deckt nicht die vom CCfL für die Veranstaltung
aufgebrachten 16000 Mark. Aus diesen und weiteren Gründen ist die Resonanz auf
die Veranstaltung in der Presse eher verhalten.[55]
Die „Internationale
Flugwoche“ vom 30. September bis 6. Oktober 1909 bildet das zweite
flugsportliche Großereignis des Jahres in Köln. Die Veranstaltung, zugleich das
„bedeutendste sportliche Ereignis auf dem Gebiet der Aviatik im Jahre 1909,“[56] findet auf der Rennbahn
in Köln-Merheim,[57]
dem heutigen Weidenpesch, statt. Zum ersten Mal ist es der Kölner Bevölkerung
möglich, die neue Form der Flugtechnik, die Motorfliegerei, unmittelbar zu
erleben. Das Interesse an der Veranstaltung ist entsprechend groß. Im
fliegerischen Geschehen während der Veranstaltung dominieren französische
Piloten mit ihren französischen Konstruktionen. Berühmte Luftfahrtpioniere und
Kunstflieger, wie Louis Bleriot, Léon Delagrange und Louis Paulhan, zeigen ihr
fliegerisches Können, u. a. stellt Blériot einen neuen Geschwindigkeitsrekord
auf.[58]Flugtage, bei denen
einer Eintritt zahlenden Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben wird, mehrere
Flugzeuge zugleich in der Luft zu erleben, gibt es seit 1909.[59] Die Orte, die von den
ersten Fliegern für derartige Veranstaltungen genutzt werden, sind Wiesen oder
flaches Gelände, deshalb eignet sich die ebene Rasenfläche der Kölner
Pferderennbahn für die Start- und Landevorgänge besonders gut.[60] Die bereits angesprochene
Dominanz französischer Flieger mit französischen Konstruktionen hat folgende
Gründe: Frankreich setzt zu dieser Zeit erhebliche finanzielle Mittel für die
Flugzeugentwicklung ein und etabliert sich in den Vorkriegsjahren als
Luftmacht. Anders in Deutschland: Hier ist die Luftfahrt vorrangig auf den Bau
von Luftschiffen, besonders den Zeppelinen, fixiert. Industrie und insbesondere
Militär unterschätzen (scheinbar) noch die Fähigkeiten des Flugzeugs und
unterlassen entsprechende Investitionen; Deutschland bemüht sich erst in den
kommenden Jahren, das Niveau der französischen Fliegerei zu erreichen.[61] Der daraus resultierende
flugzeugtechnische Rückstand wird zunächst in bescheidenem Rahmen durch das
Engagement privater Flugzeugbauer kompensiert, so auch in Köln: denen
einer Eintritt zahlenden Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben wird, mehrere
Flugzeuge zugleich in der Luft zu erleben, gibt es seit 1909.[59] Die Orte, die von den
ersten Fliegern für derartige Veranstaltungen genutzt werden, sind Wiesen oder
flaches Gelände, deshalb eignet sich die ebene Rasenfläche der Kölner
Pferderennbahn für die Start- und Landevorgänge besonders gut.[60] Die bereits angesprochene
Dominanz französischer Flieger mit französischen Konstruktionen hat folgende
Gründe: Frankreich setzt zu dieser Zeit erhebliche finanzielle Mittel für die
Flugzeugentwicklung ein und etabliert sich in den Vorkriegsjahren als
Luftmacht. Anders in Deutschland: Hier ist die Luftfahrt vorrangig auf den Bau
von Luftschiffen, besonders den Zeppelinen, fixiert. Industrie und insbesondere
Militär unterschätzen (scheinbar) noch die Fähigkeiten des Flugzeugs und
unterlassen entsprechende Investitionen; Deutschland bemüht sich erst in den
kommenden Jahren, das Niveau der französischen Fliegerei zu erreichen.[61] Der daraus resultierende
flugzeugtechnische Rückstand wird zunächst in bescheidenem Rahmen durch das
Engagement privater Flugzeugbauer kompensiert, so auch in Köln:
Einer der ersten
Kölner Flugpioniere auf diesem Gebiet ist Arthur Delfosse. Seit 1902 baut der
gebürtige Kölner Eigenkonstruktionen, deren Flugtauglichkeit – wie üblich –
anfangs über einige Hüpfer nicht hinausgeht. In diesem Jahr gelingen ihm auf
der Mülheimer Heide die ersten Luftsprünge. Neben Arthur Delfosse sind es Bruno
Werntgen, Jean Hugot und andere, denen aufgrund ihrer Pionierarbeit auf dem
Gebiet der Motorfliegerei ein besonderes Verdienst zukommt und die damit
innerhalb der Kölner Luftfahrtgeschichte eine besondere Stellung einnehmen.[62]
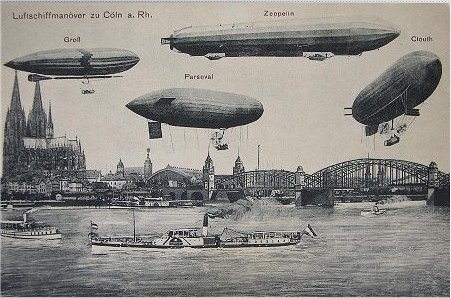 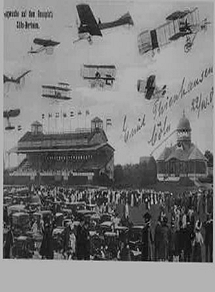 Die „Internationale
Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos
Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar. Die Anzahl von insgesamt 69
Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des
Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt
des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale
Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer
derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an
erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der
Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.
Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich
um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre
zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte
Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“[63] Damit wird dieses Kölner
Ereignis zum Bestandteil der größten Motorflugveranstaltung dieser Art vor dem
Ersten Weltkrieg. Nun sind auch einige Kölner Flieger vertreten, vor allem
Bruno Werntgen beeindruckt durch seine gelungenen Flüge. Im selben Jahr
veranstaltet der Franzose Adolphe Pégoud am selben Ort einen weiteren Flugtag;
die Kölner kommen zu tausenden. Die „Internationale
Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos
Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar. Die Anzahl von insgesamt 69
Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des
Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt
des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale
Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer
derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an
erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der
Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.
Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich
um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre
zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte
Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“[63] Damit wird dieses Kölner
Ereignis zum Bestandteil der größten Motorflugveranstaltung dieser Art vor dem
Ersten Weltkrieg. Nun sind auch einige Kölner Flieger vertreten, vor allem
Bruno Werntgen beeindruckt durch seine gelungenen Flüge. Im selben Jahr
veranstaltet der Franzose Adolphe Pégoud am selben Ort einen weiteren Flugtag;
die Kölner kommen zu tausenden.
Das Gelände der Pferderennbahn im Kölner Norden stellt
für derartige Veranstaltungen ein Provisorium dar. Da die Ballonfahrer mit dem
Gelände am Lindentor bereits über einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Aufstiegsplatz verfügen, beabsichtigen nun auch die Kölner Motorflieger für
ihre luftsportlichen Aktivitäten einen geeigneten Platz einzurichten. Die Suche
nach einem solchen Fluggelände beginnt bereits 1908; vorerst scheitert dieses
Vorhaben an der Militärbehörde, die sich bis dahin wegen des Festungscharakters
der Domstadt[64]
nicht für eine Zusage entscheiden kann.
Im Jahre 1910 finden einige Flugversuche von Jean
Hugot auf dem Feld des landwirtschaftlichen Betriebes des Butzweiler Hofes
statt. Nach und nach nutzen andere Kölner Flieger die guten Start- bzw.
 Landeeigenschaften des Areals und errichten, wie bereits Hugot zuvor,
dauerhafte Unterstellräume für ihre Flugzeuge. Landeeigenschaften des Areals und errichten, wie bereits Hugot zuvor,
dauerhafte Unterstellräume für ihre Flugzeuge.
Die ersten ernsthaften Versuche seitens der
Stadtverwaltung, in Köln einen Flugplatz auf Dauer zu einzurichten, erfolgen
1911. Dabei wird zwar das Gebiet um den immer noch existierenden
Landwirtschaftsbetrieb des Butzweiler Hofes als
zukünftiger Lande- und Startplatz vorgesehen, doch über die endgültige
Unterbringung des Flugplatzes an dieser Stelle ist keinesfalls entschieden.[65] Im Herbst des Jahres
verhandelt der CCfL mit der Stadt über die pachtfreie Überlassung eines
größeren städtischen Grundbesitzes nordwestlich des heutigen Kölner Stadtteils
Volkhoven, um dort einen Flugplatz einzurichten. Inzwischen ist sich jedoch
auch das deutsche Militär der militärischen Bedeutung des Flugzeuges bewusst
geworden.
Noch im Sommer 1912
organisiert Hugot den ersten Großflugtag auf dem Gelände des Butzweiler Hofes,
bei dem es sich keineswegs um einen bereits offiziellen Flugplatz handelt. Zu
dem Ereignis erscheinen 100.000 Besucher.[66] Trotzdem sind alle
Initiativen zur Aufrechterhaltung des zivilen Flugbetriebs vergeblich. Das
Gelände am Butzweiler Hof soll demnächst für den zivilen Flugbetrieb gesperrt
werden. Das Ende der Sportfliegerei zeichnet sich ab, zahlreiche Flieger
wandern zum Flugfeld in Köln-Merheim oder, wie Werntgen, nach Bonn-Hangelar ab.[67]
2.
Militärische Ballon- und Luftschifffahrt
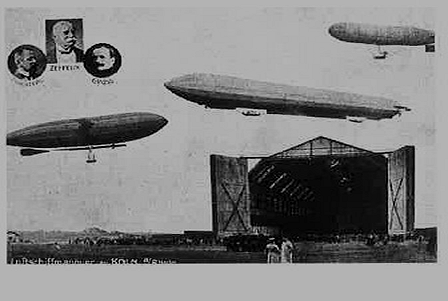
Als erstes
unmittelbares Zeugnis für einen Ballonaufstieg in Köln gilt eine Tuschezeichnung
von Franz Xaver (?) Laporterie[68] mit dem Titel „Aussicht
an der Hahnenpforte den 29. Junius 1795, da der französische Ballon ist
aufgelassen“. Die Zeichnung zeigt die Gegend vor dem Hahnentor. Im
Bildvordergrund sind die Außenwälle der Kölner Stadtbefestigung, in der rechten
Bildhälfte ist ein Teil eines Festungsturms sichtbar. Aus der Stadt führt ein
Weg ins freie Gelände hinaus. Auf diesem wird in Anwesenheit einer großen
Gruppe von Zuschauern ein Fesselballon aufgelassen. Unterhalb der eigentlichen
Ballonkugel ist die Gondel des Ballons in Form einer Gondel erkennbar, in der
sich schemenhaft drei Personen ausmachen lassen. Weitere Zuschauer befinden am
Anfang des Weges und auf den Außenwällen der Festungsmauern.
Das Ereignis des
französischen Ballonaufstiegs, welches den Beginn der bemannten Luftschifffahrt
in Köln darstellt, wird durch eine andere Quelle bestätigt: Es handelt sich
dabei um einen Brief eines Balthasar Kourt vom 15. Juli 1795 an die unter
Französischer Verwaltung stehende Reichsstadt Köln.[69] Darin fordert Kourt eine
Wiedergutmachung für die Schäden auf seinem Feld, die durch das Auflassen eines
Ballons entstanden seien.
Mit hoher
Wahrscheinlichkeit handelt es sich, folgt man den Hinweisen in der Zeichnung
und dem Brief eines in den Vorgang involvierten Mannes, um den Aufstieg eines
französischen Militärballons zu Übungszwecken. Nachdem die französischen
Truppen am 6. Oktober 1794 Köln besetzten, stand die Reichsstadt unter
französischer Militärverwaltung. Die militärische Verwendung von Ballonen in
der französischen Armee hatte bereits seit den Revolutionskriegen Tradition, wo
sie als u. a. Beobachtungs- und Aufklärungs-Ballone eingesetzt wurden. Die
erste Luftschiffer-Kompanie der Welt, die ‘Aérostiers militaires’, wurde am 2.
April 1794 gebildet.[70]
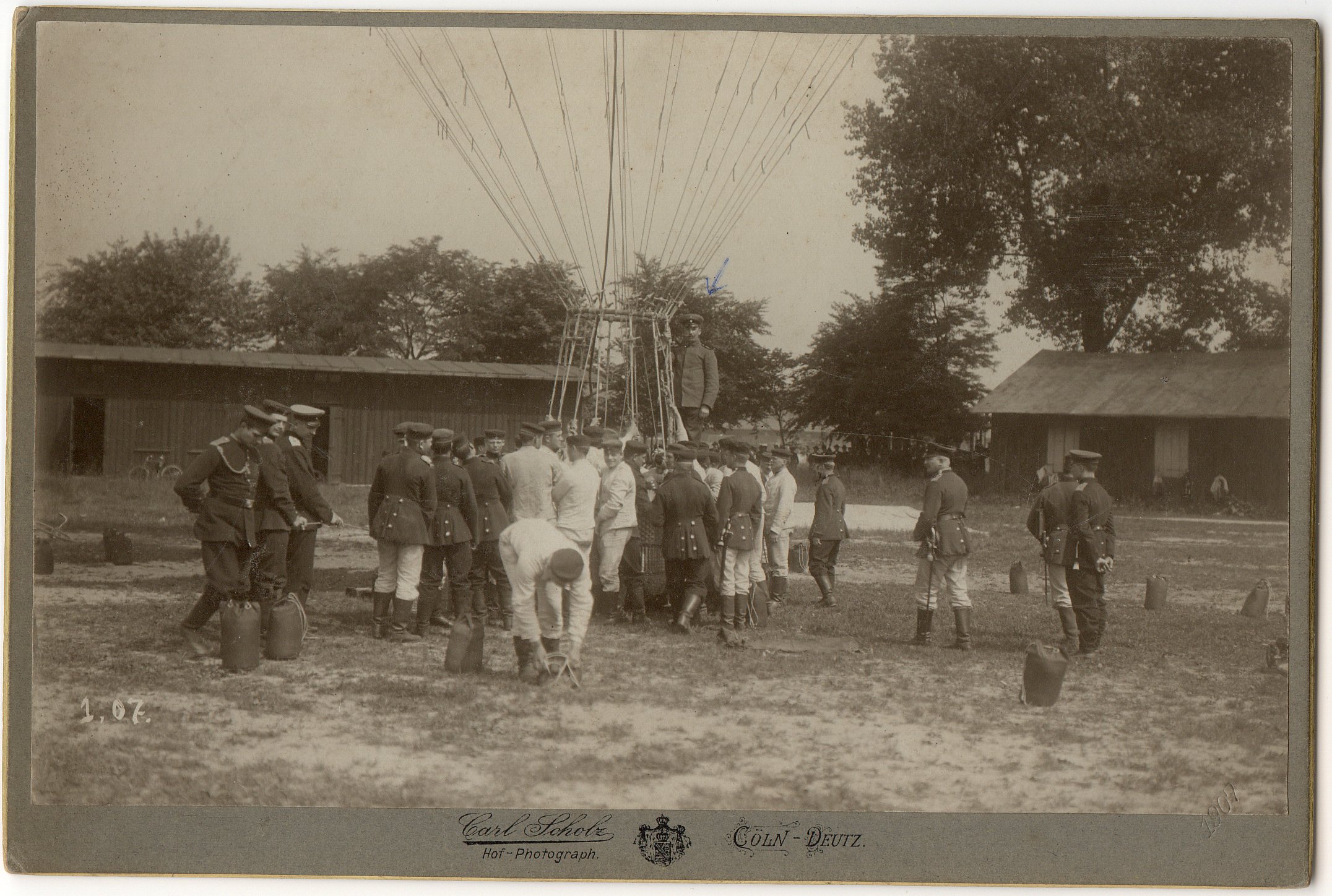 Als 1870/71 der
deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine
Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung
wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische
Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte
sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert
und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes
bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein
Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“[71] Coxwell ist ein auf dem
Gebiet der militärischen Ballonfahrt erfahrener Luftschiffer, bereits während
seines ersten Aufenthaltes in Deutschland von 1848 bis 1851 hat er in der Nähe
von Berlin Bombenabwürfe vom Ballon aus demonstriert. Die in Köln ausgebildete
Luftschiffer-Einheit wird im September 1870 zur Belagerung Straßburgs verlegt,
jedoch in den Kampfhandlungen nicht eingesetzt und bereits am 10. Oktober 1870
wieder aufgelöst, ohne je an einem Kampf-Einsatz beteiligt gewesen zu sein. Als 1870/71 der
deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine
Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung
wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische
Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte
sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert
und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes
bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein
Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“[71] Coxwell ist ein auf dem
Gebiet der militärischen Ballonfahrt erfahrener Luftschiffer, bereits während
seines ersten Aufenthaltes in Deutschland von 1848 bis 1851 hat er in der Nähe
von Berlin Bombenabwürfe vom Ballon aus demonstriert. Die in Köln ausgebildete
Luftschiffer-Einheit wird im September 1870 zur Belagerung Straßburgs verlegt,
jedoch in den Kampfhandlungen nicht eingesetzt und bereits am 10. Oktober 1870
wieder aufgelöst, ohne je an einem Kampf-Einsatz beteiligt gewesen zu sein.
Eine Neubelebung
erfährt die deutsche militärische Ballon- und Luftschifffahrt zu Beginn des
Jahres 1884. Nachdem England und Frankreich mit der Aufstellung von
Luftschiffertruppen vorangegangen sind, wird am 1. Juni 1884 in Berlin ein
Détachement mit der Bezeichnung ‘Versuchsstation für Captivballons’ gebildet
und somit ein kaiserlicher Befehl vom März dieses Jahres umgesetzt. Der Dienst
sieht die Verwendung und Bedienung von Fessel- und Freiballonen vor.
Ein Jahr später,
1885, ist die preußische Festung Köln Ort einer Belagerungsübung, an der auch
die neu aufgestellte Truppe teilnimmt; im Oktober 1892 absolviert sie dort ein
Lehrkommando.
Bei dem 1904 in Köln
auf der Wahner Heide[72] stattfindenden
Artillerieschießen fungiert die Einheit der Berliner Luftschiffertruppe mit
ihren aufgelassenen Ballonen gleichsam als ‘fliegender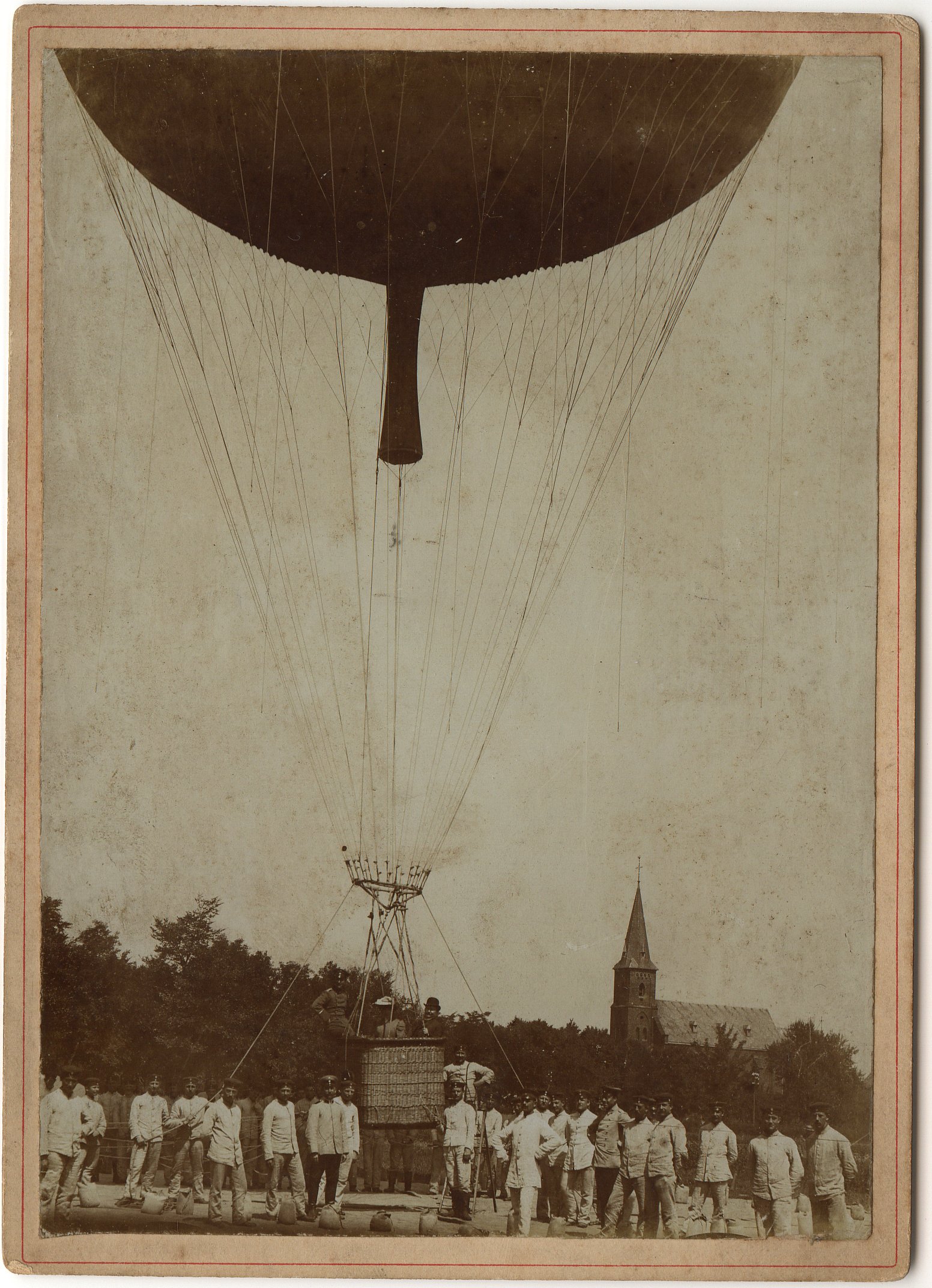 Feuerleitstand’: hinter
den Batterien schwebend, beobachten und koordinieren sie das
Artillerieschießen. Unter diesen Soldaten befindet sich Erich Gensicke, der in
den kommenden Jahren in der Kölner Luftfahrt eine wichtige Rolle spielen wird;
er ist in den 1930er Jahren stellvertretender Direktor des Flughafens
„Butzweilerhof“. Feuerleitstand’: hinter
den Batterien schwebend, beobachten und koordinieren sie das
Artillerieschießen. Unter diesen Soldaten befindet sich Erich Gensicke, der in
den kommenden Jahren in der Kölner Luftfahrt eine wichtige Rolle spielen wird;
er ist in den 1930er Jahren stellvertretender Direktor des Flughafens
„Butzweilerhof“.
Maßgeblich durch
Ferdinand Graf von Zeppelin bestimmt, vollzieht sich zu Beginn des 20. Jhs. die
Entwicklung „lenkbarer Ballone“, sog. Luftschiffe. Am 2. Juli 1900 gelingt dem
Grafen von Zeppelin mit dem von ihm konstruierten 128 m langen Luftschiff ‘LZ
1’[73] eine gesteuerte Fahrt.
Ein neuer Weg in der Luftfahrt wird damit beschritten. Die Fahrten, die bislang
mit den Ballonen unternommen wurden, waren Zufallsreisen. Erst die Erfindung
und der Einsatz des Benzinmotors ermöglichen den nun nicht mehr kugelrunden,
sondern stromlinienförmigen Luftschiffen eine gesteuerte Bewegung durch den
Luftraum. Dem ‘LZ 1’ folgen weitere starren Luftschiffe des Grafen Zeppelin. Im
Mai 1906 unterbreitet er dem deutschen Kriegsministerium ein Angebot, seine
gesamte Luftschiffproduktion an den Staat zu verkaufen. Insbesondere betont er
anhand einer beigefügten Studie die Vorteile des Luftschiffes bei einer
Mobilmachung.[74]
Auch das Luftschiff-Unglück des ‘LZ 4’, im August 1908 in
Stuttgart-Echterdingen, bedeutet keinesfalls das Ende der deutschen
Luftschifffahrt. Im Gegenteil, in einer nationalen Begeisterung werden
innerhalb weniger Monate über 7 Millionen Mark für den Fortgang und die
technische Weiterentwicklung des Luftschiffbaues von Bürgern gespendet. Die
hohe Summe dieser „Zeppelinspende“ belegt, dass sich in dieser Zeit der Graf
Zeppelin mit seiner Erfindung eines großen Rückhaltes in der Bevölkerung gewiss
sein konnte.
Auf Initiative des
CCfL wird die Stadt Köln aufgefordert, als erste deutsche Stadt dem Grafen
Zeppelin eine Luftschiffhalle mit technischen Anlagen bereitzustellen.[75] Den Bestrebungen des
Vereins entspricht die Kölner Bürgerschaft 1908 in Form einer finanziellen
Beteiligung an der neugegründeten Deutschen Luftschiffahrts A. G. in Frankfurt
a. Main (DELAG),[76]
dem ersten Luftverkehrsunternehmen der Welt. Zweck der Gesellschaft ist die
Durchführung eines planmäßigen Luftverkehrs mit Luftschiffen: „Diese Schiffe
sollten freilich keinen regelmäßigen Verkehr, etwa nach dem Beispiel der
Eisenbahnen erledigen, sondern waren für gelegentliche Vergnügungsfahrten
bestimmt …“[77]
Obwohl sich Köln um die Einbindung des Luftschiffhafens in den
DELAG-Luftverkehr energisch bemüht und die gleichen Interessen Düsseldorfs
bekämpft, entscheidet sich „in der DELAG-Aufsichtsratssitzung vom 28. Februar
1910 die Mehrzahl der Mitglieder zugunsten Düsseldorfs.“[78]
 Im Spätsommer des für
den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das
Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August trifft gegen 11.30 Uhr ‘LZ 5’, von
der ILA in Frankfurt a. Main kommend, in Köln ein.[79] „Die Begeisterung der
Kölner, die noch nie einen Zeppelin gesehen haben, kennt keine Grenzen: Bereits
am frühen Morgen machen sich unzählige Menschen auf den Weg nach Bickendorf …
Auch an anderen Orten, etwa vor dem Dom oder auf der Anhöhe bei Müngersdorf,
finden sich viele Kölner ein, um die ‘fliegende Zigarre’ beim Anflug zu sehen.
Die Kölner ‘Pänz’ bekommen sogar schulfrei.“[80] Vor seiner Landung in
Bickendorf umfährt der vom Grafen Zeppelin persönlich gesteuerte 136 m lange
‘LZ 5’ zweimal die Türme des Kölner Doms und präsentiert sich so den Kölner
Bürgern. Am Landeplatz in Köln-Bickendorf empfängt eine riesige, jubelnde
Menschenmenge den Grafen Zeppelin und seine Mannschaft. Eine Denkschrift an
einem Erker des Hauses Herwarthstr. 31, wo Graf Zeppelin übernachtete, erinnert
noch heute an diesen Besuch. Im Spätsommer des für
den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das
Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August trifft gegen 11.30 Uhr ‘LZ 5’, von
der ILA in Frankfurt a. Main kommend, in Köln ein.[79] „Die Begeisterung der
Kölner, die noch nie einen Zeppelin gesehen haben, kennt keine Grenzen: Bereits
am frühen Morgen machen sich unzählige Menschen auf den Weg nach Bickendorf …
Auch an anderen Orten, etwa vor dem Dom oder auf der Anhöhe bei Müngersdorf,
finden sich viele Kölner ein, um die ‘fliegende Zigarre’ beim Anflug zu sehen.
Die Kölner ‘Pänz’ bekommen sogar schulfrei.“[80] Vor seiner Landung in
Bickendorf umfährt der vom Grafen Zeppelin persönlich gesteuerte 136 m lange
‘LZ 5’ zweimal die Türme des Kölner Doms und präsentiert sich so den Kölner
Bürgern. Am Landeplatz in Köln-Bickendorf empfängt eine riesige, jubelnde
Menschenmenge den Grafen Zeppelin und seine Mannschaft. Eine Denkschrift an
einem Erker des Hauses Herwarthstr. 31, wo Graf Zeppelin übernachtete, erinnert
noch heute an diesen Besuch.
Die Fahrt von ‘LZ 5’
am 5. August 1909 dient seiner Überführung an ein militärisches Vorauskommando,
welches sich seit April 1909 in der Festung Köln bzw. in Köln-Bickendorf
befindet und sich auf die Übergabe vorbereitet. Das Luftschiff erhält die
militärische Bezeichnung ‘Z II’, als Heeresschiff soll es überwiegend
Aufklärungs- und Beobachtungsaufgaben übernehmen.
Im selben Monat
beginnen unter Leitung des Militärbauamtes die viermonatigen Bauarbeiten am
Luftschifflandeplatz bzw. Luftschiffhafen. Zwischen der heutigen Venloer Straße
und dem Ossendorfer Weg wird eine Luftschiffhalle errichtet. Die Bauausführung
wird dem Werk Gustavsburg in Mainz, der Maschinenfabrik und Brückenbauanstalt
„Augsburg-Nürnberg AG“,[81] die in der Anlage von
Luftschiffhallen bereits Erfahrung vorweisen kann,[82] sowie dem in
Köln-Ehrenfeld ansässigen Bauunternehmer Stephan Pöttgen übertragen.[83] In unmittelbarer Nähe zur
Halle werden Gebäude für Mannschaften und Werkstätten angelegt. Im Zuge der
Baumaßnahmen am Luftschiffhafen wird in Köln-Ehrenfeld eine
Wasserstoff-Gasanstalt der städtischen Gaswerke errichtet, die der Betankung
des Luftschiffes dient.
Die Luftschiffhalle
des Kölner Luftschiffhafens ist als eine ‘Fahrt- bzw. Bergungshalle’
konzipiert. Sie entspricht im Hallengrundriss und Typ einer sog.
‘feststehenden, ortsfesten, einschiffigen Längshalle’ und weist eine einzelne
Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an
beiden Giebeln mit Toren versehen“[84] sein sollte. Dass sich die Militärs für diesen
Hallentypus entscheiden, läßt sich folgendermaßen begründen: Der Bau von
Längshallen gestaltet sich im Vergleich zu dem „aller anderen Hallen am
einfachsten und billigsten. Die Längshalle ist daher die gebräuchlichste und
üblichste Form der Luftschiffhalle.“[85]
Die Gebäude des
Luftschiffhafens lassen sich zusammenfassend wie folgt beschreiben: Im Äußeren
stellt sich die Luftschiffhalle als ein langgestreckter, längsrechteckiger
Baukörper dar. Er ist 152 m lang und 50 m breit, die Hallenöffnung weist eine
lichte Höhe von 27,5 m auf. Jeweils an beiden Seiten verlaufen entlang der
gesamten Hallenlänge niedrige, seitliche Anbauten mit Pultdach. Als Belichtung
dieses Hallenbereiches, in dem sich ein Teil der Werkstätten befindet, dienen
zwei- und dreiteilige Fenster mit oberen runden Abschlüssen; über Flügeltüren,
ebenfalls rundbogig, ist der Zutritt in die Halle möglich. In die Seitenwände
und die Dachschrägen (des überhöhten Hallenbereiches) der eigentlichen Halle
sind große, rechteckige Fenster eingeschnitten. Der Dachabschluß ähnelt der
Form eines
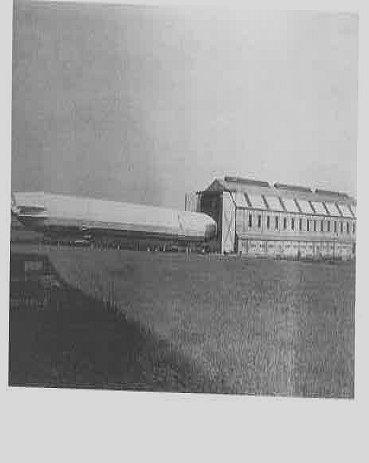 Mansardengiebels. Entlang des Dachfirstes sind in drei Segmenten
dreiecksförmige Dachaufbauten als Oberlichter eingezogen.[86] Mansardengiebels. Entlang des Dachfirstes sind in drei Segmenten
dreiecksförmige Dachaufbauten als Oberlichter eingezogen.[86]
Die Halle besitzt
eine Eisenfachkonstruktion als Träger mit dem Vorteil einer insgesamt
geringeren äußeren Abmessung gegenüber Hallen aus Holz oder Eisenbeton und
einer kleineren Windangriffsfläche. Die Hallenverkleidung besteht aus großen,
miteinander verbundenen Metallbahnen.
Das Hallentor ist ein
kombiniertes Schwenk- und Drehtor, d. h. Falt-Drehtor[87], das über Führungsrollen
beweglich in ein rechteckiges Stahlgerüst vor der Halle eingesetzt ist. Bei der
Kombination von einer inneren Schwenk- und einer äußeren Drehtortafel handelt
es sich um eine technisch anspruchsvolle Konstruktion. Der Antrieb des
Hallentor-Mechanismus erfolgt ausschließlich unten an der Innenseite des
Drehtors, das Schwenktor läuft von selbst mit. Das durchfahrende Luftschiff
erhält dadurch ausreichenden Windschutz. Somit wird die wichtigste Aufgabe,
„die Hallen in kurzer Zeit für die Ein- und Ausfahrt eines Luftschiffes zu
öffnen und wieder zu schließen“[88] gelöst.
Um das gesamte
Bauensemble des Luftschiffhafens verläuft als räumliche Trennung vom
umliegenden Gelände eine Umfriedung in Form einer Mauer. Da dem Luftschiff nur
eine Hallenöffnung zur Ein- und Ausfahrt zur Verfügung steht, wird in ca. einem
Kilometer Entfernung zur Halle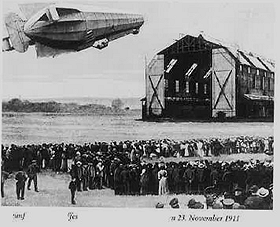 eine Vorrichtung zur Verankerung des
Luftschiffes installiert; so kann bei ungünstiger Wetterlage das Schiff
zunächst dort angelegt werden, um es anschließend in die Halle einzufahren. Im August 1909 wird
der „Reichsluftschiffhafen Cöln“[89] eröffnet und als
Zeppelinlandeplatz für militärische Zwecke genutzt. Dem Vorauskommando
des Luftschiffer-Bataillons Nr. 1, welches nun im Kölner Reichsluftschiffhafen
stationiert ist, folgen zwei Jahre später weitere Einheiten. Am 1. Oktober 1911
wird sowohl der Sitz des Stabes als auch die 1. Kompanie des neu gebildeten
Luftschiffer-Bataillons Nr. 3 in die Domstadt verlegt. Die Einheit wird
vorläufig bei Bocklemünd, in Fort IV des preußischen Festungsrings um Köln,
untergebracht.[90]
In den folgenden Jahren entsteht an der Frohnstraße 190 in Köln-Ossendorf eine
Luftschiffer-Kaserne. Viele Luftschiffer treten dem CCfL als aktive Mitglieder
bei. Zwischen dem Luftschiffer-Bataillon und dem Kölner Verein werden bald enge
Kontakte geknüpft, wodurch bereits in frühen Jahren „eine erfolgreiche
zivil-militärische Zusammenarbeit praktiziert“[91] wird. Die freundschaftliche
Zusammenarbeit hat für den Verein beispielsweise den Vorzug, dass die
CCfL-Ballone kostenlos mit dem aus dem Luftschiff abgelassenen Leuchtgas
gefüllt werden dürfen. eine Vorrichtung zur Verankerung des
Luftschiffes installiert; so kann bei ungünstiger Wetterlage das Schiff
zunächst dort angelegt werden, um es anschließend in die Halle einzufahren. Im August 1909 wird
der „Reichsluftschiffhafen Cöln“[89] eröffnet und als
Zeppelinlandeplatz für militärische Zwecke genutzt. Dem Vorauskommando
des Luftschiffer-Bataillons Nr. 1, welches nun im Kölner Reichsluftschiffhafen
stationiert ist, folgen zwei Jahre später weitere Einheiten. Am 1. Oktober 1911
wird sowohl der Sitz des Stabes als auch die 1. Kompanie des neu gebildeten
Luftschiffer-Bataillons Nr. 3 in die Domstadt verlegt. Die Einheit wird
vorläufig bei Bocklemünd, in Fort IV des preußischen Festungsrings um Köln,
untergebracht.[90]
In den folgenden Jahren entsteht an der Frohnstraße 190 in Köln-Ossendorf eine
Luftschiffer-Kaserne. Viele Luftschiffer treten dem CCfL als aktive Mitglieder
bei. Zwischen dem Luftschiffer-Bataillon und dem Kölner Verein werden bald enge
Kontakte geknüpft, wodurch bereits in frühen Jahren „eine erfolgreiche
zivil-militärische Zusammenarbeit praktiziert“[91] wird. Die freundschaftliche
Zusammenarbeit hat für den Verein beispielsweise den Vorzug, dass die
CCfL-Ballone kostenlos mit dem aus dem Luftschiff abgelassenen Leuchtgas
gefüllt werden dürfen.
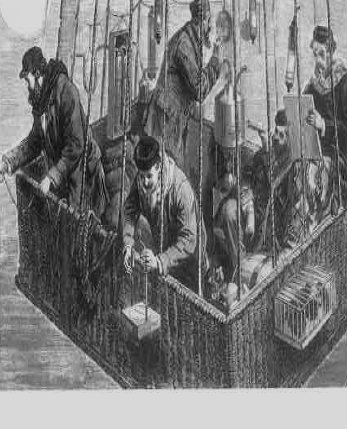 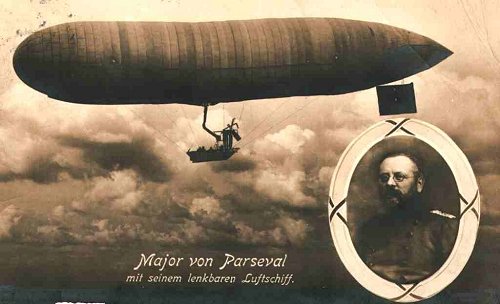 Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“[92]
Zwischen 1909 und
1912 finden in Köln von Frühjahr bis Herbst Luftschiff-Manöver statt.[93] Beteiligt sind neben den
Zeppelin-Luftschiffen, die der starren Bauweise zugeordnet sind, auch die
halbstarren Luftschiffe von Major Hans Gross mit der Bezeichnung ‘M’ sowie die
unstarren Prall-Luftschiffe mit der Bezeichnung ‘P’, die von Major August von
Parseval konstruiert wurden.[94] Ziel dieser Manöver ist
die feldmäßige Erprobung der Militär-Luftschiffe aller drei Konstruktionsarten;
vor allem geht es um die Feststellung der erreichbaren Maximal-Höhe. Beobachtet
werden die Testfahrten von Abgesandten der militärischen Kommission der
preußischen Heeresverwaltung. Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“[92]
Zwischen 1909 und
1912 finden in Köln von Frühjahr bis Herbst Luftschiff-Manöver statt.[93] Beteiligt sind neben den
Zeppelin-Luftschiffen, die der starren Bauweise zugeordnet sind, auch die
halbstarren Luftschiffe von Major Hans Gross mit der Bezeichnung ‘M’ sowie die
unstarren Prall-Luftschiffe mit der Bezeichnung ‘P’, die von Major August von
Parseval konstruiert wurden.[94] Ziel dieser Manöver ist
die feldmäßige Erprobung der Militär-Luftschiffe aller drei Konstruktionsarten;
vor allem geht es um die Feststellung der erreichbaren Maximal-Höhe. Beobachtet
werden die Testfahrten von Abgesandten der militärischen Kommission der
preußischen Heeresverwaltung.
Eines der größten
Luftschiff-Manöver erlebt Köln vom 25. Oktober bis zum 20. November 1909.[95] Die drei
Militär-Luftschiffe ‘Z II’, ‘M II’ und ‘P II’ sowie das Privatluftschiff ‘P
III’ absolvieren Fahrten unterschiedlichster Art: Geschwindigkeits-, Tief- und
Höhenfahrten sowie Formations-, Staffel und Nachtfahrten. Während der gesamten
Dauer des Manövers ist die Luftschiffhalle in Köln-Bickendorf von Zuschauern
und Berichterstattern in- und ausländischer Zeitungen umlagert. Die letzten
Manöverfahrten aller vier Luftschiffe zusammen finden am 6. November 1909 über
Köln statt.
Die Frühjahrsmanöver des Jahres 1910 beginnen am 7.
April. Außer den Militär-Luftschiffen ‘Z II‘, ‘M II’ und ‘P II’ nehmen an den
Erprobungsfahrten auch das Kölner Luftschiff ‘Clouth’ sowie das Luftschiff
‘Erbslöh’ aus Leichlingen als Gäste teil. Im Verlauf des Manövers strandet ‘Z
II’ führerlos am 24. April 1910 nahe Weilburg a. d. Lahn und wird durch einen
Sturm am Boden zerstört. Es hatte sich tags zuvor aus seiner Verankerung
gerissen. Die dadurch entstandenen Schäden am Luftschiff sind irreparabel; nach
insgesamt 16 Fahrten (2478 km) wird ‘Z II’ abgewrackt.[96]
 Am 23. November 1911 erreicht das von Graf Zeppelin
persönlich von Friedrichshafen nach Köln überführte (Ersatz-)Luftschiff ‘Z II’[97] (LZ 9) die Domstadt. Das
Luftschiff trifft mit erheblicher Verspätung zu dem schon seit Anfang November
stattfindenden Luftschiff-Manöver ein. Die Militärs sind von den bisherigen
Ergebnissen des Manövers, an dem u. a. auch das Militär-Luftschiff ‘M II’
teilnimmt, enttäuscht. Auch die Hoffnung, dass sich durch die Teilnahme von
‘(Ersatz-)Z II’ die Luftschiff-Manöver besser entwickeln würden, wird aufgrund
der schlechten Witterung nicht erfüllt; das Manöver endet Anfang Dezember. Nach
Meinung der Militärs stehen die Erfolge in keinem Verhältnis zu den
Erwartungen. Das Luftschiff ‘(Ersatz-)Z II’ bleibt nach Abschluss des
Luftschiff-Manövers in der Festungsstadt Köln stationiert. Am 23. November 1911 erreicht das von Graf Zeppelin
persönlich von Friedrichshafen nach Köln überführte (Ersatz-)Luftschiff ‘Z II’[97] (LZ 9) die Domstadt. Das
Luftschiff trifft mit erheblicher Verspätung zu dem schon seit Anfang November
stattfindenden Luftschiff-Manöver ein. Die Militärs sind von den bisherigen
Ergebnissen des Manövers, an dem u. a. auch das Militär-Luftschiff ‘M II’
teilnimmt, enttäuscht. Auch die Hoffnung, dass sich durch die Teilnahme von
‘(Ersatz-)Z II’ die Luftschiff-Manöver besser entwickeln würden, wird aufgrund
der schlechten Witterung nicht erfüllt; das Manöver endet Anfang Dezember. Nach
Meinung der Militärs stehen die Erfolge in keinem Verhältnis zu den
Erwartungen. Das Luftschiff ‘(Ersatz-)Z II’ bleibt nach Abschluss des
Luftschiff-Manövers in der Festungsstadt Köln stationiert.
Der Status der
Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen
Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.[98] Hintergrund des Verbotes
ist die Befürchtung, dass durch feindliche Agenten das Gelände ausspioniert
werden könnte. So muss z. B. das Luftschiff ‘Ersatz-Deutschland’ (LZ8) auf
seiner Fahrt nach Düsseldorf am 12. April 1911 die Festungsstadt Köln meiden.
Den Zeppelin-Passagierluftschiffen ist ein Überfliegen sowie eine Landung
innerhalb der Festungsgrenzen der Stadt nicht gestattet; Köln ist somit aus den
neuen Linien des Luftschiff-Verkehrs der DELAG ausgeschlossen.[99] Die Gefahr, dass sich
aufgrund dieses Verbotes auch der CCfL auflösen müsse, besteht hingegen nicht.
Der Festungsgouverneur macht den Mitgliedern des CCfL ein großes Zugeständnis:
Auch weiterhin seien Aufstiege im Freiballon und im Flugzeug innerhalb des
Festungsbereiches Köln erlaubt.[100] Somit bleibt zumindest
für die Mitglieder des CCfL die Ausübung des Luftsportes innerhalb der Domstadt
gewährleistet. Für Privatpiloten bzw. Gesellschaften, die die Fliegerei
geschäftlich betreiben, gilt diese Ausnahme jedoch nicht. Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.[98] Hintergrund des Verbotes
ist die Befürchtung, dass durch feindliche Agenten das Gelände ausspioniert
werden könnte. So muss z. B. das Luftschiff ‘Ersatz-Deutschland’ (LZ8) auf
seiner Fahrt nach Düsseldorf am 12. April 1911 die Festungsstadt Köln meiden.
Den Zeppelin-Passagierluftschiffen ist ein Überfliegen sowie eine Landung
innerhalb der Festungsgrenzen der Stadt nicht gestattet; Köln ist somit aus den
neuen Linien des Luftschiff-Verkehrs der DELAG ausgeschlossen.[99] Die Gefahr, dass sich
aufgrund dieses Verbotes auch der CCfL auflösen müsse, besteht hingegen nicht.
Der Festungsgouverneur macht den Mitgliedern des CCfL ein großes Zugeständnis:
Auch weiterhin seien Aufstiege im Freiballon und im Flugzeug innerhalb des
Festungsbereiches Köln erlaubt.[100] Somit bleibt zumindest
für die Mitglieder des CCfL die Ausübung des Luftsportes innerhalb der Domstadt
gewährleistet. Für Privatpiloten bzw. Gesellschaften, die die Fliegerei
geschäftlich betreiben, gilt diese Ausnahme jedoch nicht.
Im Verlauf der Jahre 1911/12 erkennt die deutsche
Militärführung die unzureichende Wirksamkeit der Luftschiffe als Waffe bei der
Luftkriegsführung: „Nach dem heutigen Stande werden Luftschiffe im Kriege der
Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der
Aufklärung.“[101]
Anfang 1912 entschließt sich das Kriegsministerium zu einem beschleunigten
Aufbau der Heeresfliegertruppe. Mit einer „Nationalflugspende“ werden die
deutschen Bürger aufgerufen, die Entwicklung des Flugzeuges finanziell zu
unterstützen.
Die Kölner Militärverwaltung sieht von 1911 an von der
Anlage eines zivilen Flughafens ab und verfolgt – entsprechend den Plänen des
Kriegsministeriums – den Aufbau einer militärischen Fliegerstation.[102] 1912 wird zwischen der
Stadt Köln und dem Reichsfiskus ein Vertrag abgeschlossen, der die Verpachtung
und militärische Nutzung eines Geländes am Butzweiler Hof auf 20 Jahre
festgelegt. Das Gelände „liegt besonders günstig, da es unmittelbar an die in Ossendorf erbaute Militärluftschiffhalle … grenzt.“[103] Das Militär übernimmt
die Anlage des Rollfeldes und die Errichtung der Flugplatzanlagen; die Stadt
sichert die Schaffung einer Straßenbahnverbindung zu. Um nicht eine zivile
Nutzung des Geländes vollends auszuschließen, regt der CCfL an, im
Einverständnis mit dem Kommandeur der Fliegerstation, Flugveranstaltungen auf
dem Platz durchführen zu können.[104]
Am 15. September 1912
wird der Grundstein zur militärischen Fliegerstation „Butzweiler Hof“ gelegt.
Das militärische Vorkommando, welches am 1. Dezember 1912 bezeichnenderweise
ohne Flugzeuge in Köln eintrifft, beginnt mit den ersten Arbeiten für die
Anlage und Errichtung einer militärischen Fliegerstation.[105]
III.
Schlußbemerkung
Das zeithistorische
Phänomen von der Eroberung des Luftraumes lässt sich anhand der frühen Kölner
Luftfahrtgeschichte anschaulich verdeutlichen; es erweist sich als sehr
vielseitig, so lassen sich die unterschiedlichen Facetten des Ballons z. B. als
Attraktion sowie als Sportgerät dabei wiederfinden; später ist es der Einsatz
der Luftschiffe für militärische Zwecke sowie der Beginn der Motorfliegerei.
Noch im 18. Jh., nur wenige Jahre nach dem erfolgreichen Start einer
Montgolfiere, ist in Köln der Aufstieg eines bemannten Ballons nachweisbar: Am
29. Juni 1795 wird von französischen Truppen ein militärischer
Beobachtungsballon vor den Toren der Stadt aufgelassen.
Im Verlauf des 19.
Jhs. finden zahlreiche Ballonaufstiege in der Domstadt statt, so u. a. von den
Luftschiffern Sinval und Guerin 1808 und 1847 von dem berühmten Ballonfahrer
Charles Green. In diesem Zeitraum sind es – entsprechend der Stellung ihrer
Nationen innerhalb der allgemeinen Ballongeschichte – vorwiegend Franzosen und
Engländer, die die Domstadt besuchen und Ballonaufstiege vorführen.
Spektakuläre Ballonaufstiege finden zum Ende des 19. Jhs. im sog. „Goldenen
Eck“ in Köln-Riehl statt. Der Aeronaut Maximilian Wolff führt dort als ständige
Attraktion Ballonfahrten mit
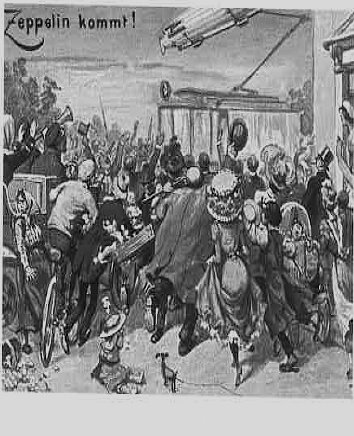 Passagieren zu gewerblichen Zwecken durch. Passagieren zu gewerblichen Zwecken durch.
Der um die
Jahrhundertwende 19./20. Jh. einsetzende Wandel des Ballons vom reinen
Schauobjekt mit Volksfestcharakter zum Sportgerät einer exklusiven
Gesellschaftsgruppe vollzieht sich in Köln wahrnehmbar am 6. November 1906 mit
der Gründung des „Cölner Aero-Club“, dem späteren „Cölner Club für Luftschiffahrt
e. V.“ (CCfL). Damit wird der Grundstein für die Entwicklung des Luftsportes
innerhalb der Rheinmetropole gelegt.
Darüber hinaus gehen von Köln wichtige Impulse für die Entwicklung
der Ballon- und Zeppelintechnik aus: die Kölner Firma Clouth entwickelt 1907
ein lenkbares, motorgetriebenes Luftschiff. Die in diesem Zusammenhang
errichtete Luftschiffhalle kann gleichzeitig als die erste
Luftverkehrsarchitektur in Köln angesehen werden.
Das Jahr 1909 bildet
mit der „Internationalen Ballonwettfahrt“ und der „Internationalen Flugwoche“
Höhepunkte innerhalb der Anfänge der Kölner Luftfahrtgeschichte. In diesem Jahr
können die Kölner Bürger erstmals Flugzeuge im Rahmen einer derartigen
Veranstaltung erleben und bewundern. Austragungsorte Kölner Luftsportaktivitäten
sind anfangs das Gelände des heutigen Aachener Weihers sowie die Pferderennbahn
im heutigen Köln-Weidenpesch.
Im selben Jahr münden
in der Festungsstadt Köln die militärischen Interessen an der Luftfahrt in der
Gründung und Anlage eines Luftschiffhafens in Köln-Bickendorf sowie der
Stationierung eines Militär-Luftschiffes. Die dabei errichtete Luftschiffhalle
zählt zu den allerersten baulichen Zeugnissen einer Luftverkehrsarchitektur im
Kölner Stadtgebiet und ist gleichzeitig eine durchaus bemerkenswerte
Ingenieurleistung dieser Zeit.
In den folgenden
Jahren wird Köln Ort von zahlreichen Luftschiff-Manövern. Obwohl der
Festungscharakter der Stadt eine weitere Expansion des städtischen Luftsportes
durch Überflugs- und Fotografierverbote eher bremst, besteht auf diesem Gebiet
eine zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen dem CCfL und dem stationierten
Luftschiffer-Bataillon; eine Einbeziehung Kölns in ein nationales
Luftschiff-Verkehrsnetz wird aufgrund der militärischen Bestimmungen
verhindert.
1912 ist das Jahr der
Grundsteinlegung für die militärische Fliegerstation „Butzweiler Hof“ und
gleichzeitig die Ausgangsbasis für alle weiteren fliegerischen Ambitionen in
Köln.
Zusammenfassend ist
festzustellen, dass die Ereignisse der frühen Jahre Kölner Aviatik auch im
Hinblick auf die allgemeine Luftfahrt aufschlussreich sind. Die hier
angeführten Geschehnisse der zivilen und militärischen Luftfahrt in Köln
dokumentieren gewiss nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der allgemeinen
deutschen Luftfahrtgeschichte. Sie haben aber sehr wohl repräsentativen
Charakter, denn an ihnen lassen sich die Entwicklungen der allgemeinen
Luftfahrt in Deutschland bis zum Beginn des 20. Jhs. nachvollziehen.

[1]
ECKERT, Alfred: Zur Geschichte der Ballonfahrt. In: Leichter als Luft, 1978, S.
15–133, hier S. 67 (= Ausst.-Kat. Leichter als Luft. Zur Geschichte der
Ballonfahrt. 24.09.–26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte, bearb. von Bernard Korzus. Greven 1978). Eine Ausnahme unter
den deutschen Landesherren ist der wissenschaftlich interessierte Herzog von
Braunschweig. Auf dessen Veranlassung wird ein Gasballon konstruiert, der am
28. Januar 1784 in Braunschweig aufsteigt.
[2]
Vgl. ECKERT (1978), S. 67.
[3]
Vgl. ECKERT (1978), S. 84.
[4]
Vgl. ECKERT (1984), S. 84. Die Rundreise in Deutschland umfaßt insgesamt 10
Städte; weitere Stationen sind u. a.: Hamburg (23. August 1786), Leipzig (29.
September 1787), Nürnberg (12. November 1787), Braunschweig (10. August 1788),
Wien (9. März.1791, mißglückter Start); erst mit Blanchards Abreise nach
Amerika 1792 enden diese Vorstellungen.
[5]
Vgl. MAYER, Edgar, MÜLLER-AHLE, Monika: o. T. - Unveröff. Typoskript. o. D;
SUNTROP, Heribert: Der Butzweilerhof und die Kölner Luftfahrt. Chronik. Eine
Arbeitsgrundlage für die Geschichtsschreibung. Unveröff. Typoskript, Bd. 1.
2001.
[6]
Vgl. HAStK, Best. Ratsprotokolle, Nr. 232; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 2.
[8]
Vgl. MAYER, MÜLLER-AHLE
(o. D.), S. 2.
[9]
Vgl. VOGT, Hans: Seidene Kugel und Fliegende Kiste. Eine Geschichte der
Luftfahrt in Krefeld und am Niederrhein. Krefeld 1993 (= Krefelder Studien, Bd.
7, hrsg. vom Stadtarchiv Krefeld), hier S. 11. Bereits Anfang 1785 erfolgt in
Düsseldorf ein Aufstieg einer Charlière.
[10]
Entweder handelt es sich um einen dreimaligen Aufstieg eines einzigen Ballons
oder um einen einmaligen Aufstieg von insgesamt drei Ballonen. Ob diese
Ballonaufstiege mit oder ohne menschliche Besatzung stattfinden, ist nicht mehr
eindeutig zu klären.
[11] Vgl.
Cölnischer Staatsboth, 13. Junius 1788, 73tes Stuck und 4. Julius 1788, 83tes
Stuck; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 3.
[12]
Deutz ist Bestandteil der Stadterweiterung Kölns von 1888; erst seitdem ist es
Stadtteil der Rheinmetropole.
[13] Die Aussicht
auf wirtschaftlichen Profit durch zahlende Zuschauer scheint die anfänglich
ablehnende Haltung des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten revidiert zu haben.
[14]
Vgl. Rheinischer Merkur, 24. Juli 1911; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 3.
[15] ECKERT (1978), S. 86.
[16] ECKERT (1978), S. 105.
[17] Vgl. Gazette de Française de Cologne, 20.
April 1808, 8. Mai 1808, 14. Mai 1808; Der Verkündiger 24. April 1808,
Nr. 581, 1. Mai. 1808, Nr. 583; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 7.
[18]
Vgl. ECKERT (1984), S. 104; MACKWORTH-PRAED, Ben: Pionierjahre der Luftfahrt.
Stuttgart 1993, hier S. 54. Charles Green (1785-1870) gehört zu den
berühmtesten Ballonfahrern seiner Zeit. Ihm sollen über fünfhundert Aufstiege
gelungen sein. Besondere Verdienste kommen ihm für die Weiterentwicklung des
Ballons durch Einführung des Kohlenstoffgases zu. Green beschränkte sich in
seiner Luftfahrertätigkeit nicht ausschließlich auf Schaufahrten, sondern
verband damit auch wissenschaftliche Ambitionen.
[19]
Vgl. Rheinischer Beobachter, 2. Mai 1847, Nr. 153; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 7.
[20]
Vgl. HStA Düsseldorf, Best. Polizeipräsidium Köln, Nr. 49 (Schreiben von
Gustave Landreau an den Polizeipräsidenten von Köln vom 19. März 1878); MAYER,
MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 7.
[21] Vgl. HOHMANN,
Ulrich: Beiträge zur Geschichte des Ballonsportes in Deutschland. Die Zeit von
1900 bis 1939, Bd. 1 (hrsg. vom Deutschen Freiballonsport-Verband e. V.). o. O.
1993, hier S. 8. Später wird der Verein in „Berliner Verein für Luftschiffahrt
e. V.“ umbenannt.
[22]
Vgl. HStA Düsseldorf, Best. Polizeipräsidium Köln, Nr. 49 (Briefkopf eines
Schreibens bzw. Schreiben von Maximilian Wolff an den Polizeipräsidenten von
Köln, 6. Juni 1889 und 7. Juni 1890); MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 8.
[23]
Der sog. altkölnische Festplatz zwischen Flora und dem zoologischen Garten wird
vom Volksmund wegen der vielen Vergnügungsgärten das „Goldene Dreieck“ genannt.
[24]
Vgl. DIETMAR, Carl: Die Chronik Kölns. Dortmund 1991, hier S. 273. Die
Ausstellung dauert vier Monate an und findet im Vergnügungspark „Kaisergarten“
des „Goldenen Dreiecks“ statt.
[25]
Vgl. Kölner Local-Anzeiger, 11. Juni 1889, Nr. 56; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 9.
[26]
Die Ausstellung dauert vom 16. Mai bis 15. Oktober 1889 an und findet im
heutigen nördlichen Teil des Zoologischen Gartens, in Nähe der Flora, statt.
[27]
Vgl. Kölner Local-Anzeiger, 11. Juni 1889, Nr. 56; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 9.
[28]
Vgl. Kölnische Nachrichten, 9. Juli 1890, Nr. 154; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.),
S. 10.
[29]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 9; Diese Ereignisse vom 7. Juli 1890 werden in 27
weiteren Zeitungen in ganz Deutschland veröffentlicht.
[30]
Vgl. HStA Düsseldorf, Best. Polizeipräsidium Köln, Nr. 49; MAYER, MÜLLER-AHLE
(o. D.), S. 11.
[31] Vgl. SUNTROP (2001), S. 10.
[32] Vgl. VOGT (1993), S. 24–32.
[34]
Vgl. Rheinisch-Westfälische Zeitung, Nr.1238, 27. Juni 1910; MAYER, MÜLLER-AHLE
(o. D.), S. 8.
[35] Vgl. MACKWORTH-PRAED (1993), S. 83.
[36] Vgl. FRANZ CLOUTH. RHEINISCHE
GUMMIWARENFABRIK AG (Hrsg.): 90 Jahre Franz Clouth. 1862-1952. Köln o. D., hier
S. 13. Die Firma Clouth liefert u. a. 1899 den Ballonstoff für das erste
Luftschiff des Grafen Zeppelin ‘LZ 1’.
[37]
Vgl. FRANZ CLOUTH (o. D.), S. 14. Der Bau besteht mindestens bis 1912. Aus
welchem Material die Halle besteht, ist nicht zu sagen; sie brennt Jahre später
ab.
[38]
Vgl. CLOUTH GmbH, Firmenarchiv, Liste der Zeitungsartikel im Zusammenhang mit
der Brüsselfahrt des Luftschiffes ‘Clouth’ vom 20. Juni 1910. An dieser Stelle
bedankt sich der Autor bei Herrn Wolfgang Beier, der u. a. das Archiv der
„Clouth GmbH“ leitet, für seine Hilfe und zahlreichen Hinweise.
[39]
Vgl. CLOUTH GmbH, Firmenarchiv (Liste der angefertigten Bauteile). Einige
Dokumente im Archiv der Firma „Clouth“ belegen jedoch die Absicht vom Bau eines
zweiten Luftschiffes. Obwohl bereits verschiedene Bauteile angefertigt wurden,
wurde die Konstruktion anschließend nie abgeschlossen
[40]
Vgl. FRANZ CLOUTH (o. D.), S. 13.
[41]
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 12.
[42]
MACKWORTH-PRAED (1993), S. 51.
[43]
MAYER, Edgar: Glanzlichter der frühen Luftfahrt in Köln. 75 Jahre
Butzweilerhof. Oldenburg 2001 (= Luftfahrtgeschichte von Köln und Bonn, Bd. 1,
hrsg. von der Fördergesellschaft für Luftfahrtgeschichte im Kölner-Raum e. V.),
hier S. 89.
[44]
HOHMANN (1993), S. 12.
[45]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 53. Dort ist eine nach dem jeweiligen Gründungsdatum
chronologisch angeordnete Liste der Vereine (bis 1910) zu finden.
[46]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 11; VOGT (1993), S. 32–36.
[47]
Vgl. KÖLNER KLUB FÜR LUFTSPORT e. V. (Hrsg.): Festschrift zum 75jährigen Bestehen
des Kölner Klub für Luftsport e. V. Köln o. D, hier S. 17.
[48]
Vgl. MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 14; KÖLNER KLUB FÜR LUFTSPORT e. V. (o.
D.), S. 17.
[49]
HOHMANN (1993), S. 12.
[50]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 120/121.
[51]
Vgl. STADE, Hermann (Hrsg.): Jahrbuch des Deutschen Luftschiffer-Verbandes
1911. Berlin 1911, hier S. 150/151.
[52]
Vgl. HOHMANN (1993), S. 53.
[53]
MAYER (2001), S. 18.
[54]
Preise, jeweils Tageskarte: Korbplatz/Herren 10, Damen 8 und Kinder 4 Mark;
Promenadenplatz/5, 3 und 1,50 Mark; Rasenplatz/alle 0,75 Mark. Der Stundenlohn
eines beispielsweise Kohlentransportarbeiters beträgt 0,43
Mark.
[55]
Vgl. Rheinische Zeitung, 22. Juni 1909, Nr. 141 und 26. Juni 1909, Nr. 145;
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 17.
[56]
Vgl. das „Fest-Programm zur grossen internationalen Flug-Woche, Cöln am Rhein
vom 30. September bis 6. Oktober 09“.
[57]
Bisweilen ist auch die Schreibweise mit doppeltem „e“ – „Meerheim“ sowie mit
„h“ – „Mehrheim“ – zu finden.
[58]
Blériots Geschwindigkeitsrekord liegt bei ca. 60 km/h.
[59]
Die erste bedeutende Veranstaltung findet am 23. Mai 1909 auf dem Flugfeld
Port-Aviation, südlich von Paris, statt.
[60]
In Johannisthal, südöstlich von Berlin, werden 1909 bzw. 1908 beispielsweise
von den Pferderennbahnen Holztribünen übernommen; in Brookland/England finden
ab 1909 die Flugschauen unweit der 1907 gebauten Rennstrecke statt.
[61]
GÄRTNER, Ulrike: Flughafenarchitektur der 20er und 30er Jahre in Deutschland.
Diss. Marburg/Lahn 1990, hier S. 11: „Inoffiziell beschäftigte sich aber auch
das deutsche Militär seit 1909 mit der Konstruktion eines Flugzeugs.“
[62]
Eine eingehende Darstellung der Kölner Flugpioniere kann im Rahmen der
vorliegenden Ausführungen nicht geleistet werden. Dazu bedarf es einer
eigenständigen Schilderung, um diesem Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte gerecht
zu werden.
[63]
Die Veranstaltung beinhaltet Preise in Höhe von 100000 Mark, gestiftet von der
Berliner Zeitung/Ullstein-Verlag, sowie Geldpreise des Preußischen
Kriegsministeriums, von Flugsportvereinen, Städten und Gemeinden. Bei dieser
Veranstaltung, bei der nur deutsche Flieger zugelassen sind, werden insgesamt
13 Tagesetappen mit 1854 km zurückgelegt.
[64]
Vgl. DIETMAR (1991), S. 228. Zu Beginn der preußischen Herrschaft wird Köln von
König Friedrich Wilhelm III. zur Festung erklärt.
[65]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 54. Die Stadt beabsichtigt den bestehenden Pachtvertrag
mit dem Landwirt des Butzweiler Hofs zu kündigen, um
das Feld uneingeschränkt für die Fliegerei zur Verfügung zu stellen.
[66]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 60.
[67]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 65.
[68]
Vgl. THIEME, Ulrich, BECKER, Felix: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,
22. Bd. (Krügner-Leitch). Leipzig 1928, S. 377. Bei dem Künstler handelt es
sich vermutlich um Franz Xaver Laporterie (geb. 1754 in Bonn, gest. ?), dem ersten Sohn von Peter Laporterie. Franz Xavers
künstlerische Tätigkeit in Köln - vorwiegend als Stecher - ist dort seit 1780
bezeugt.
[69]
Vgl. HAStK, Best. Franz. Verw., Nr. 5012; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 4.
[70] Vgl. LOCHER,
Walter: Militärische Verwendung des Ballons. In: Leichter als Luft, 1978, S.
238–250, hier S. 238 (= Ausst.-Kat. Leichter als Luft. Zur Geschichte der
Ballonfahrt. 24.09.–26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte, bearb. von Bernard Korzus. Greven 1978).
[71]
LOCHER (1978), S. 243.
[72]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 3. Der „Revue- und Schiessplatz“ Wahner Heide wird im
Frühjahr des Jahres 1817 auf Weisung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm
III. angelegt. In den nachfolgenden Jahren wird der Übungsplatz immer wieder
vergrößert.
[73]
Zur allgemeinen Kennzeichnung der deutschen Luftschiffe: LZ =
Zeppelin-Luftschiff; PL = Parseval-Luftschiff. Militärluftschiffe tragen
zunächst ein „Z“, später zusätzlich ein „L“ vor der Ordnungsnummer.
[74]
Vgl. SCHMITT, Günter: Als die Oldtimer flogen. Die Geschichte des Flugplatzes
Johannisthal. Berlin (DDR) 19872, hier S. 16.
[75]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 18.
[76]
Die Gründung der „Deutschen Luftschiffahrts AG Frankfurt a. M.“ (DELAG) erfolgt
am 16. November 1909.
[77]
ENGBERDING, Dietrich: Luftschiff und Luftschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Berlin 1926, hier S. 239.
[78]
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 28.
[79]
Diese Fahrt ist der dritte Versuch, Köln zu erreichen; am 2. bzw. 4. August
musste ‘LZ 5’ wegen schlechten Wetters bzw. eines technischen Defekts
unfreiwillig die Rückfahrt antreten.
[80]
DIETMAR (1991), S. 313.
[81] Vgl. SONNTAG,
Richard: Über die Entwicklung und den heutigen Stand des deutschen
Luftschiffhallenbaus. In: Zeitschrift für Bauwesen, Heft 62, 1912, S. 571–614,
hier S. 599.
[82]
Ein Wettbewerb, der die Gestaltung einer Luftschiffhalle klären sollte, wurde
im Oktober 1908 in Deutschland ausgeschrieben; der Entwurf der
Brückenbauanstalt „Augsburg-Nürnberg AG“ erhält den dritten Preis.
[83]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 25.
[84]
SONNTAG (1912), S. 574.
[85]
SONNTAG (1912), S. 574.
[86]
Vgl. Endnote
37. Formal ist die Luftschiffhalle in Bickendorf
durchaus mit der Luftschiffhalle der Firma Clouth von 1907 vergleichbar.
[87]
Vgl. SONNTAG (1912), S. 596.
[88]
SONNTAG (1912), S. 582. Die Dauer des Vorgangs ‘Öffnen/Schließen’ einer
Luftschiffhalle mit maschinenbetriebener Hallenöffnung betrug damals ca. 15
Minuten.
[89]
Vgl. VON TSCHUDI, Georg: Luftschiffhäfen, Ankerplätze und Flugplätze. In:
Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift, Nr. 15, Jg. XVI, 1912, S. 361-364, hier S.
362. Eine Auflistung aller bis einschließlich 1912 existierenden
Luftschiffhallen, Flugplätze, Flugfelder und Landungsplätze in Deutschland ist
dort zu finden.
[90] Vgl. SUNTROP (2001), S. 53.
[91] MAYER (2001), S. 15.
[92]
MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 22.
[93]
Vgl. MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 22–24.
[94]
Vgl. MACKWORTH-PRAED (1993), S. 140.
[95]
Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger, Nr. 494/495, 28./29. Oktober 1909 sowie Nr.
505–507, 4.–6. November 1909; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 23; SUNTROP (2001),
S. 34.
[96]
Vgl. KNÄUSEL, Hans G. (Hrsg.): Zeppelin. Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Bonn
1988, S. 161.
[97]
Vgl. KNÄUSEL (1988), S. 163. ‘(Ersatz-)Z II’ ist die offizielle
Betriebsbezeichnung des Luftschiffes.
[98]
Vgl. SUNTROP (2001), S.44 u. 52.
[99] Vgl.
Kölner Stadt-Anzeiger, 1. Mai 1912, Nr. 199; MAYER, MÜLLER-AHLE (o. D.), S. 30.
[100]
Vgl. SUNTROP (2001), S. 49. Die Erlaubnis ist an die Bedingung geknüpft, dass
fotografische Apparate nicht mitgeführt werden dürfen. Zudem muss zu jedem
Aufstieg ein Vorstandsmitglied des CCfL anwesend sein.
[101]
VON KLEIST, Ewald: Militär und Luftschiffahrt. In: Wir Luftschiffer, 1909, S.
285–306, hier S. 306.
[102]
Vgl. VON TSCHUDI (1912) S. 362/363. Im Jahr 1911 sind bereits in u. a. in
Straßburg und Metz Militär-Fliegerstationen errichtet worden.
[103]
SUNTROP (2001), S. 65.
[104] TÜRK, Oskar:
Der Flughafen Köln in der Geschichte der Kölner Luftfahrt. In: Deutsche
Flughäfen, Heft 6/7, 4. Jg., 1936, S. 7–15, hier S. 10.
[105] Vgl. TÜRK
(1936), S. 10.
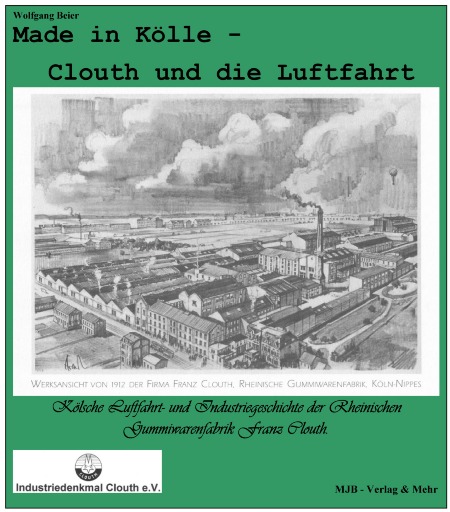

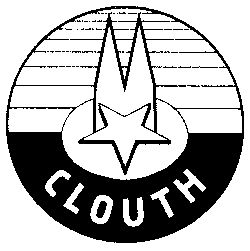
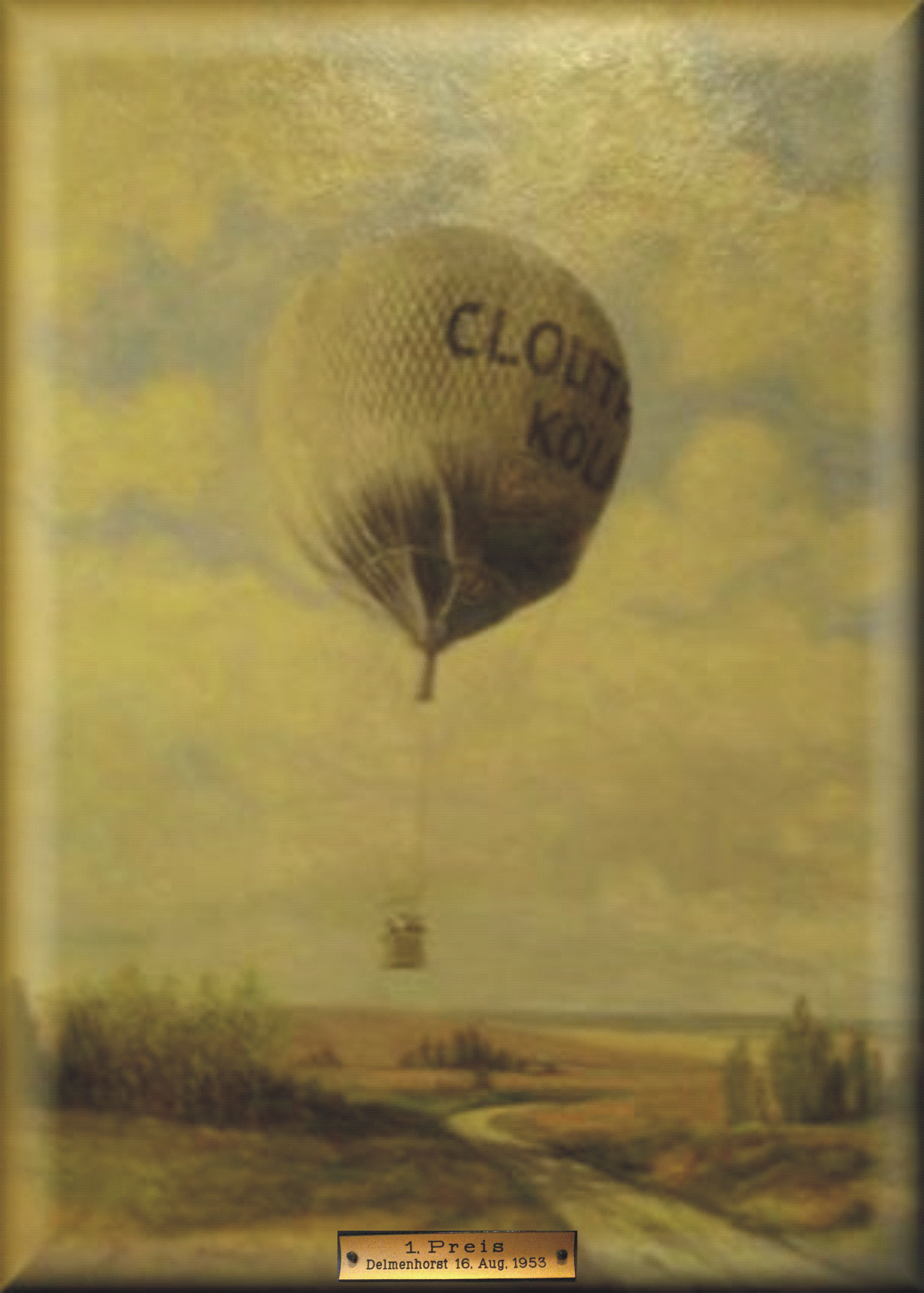
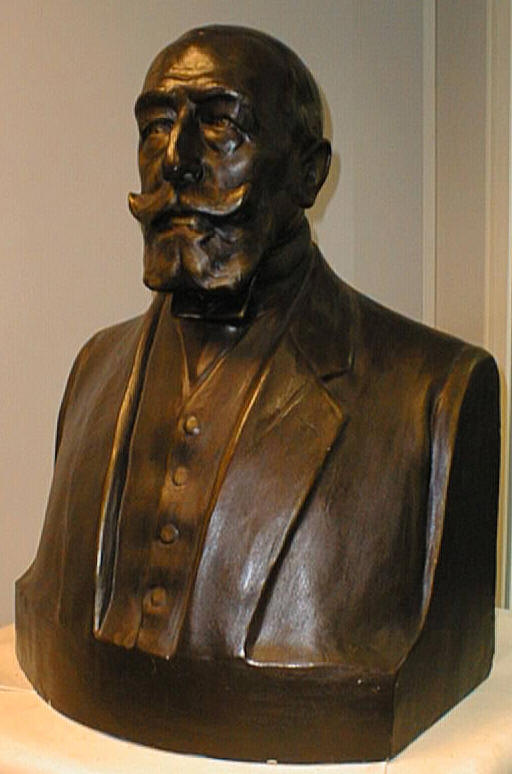
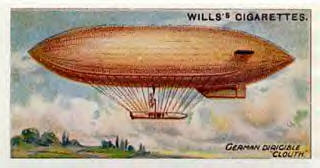
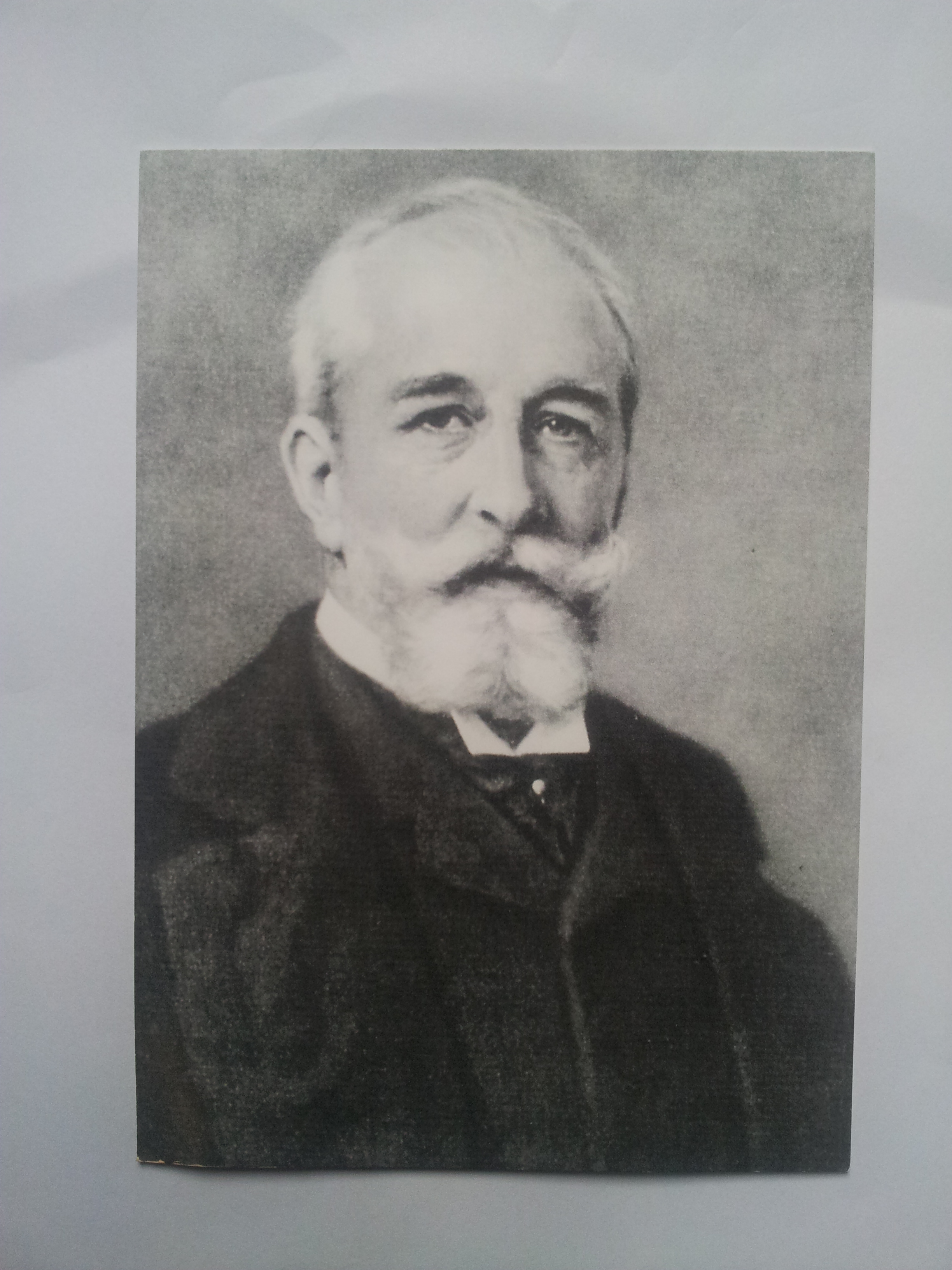
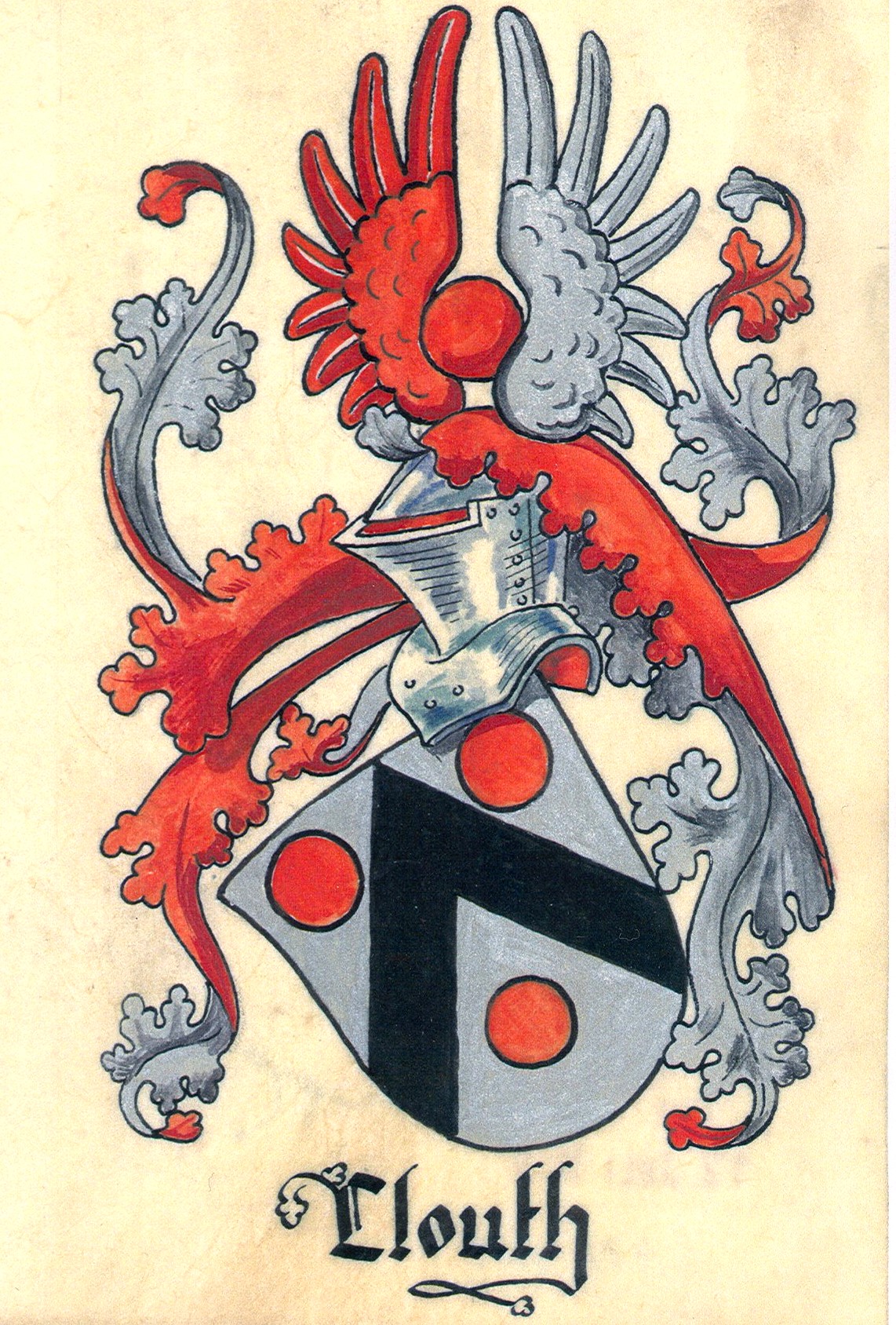

Vater Franz Clouth Familienwappen Clouth Köln,
eingetragen in die Wappenmatrikel 1923 Sohn
Max Clouth
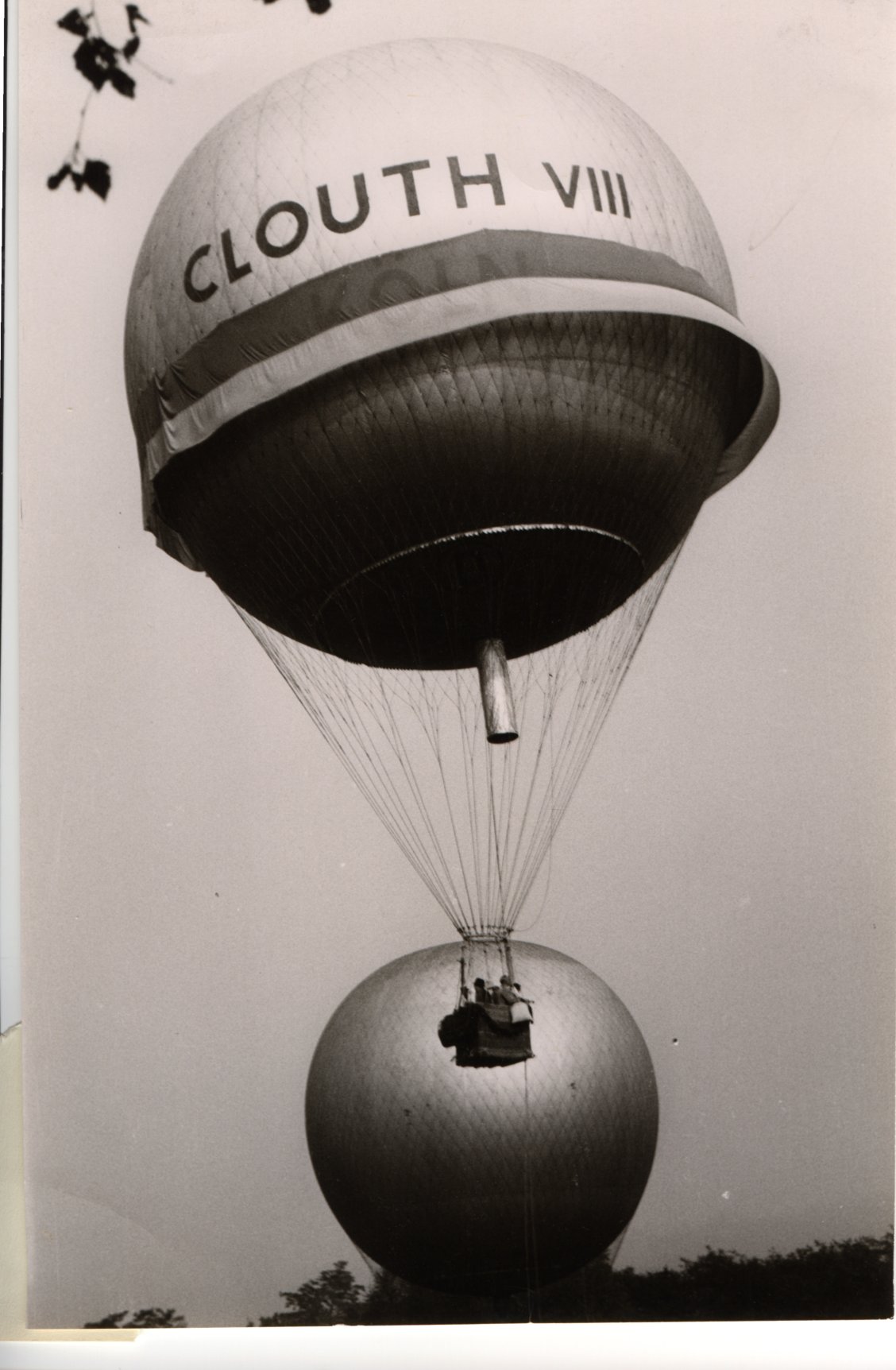

Tauffahrt
Clouth VIII
Max Clouth im Alter
Groß war, wie gesagt, das Erstaunen, als das von Hauptmann von
Kleist gesteuerte Luftschiff und angemeldet am 21. Juni 1910 auf der
Internationalen Industrieausstellung in Brüssel erschien. Für die 200 Kilometer
lange Strecke hatte es fünf Stunden benötigt. Die Brüsseler und viele andere
ausländische Blätter würdigten das Ereignis in ausführlichen Artikeln. Im Jahre
1910 wurde die Abteilung " Luftschiff-Bau " mit der Luftfahrzeuggesellschaft
mbH. in Berlin vereinigt, nachdem Clouth noch ein zweites lenkbares Luftschiff
nachdem halbstarren System "Parseval gebaut hatte. Beide Luftschiff gingen in
den Besitz der Berliner Gesellschaft über. Goldene Medaillen sind die bis heute
noch verbliebenen Auszeichnungen für die Erfolge, die Clouth in der Luftschiff
errang.
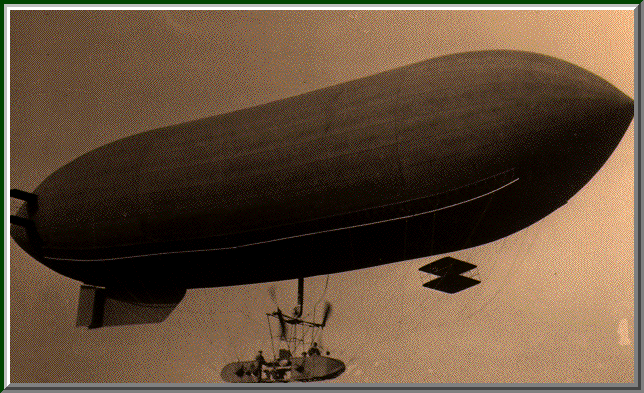
Butzweiler Hof Flughafen


ZEPPELIN, der erste
Langstreckenbomber im 1. Weltkrieg
(N24 Serie)
1.
Weltkriegwoche
2. Gesamte Serie 1. Weltkrieg & Zeppeline
3. Zurück
zum Zeppelin im 21. Jahrhundert?
4.english:
The War
File The Zeppelin Documentary
5. Die
Geschichte der Hindenburg
6.World
War One - Terror In The Skies
|
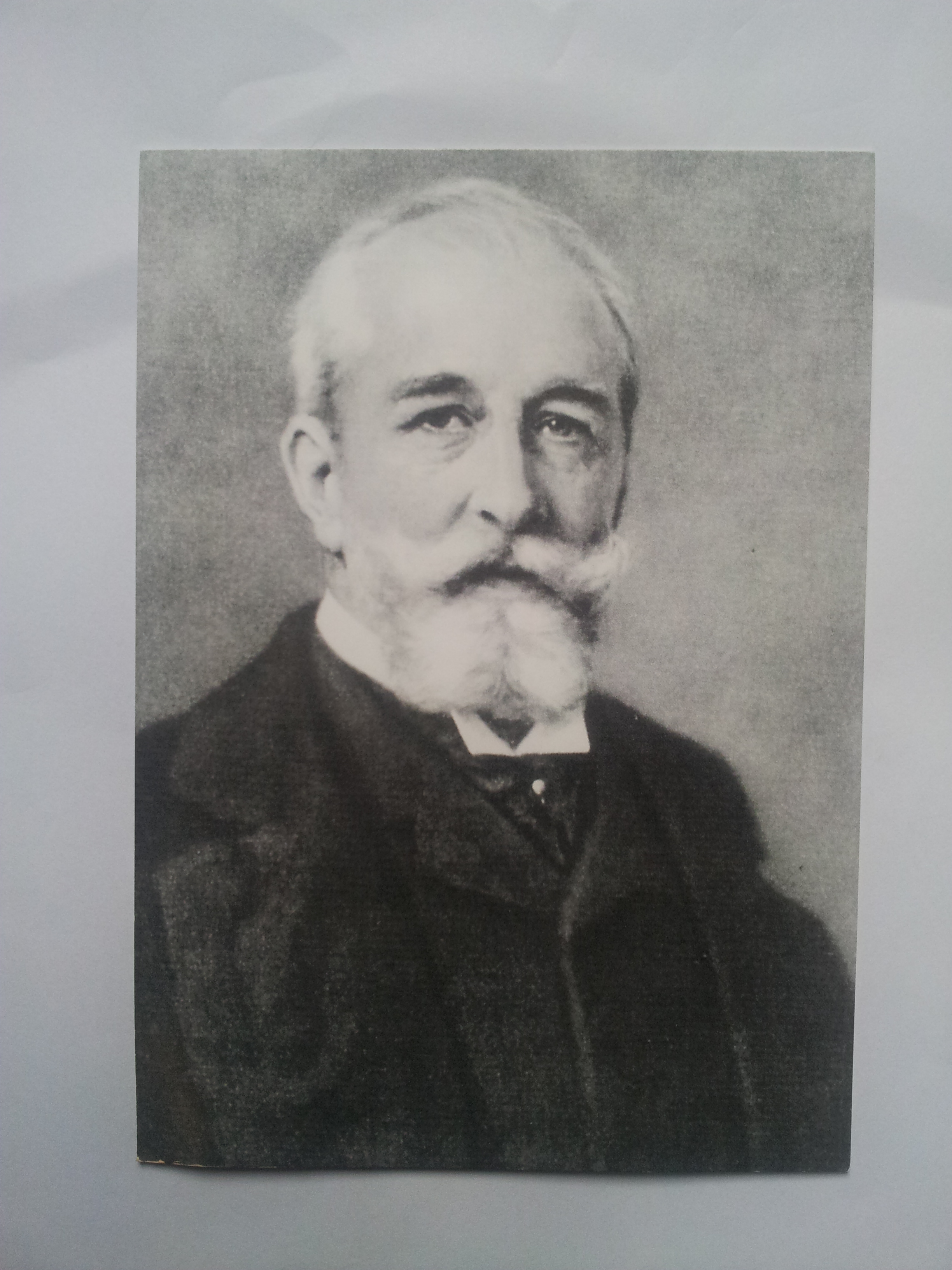

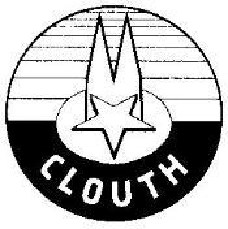

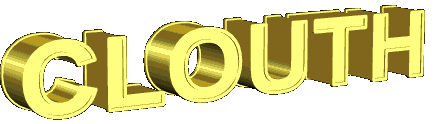


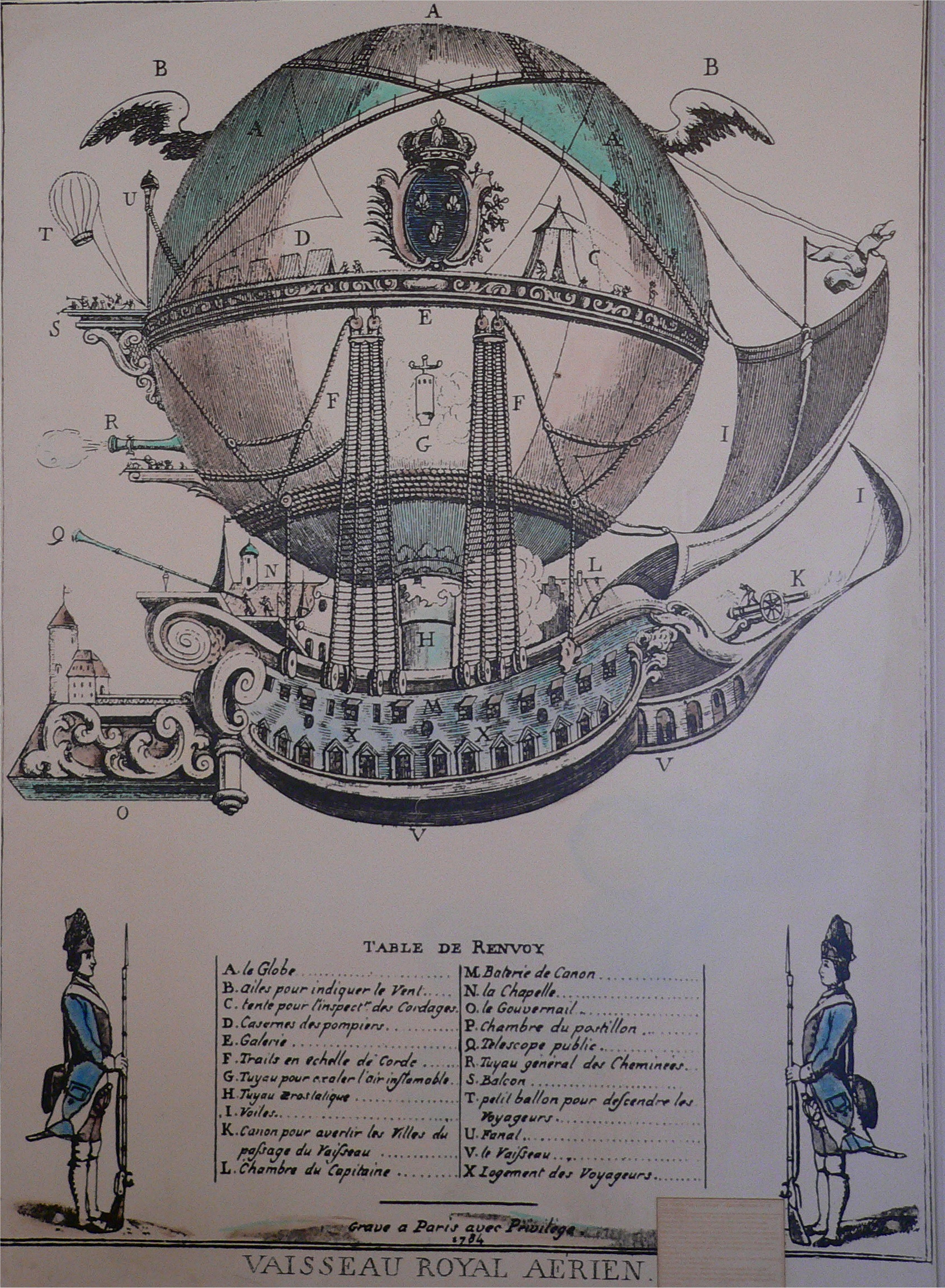

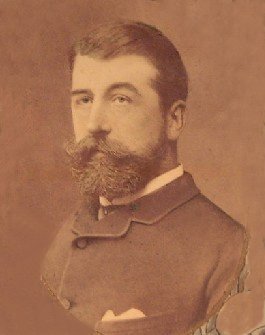
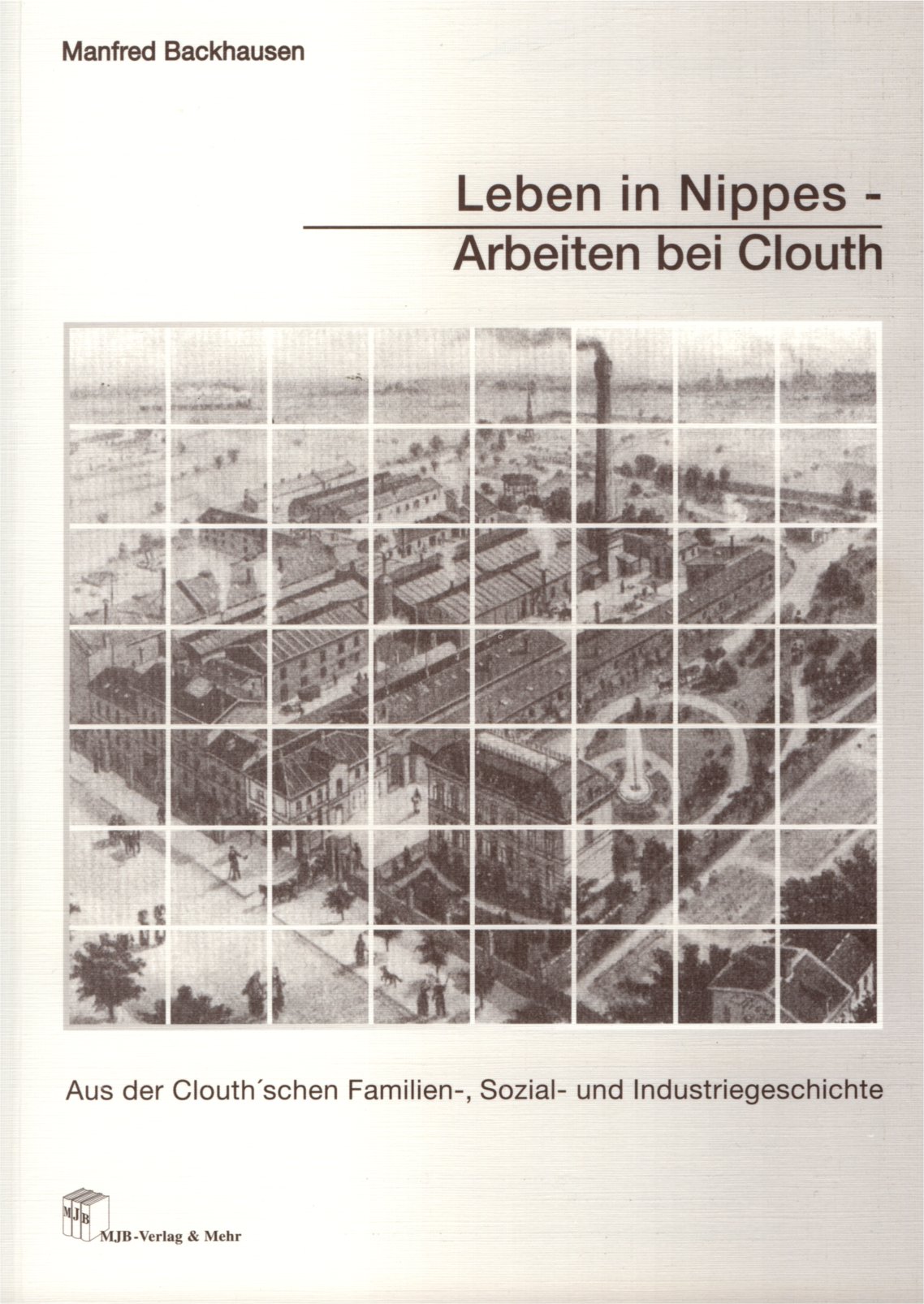

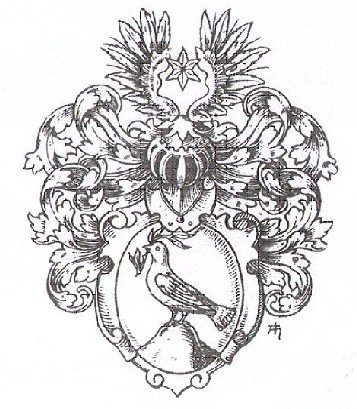
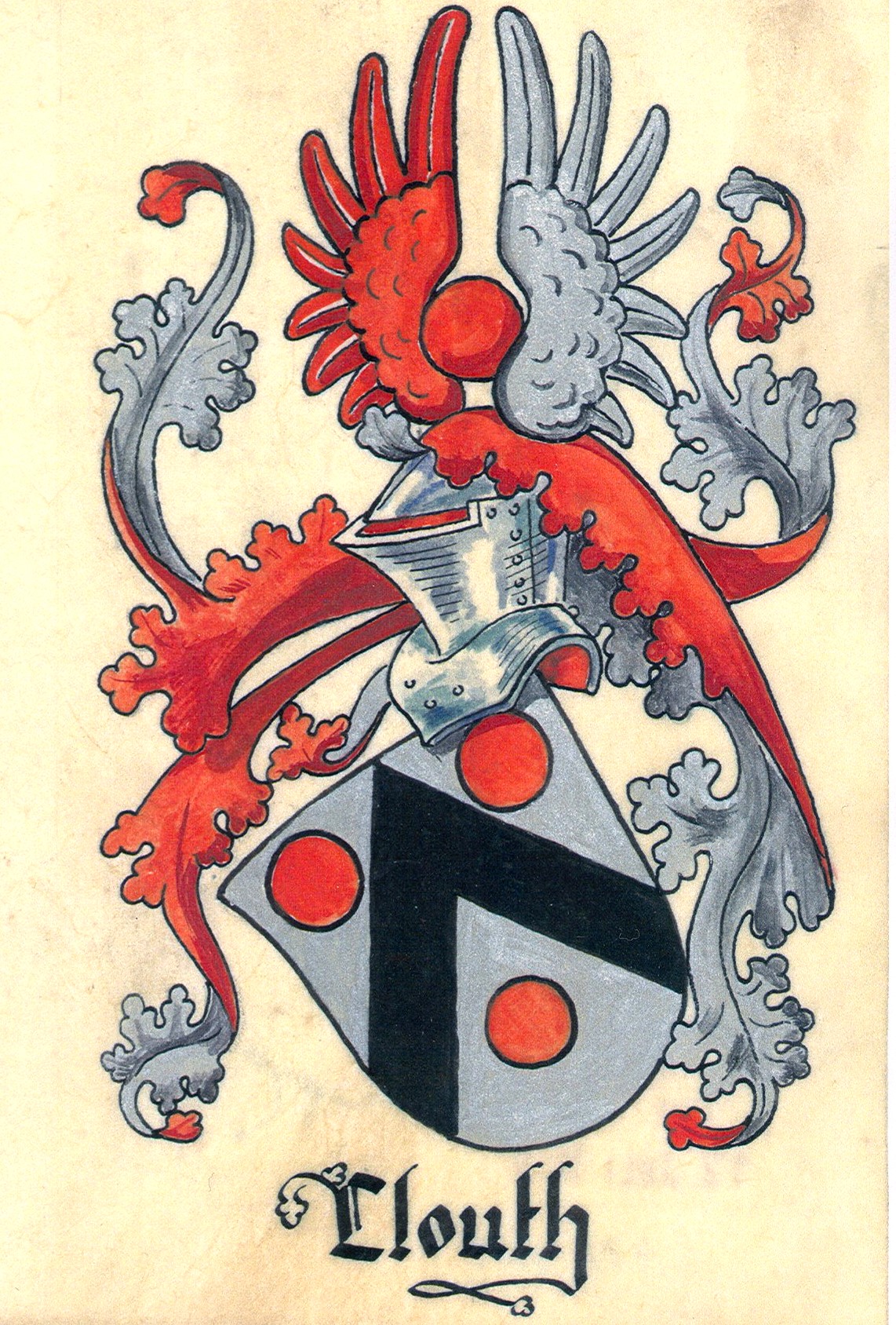

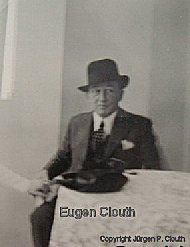
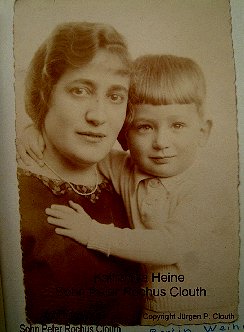


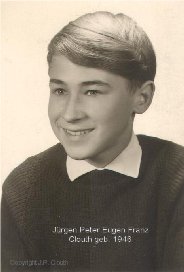



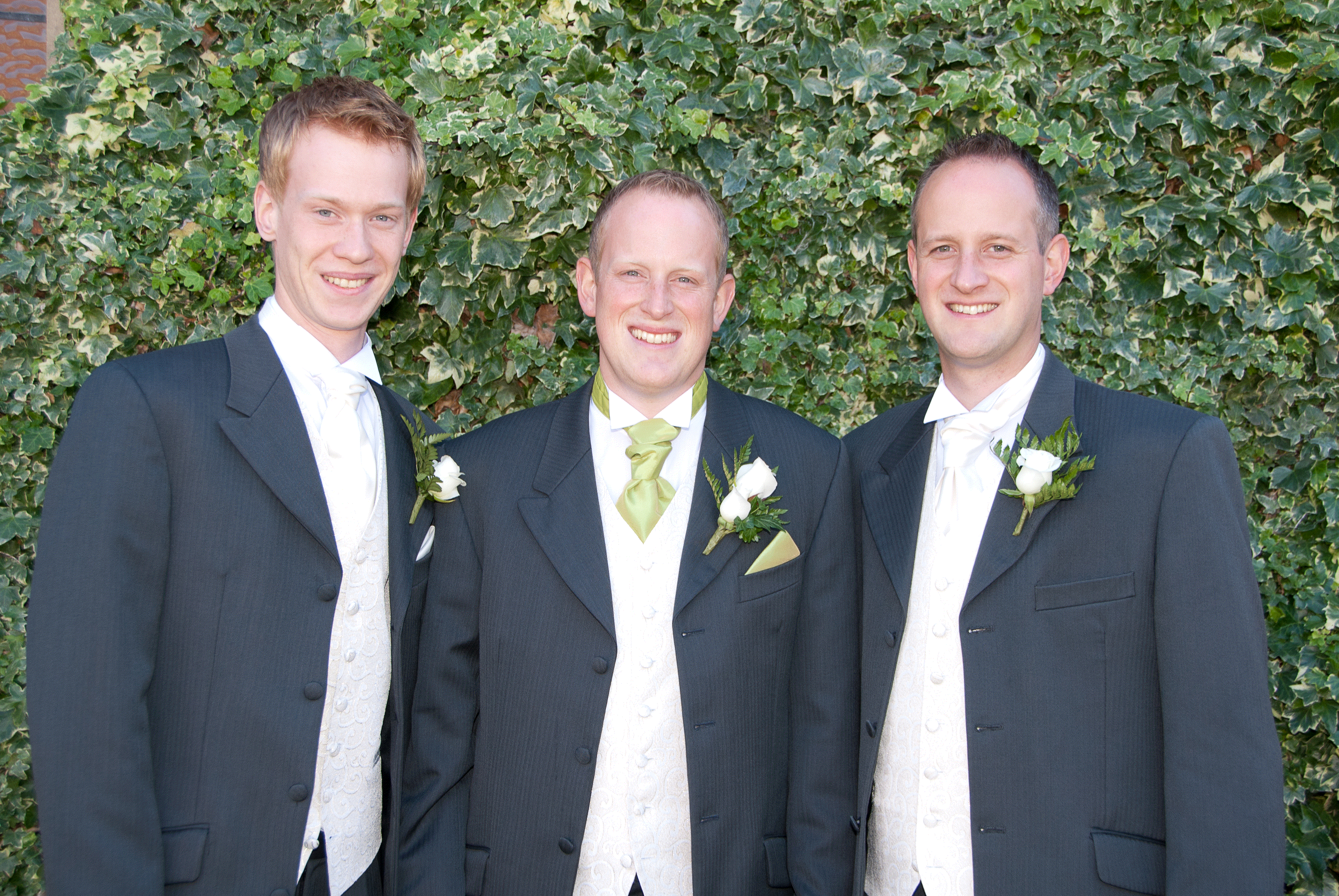


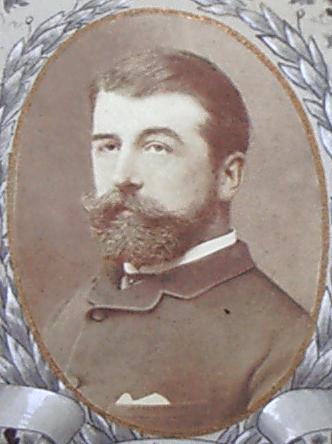

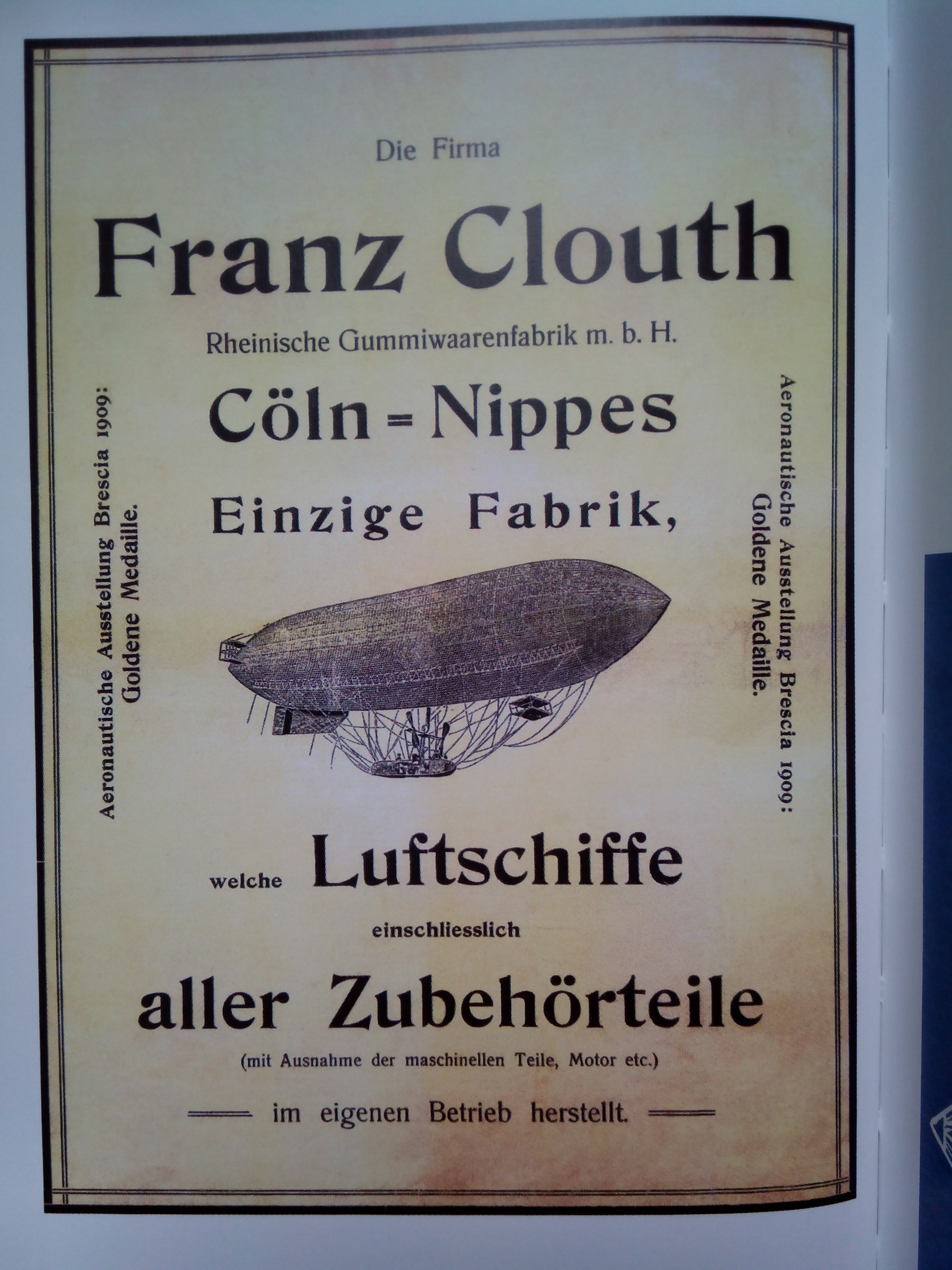
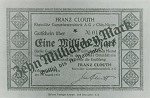




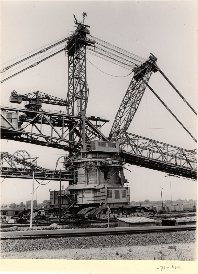
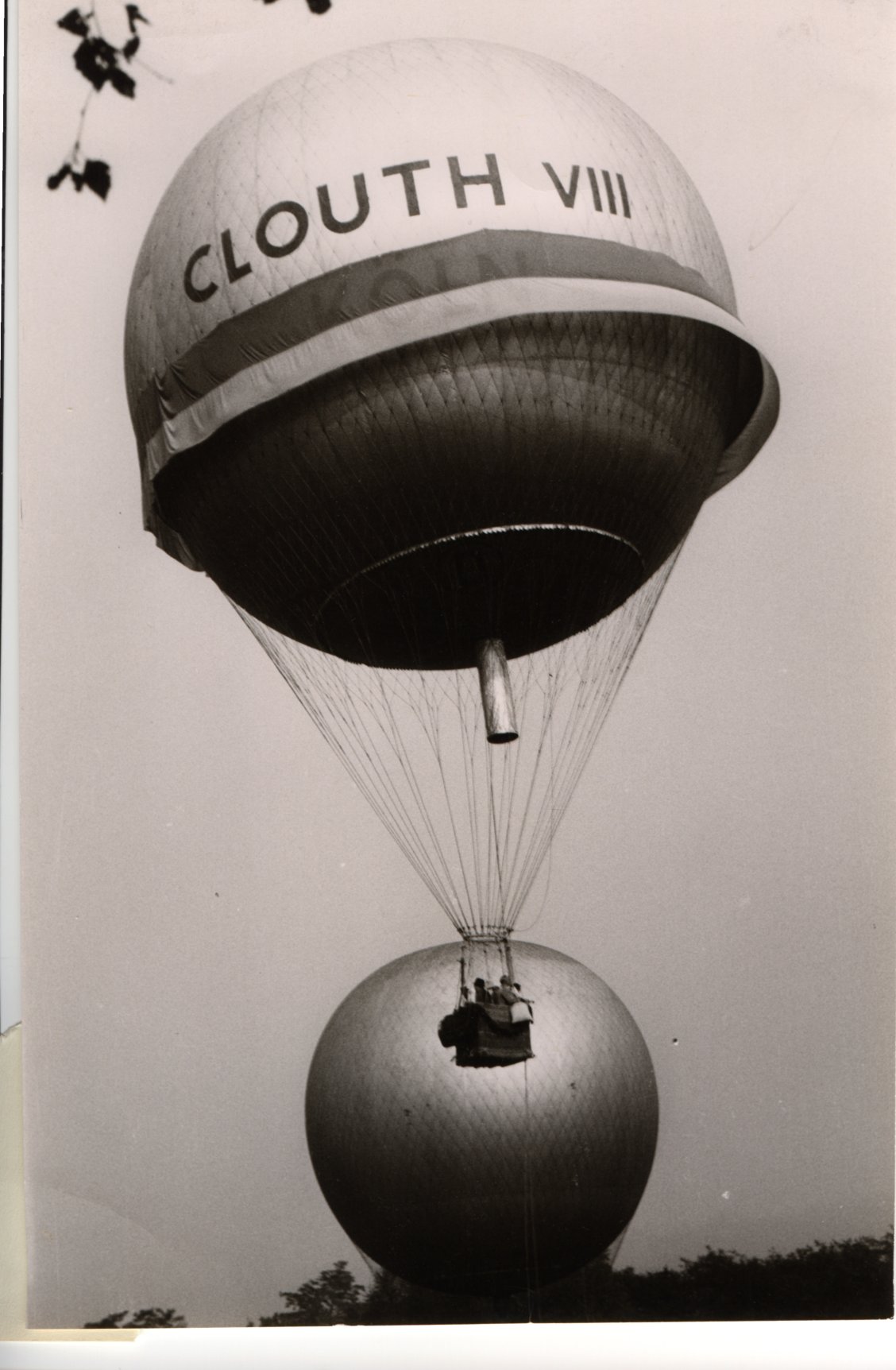



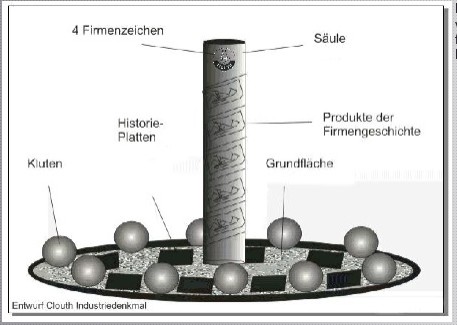
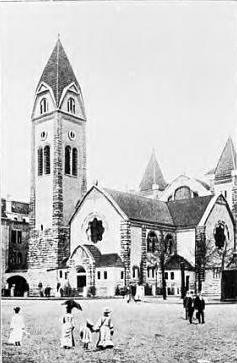

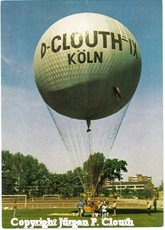

.jpg)
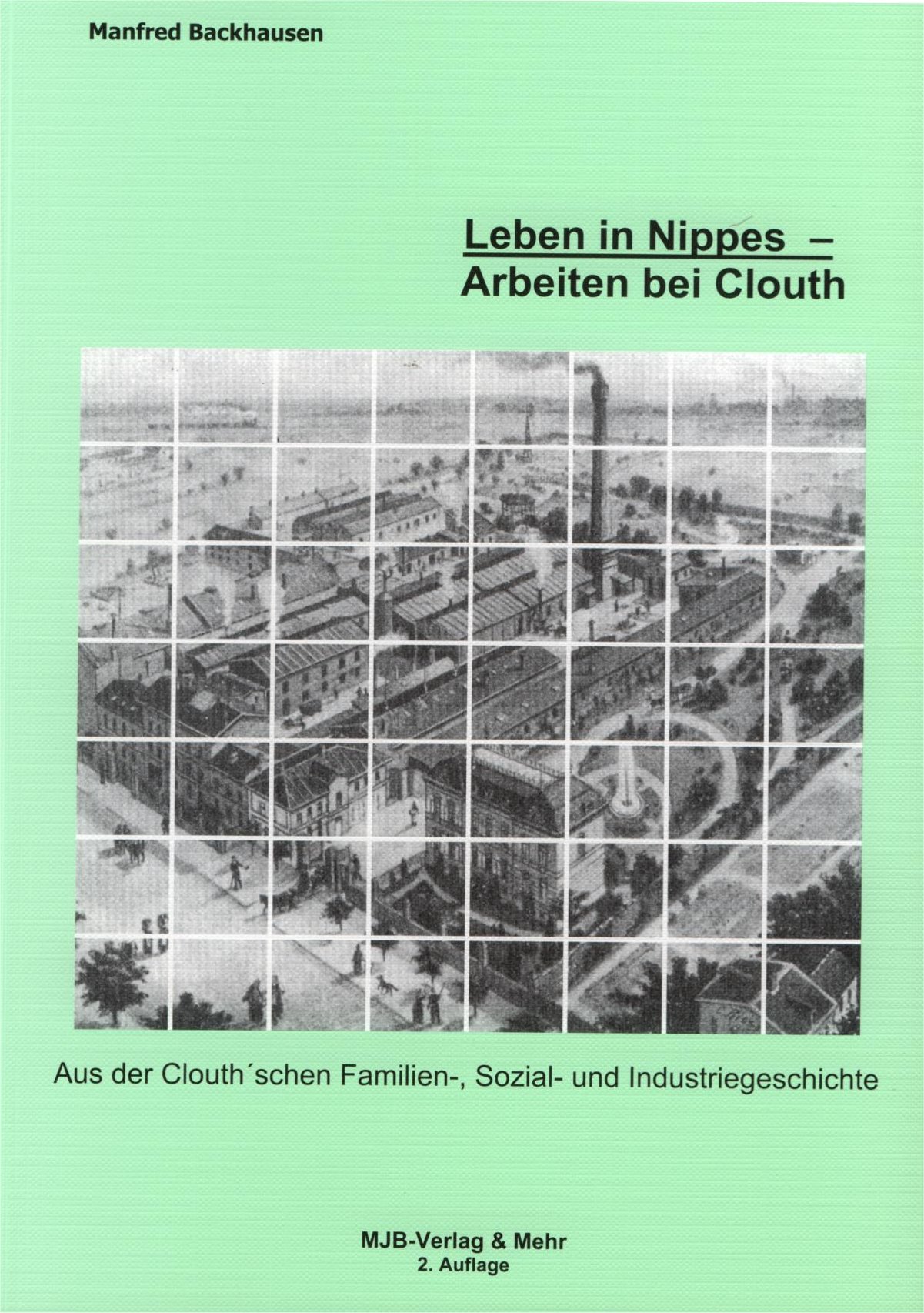
.jpg)



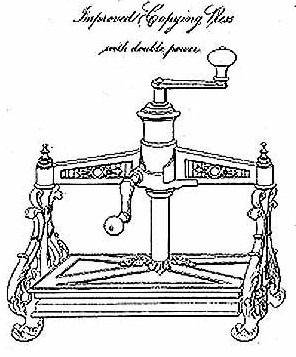
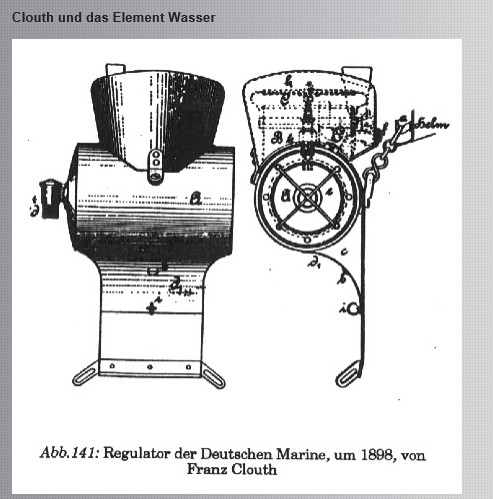



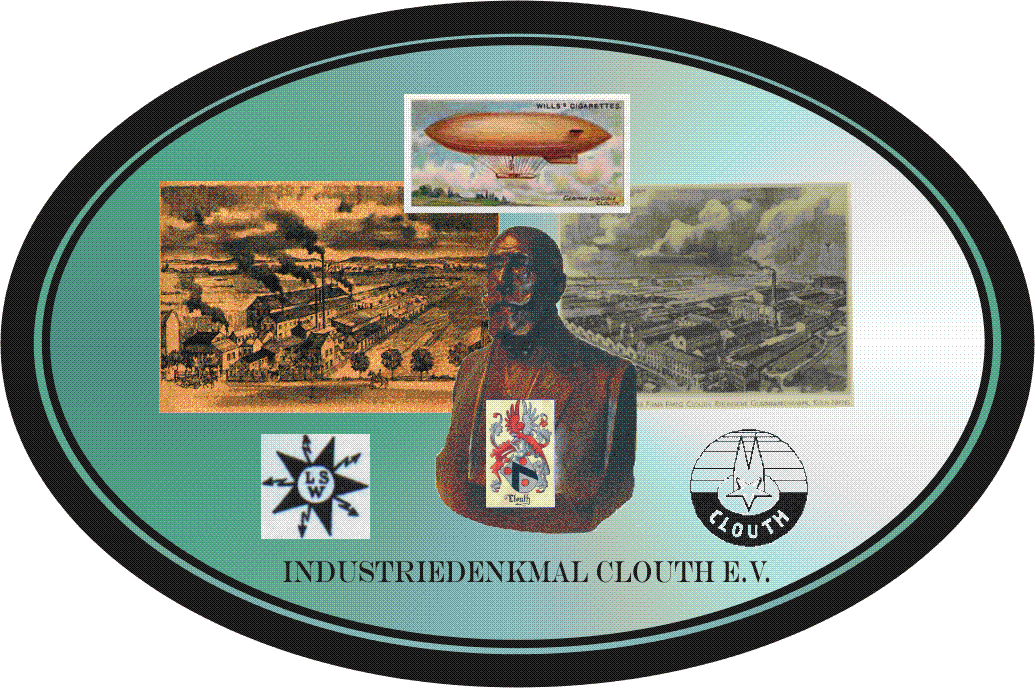




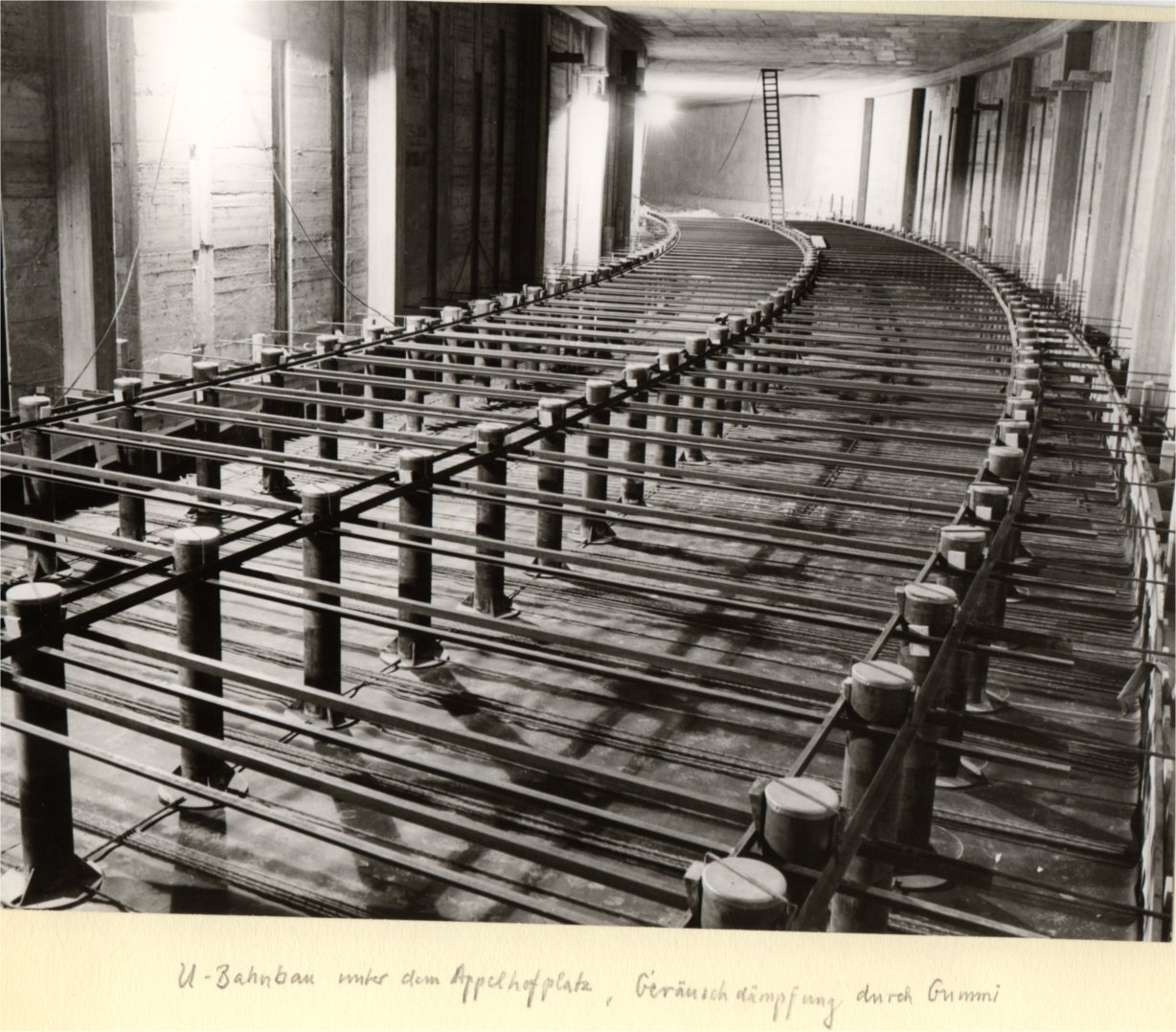
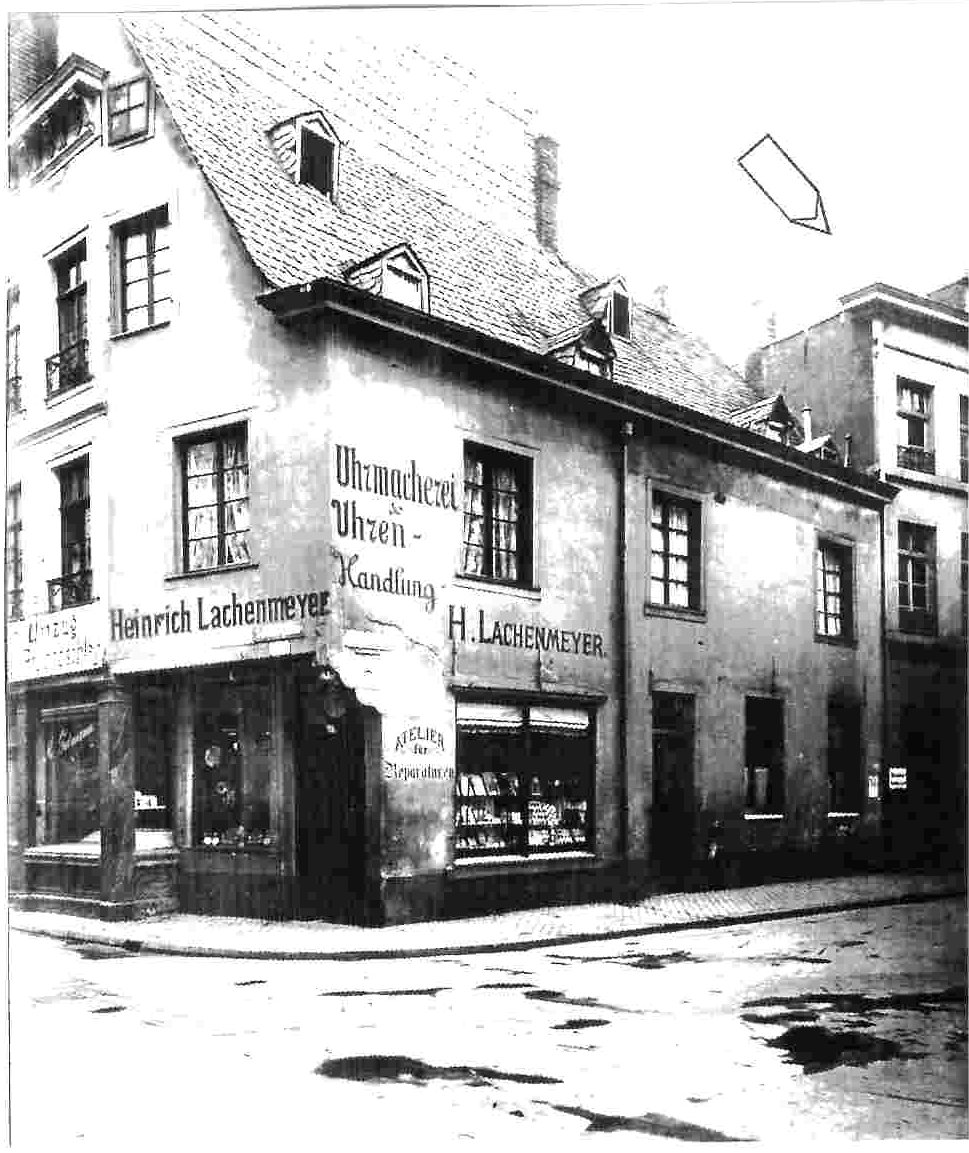

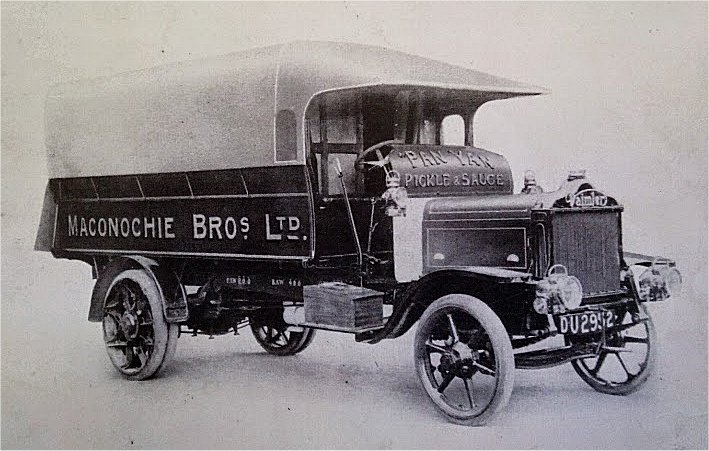
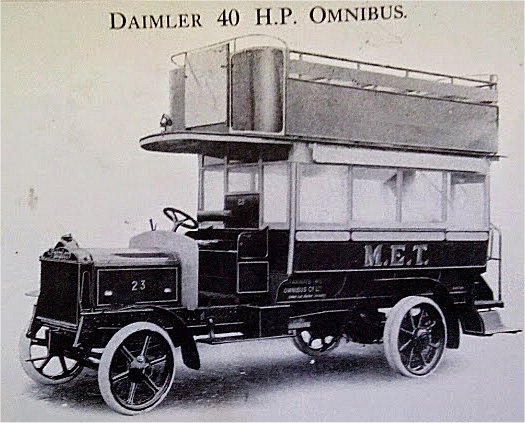


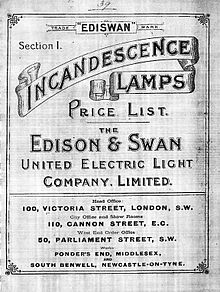




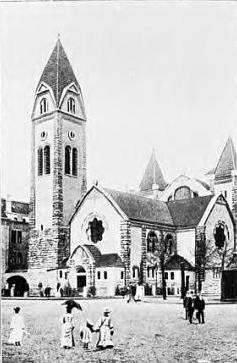
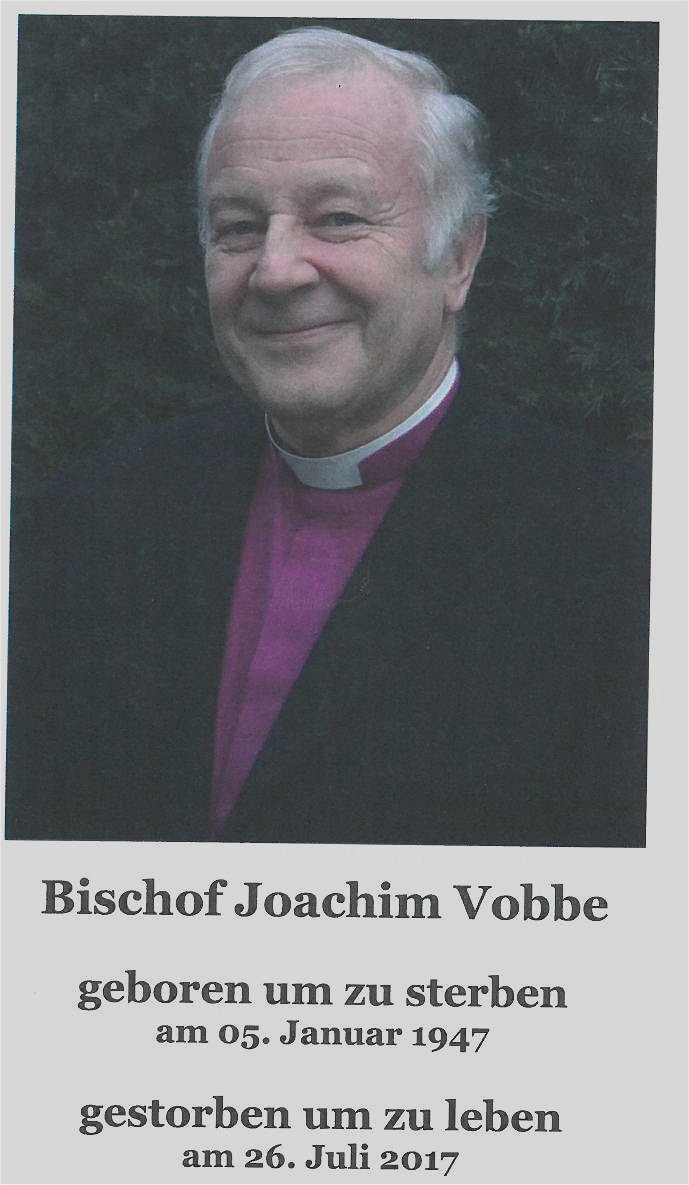
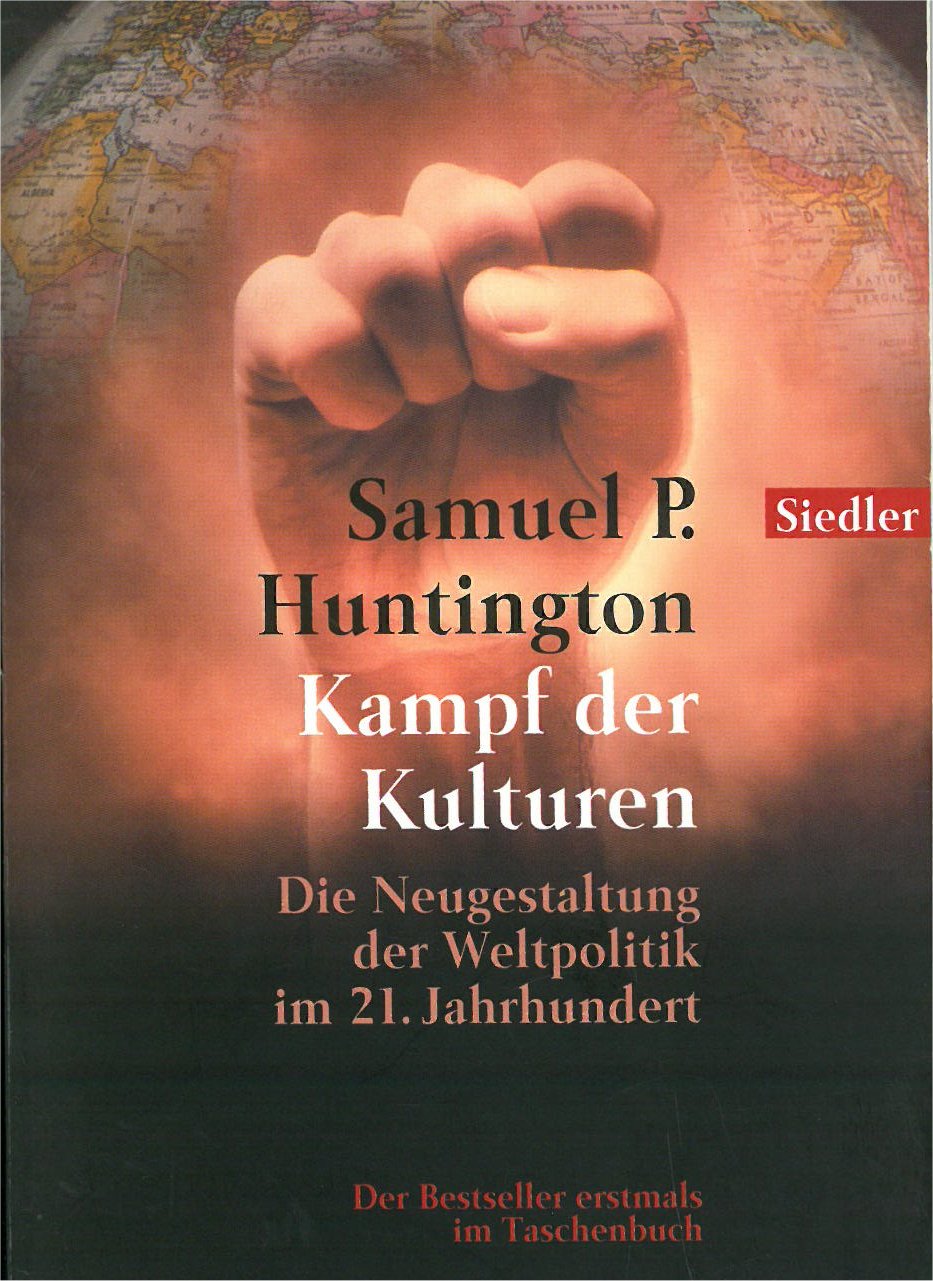
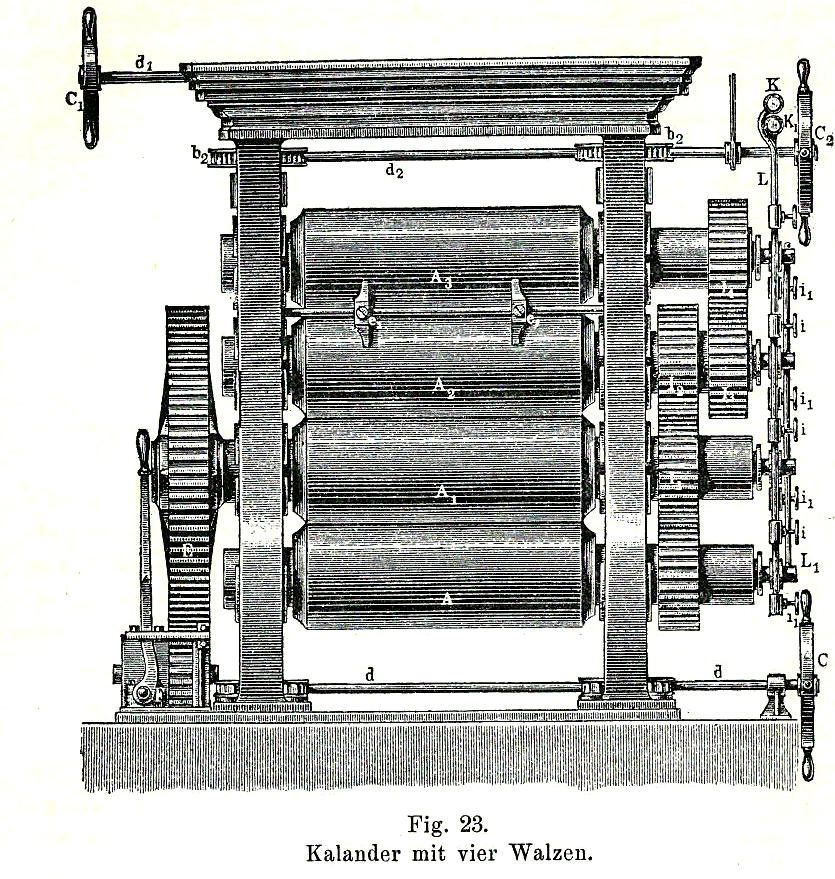
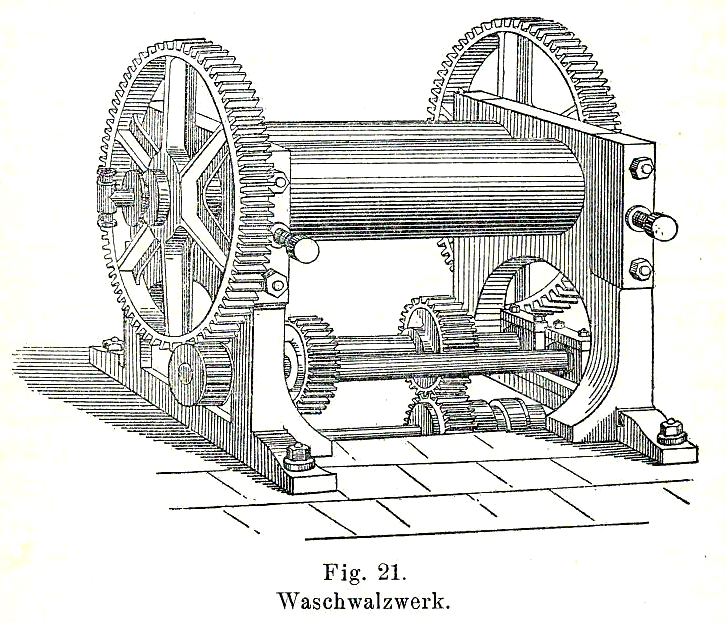

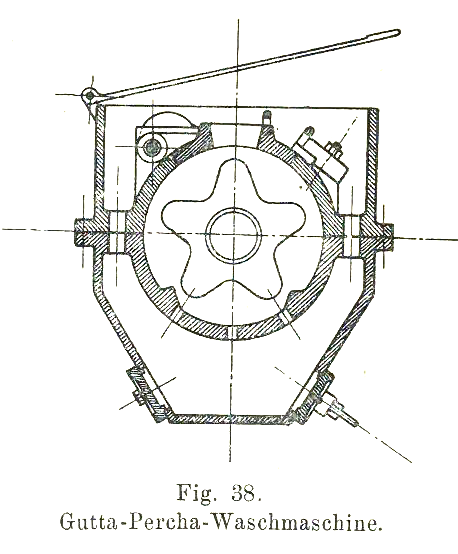
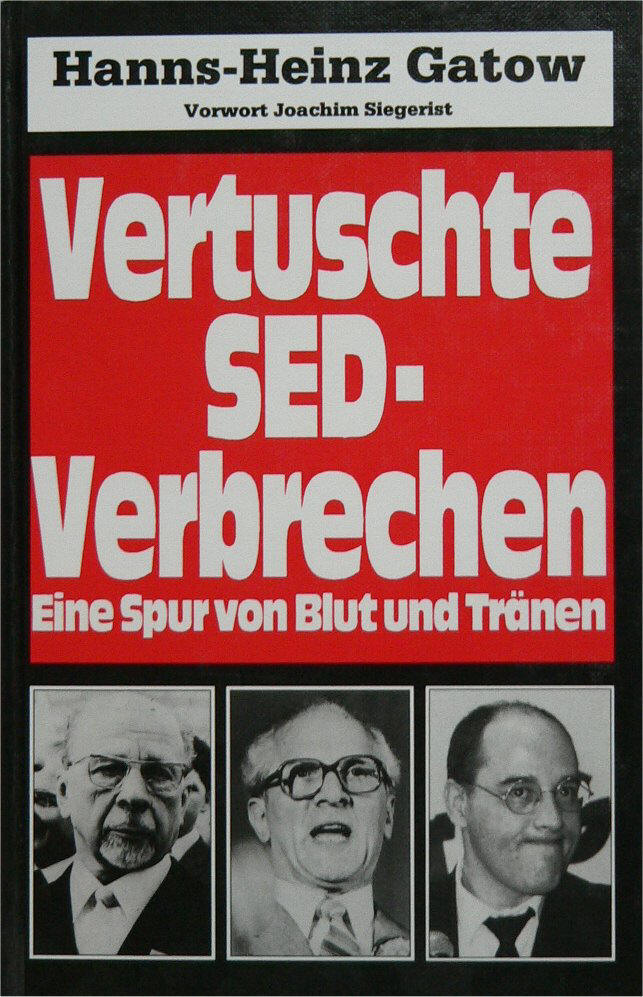
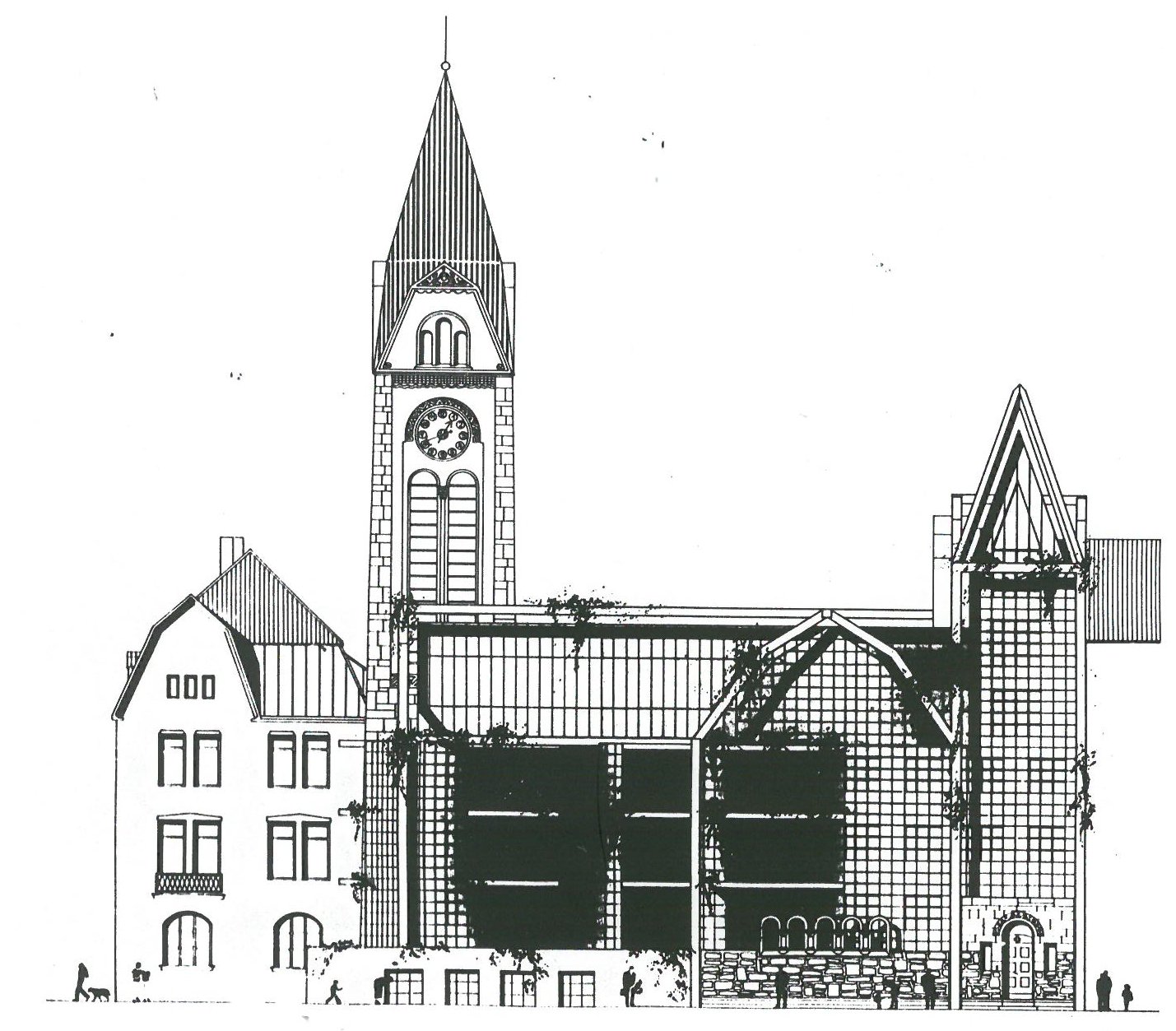


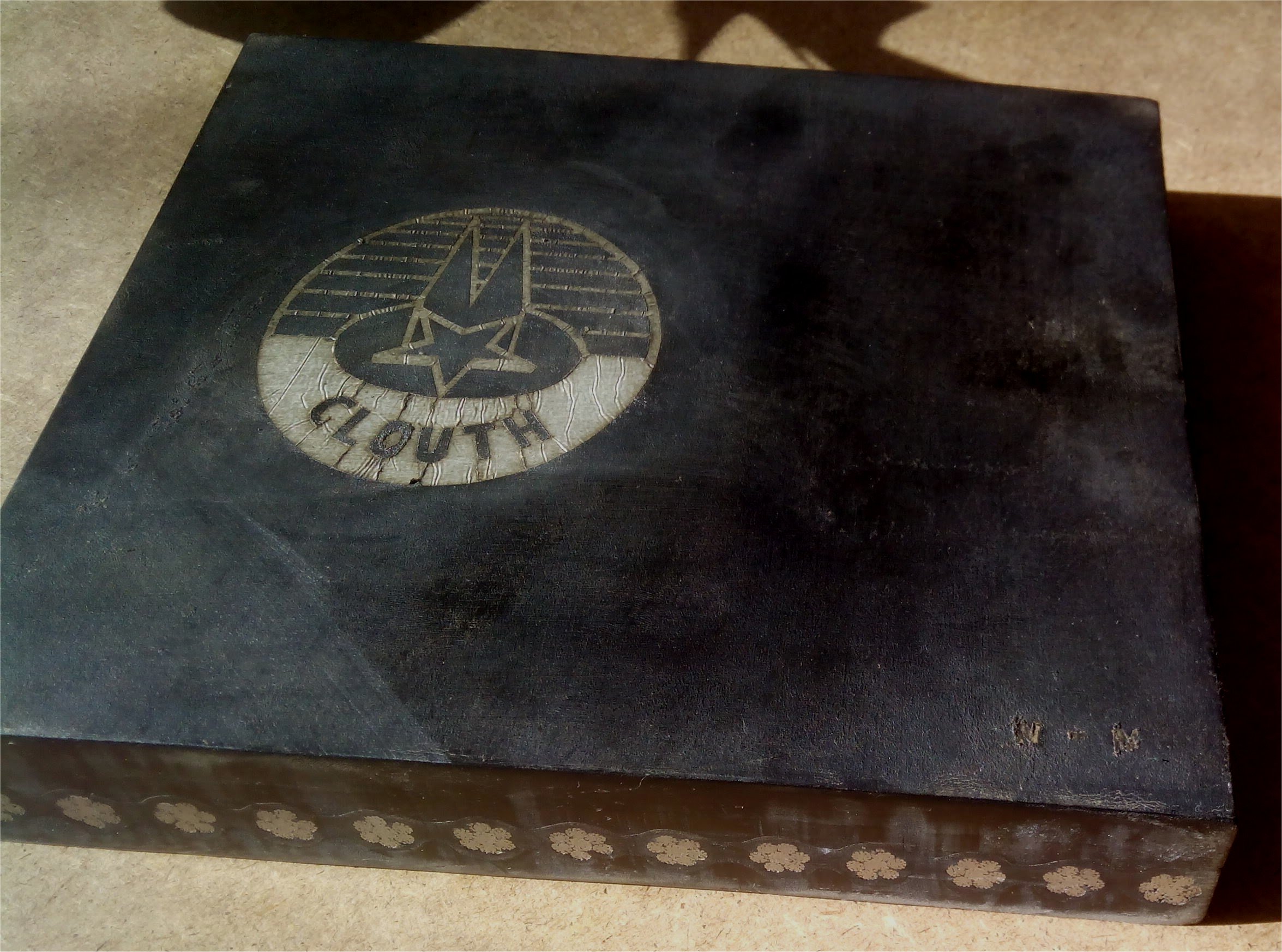



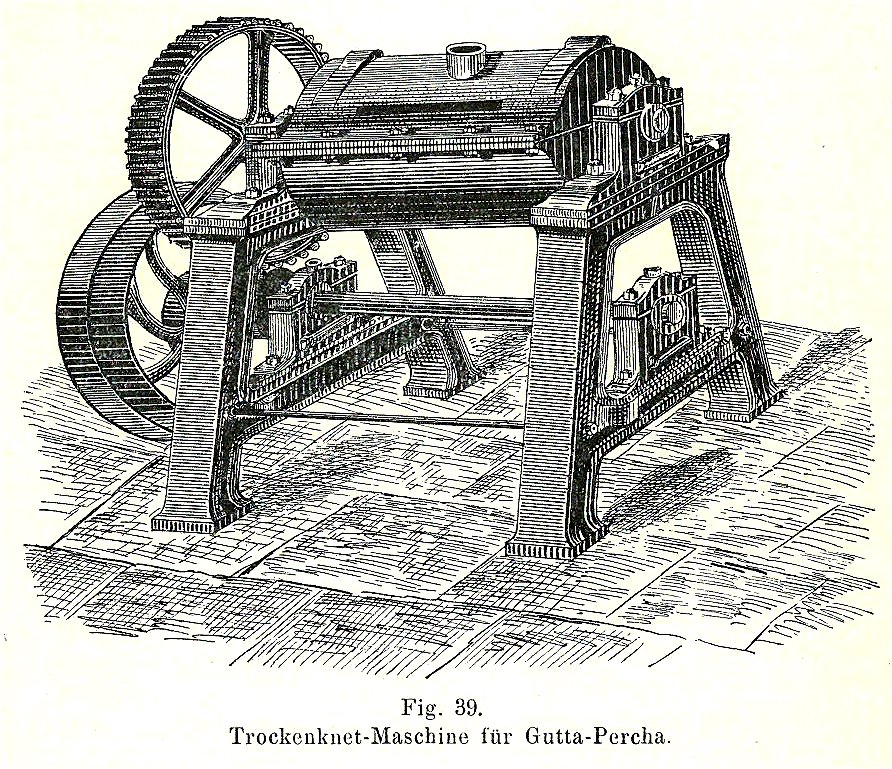
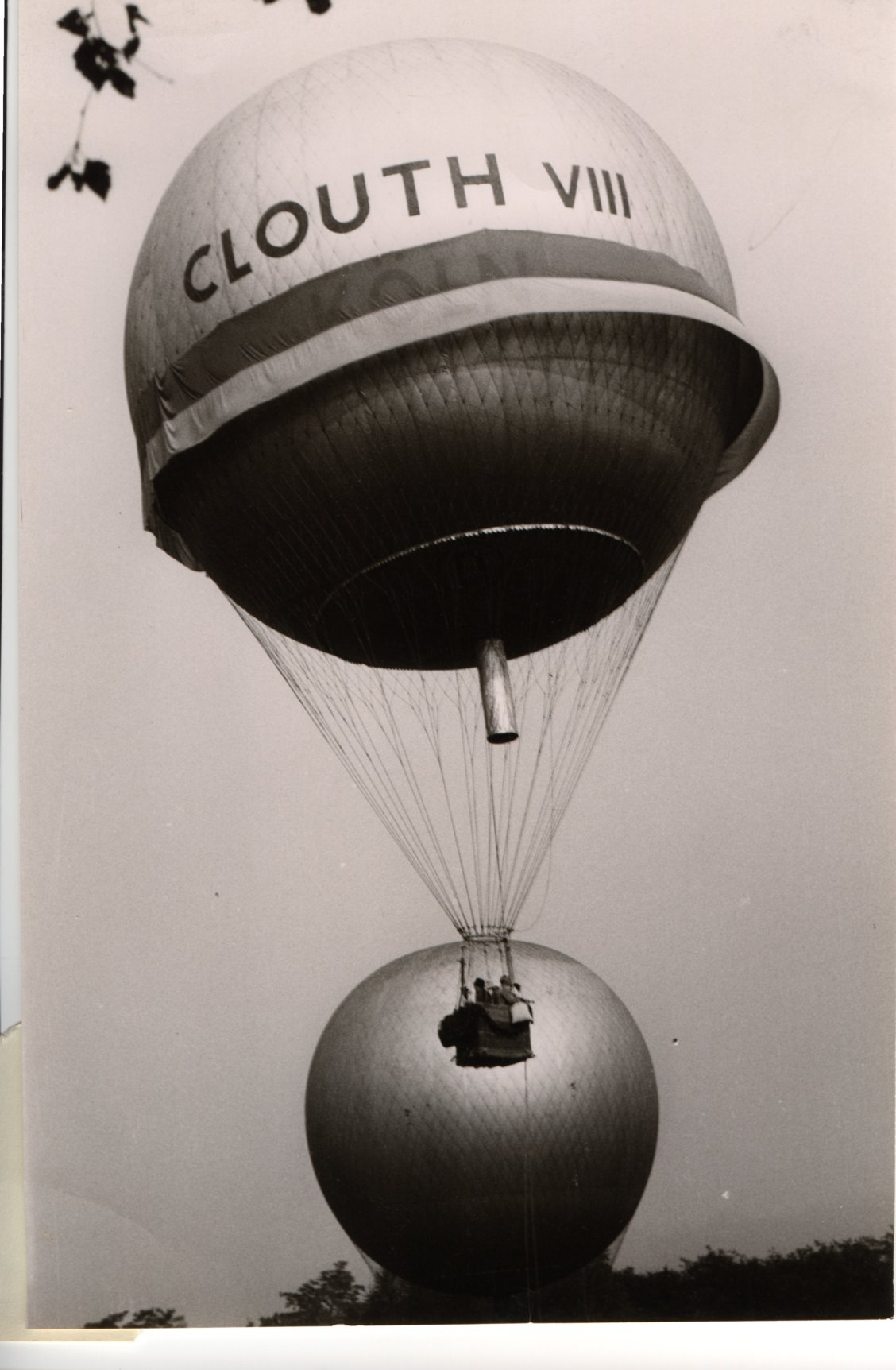

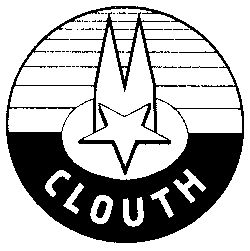




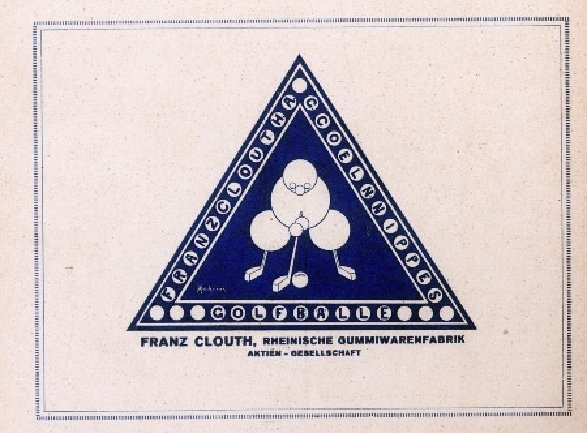



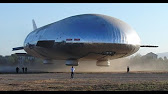
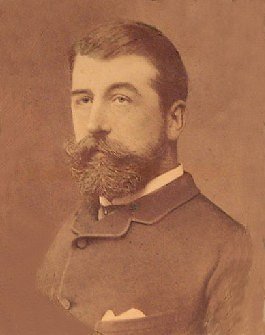
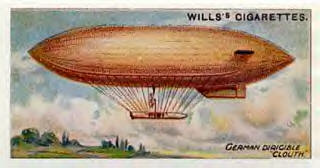
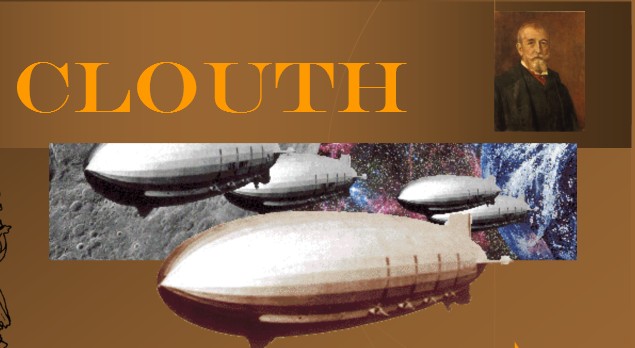
 In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat
finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“
In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat
finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“ Erst am 3. Oktober
1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in
Deutschland.
Erst am 3. Oktober
1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in
Deutschland. Im
Im  Eine bemerkenswerte
Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist
Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den
Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen
Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von
luftfahrtbegeisterten Menschen.
Eine bemerkenswerte
Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist
Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den
Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen
Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von
luftfahrtbegeisterten Menschen.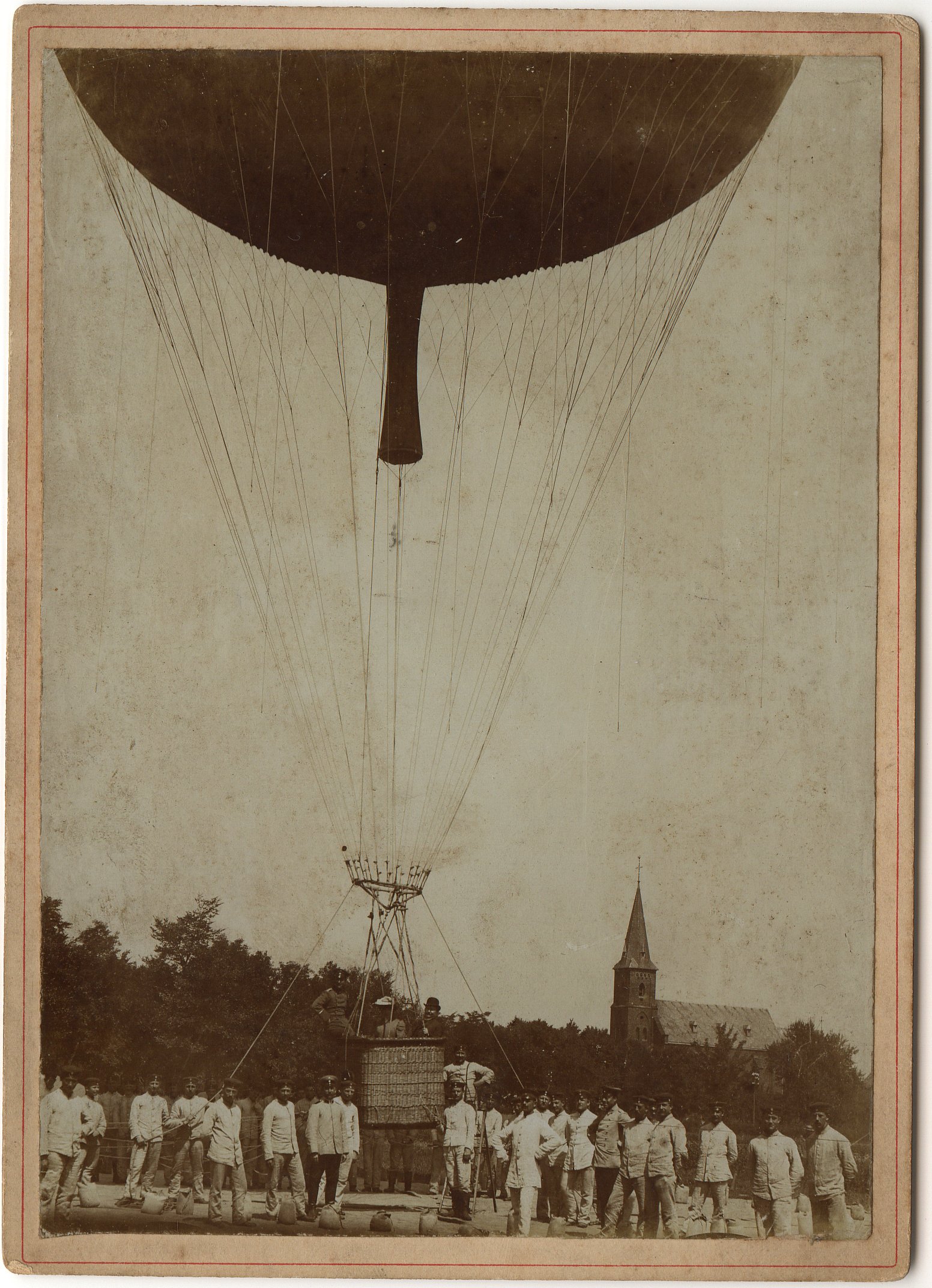 Zunächst müssen die
ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone
unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein
für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907
feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,
Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April
1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein
erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in
St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser
Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im
ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig
demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung
ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte
Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“
Zunächst müssen die
ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone
unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein
für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907
feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,
Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April
1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein
erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in
St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser
Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im
ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig
demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung
ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte
Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“
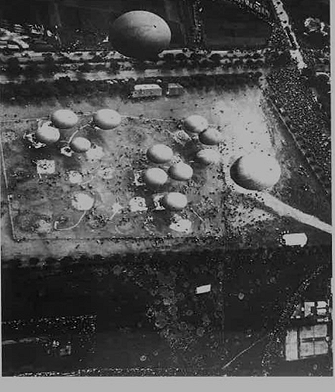 Die „Internationale
Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos
Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar.
Die „Internationale
Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos
Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar.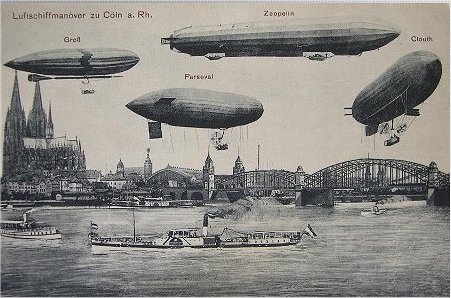 Die Anzahl von insgesamt 69
Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des
Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt
des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale
Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer
derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an
erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der
Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.
Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich
um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre
zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte
Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“
Die Anzahl von insgesamt 69
Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des
Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt
des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale
Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer
derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an
erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der
Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.
Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich
um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre
zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte
Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“
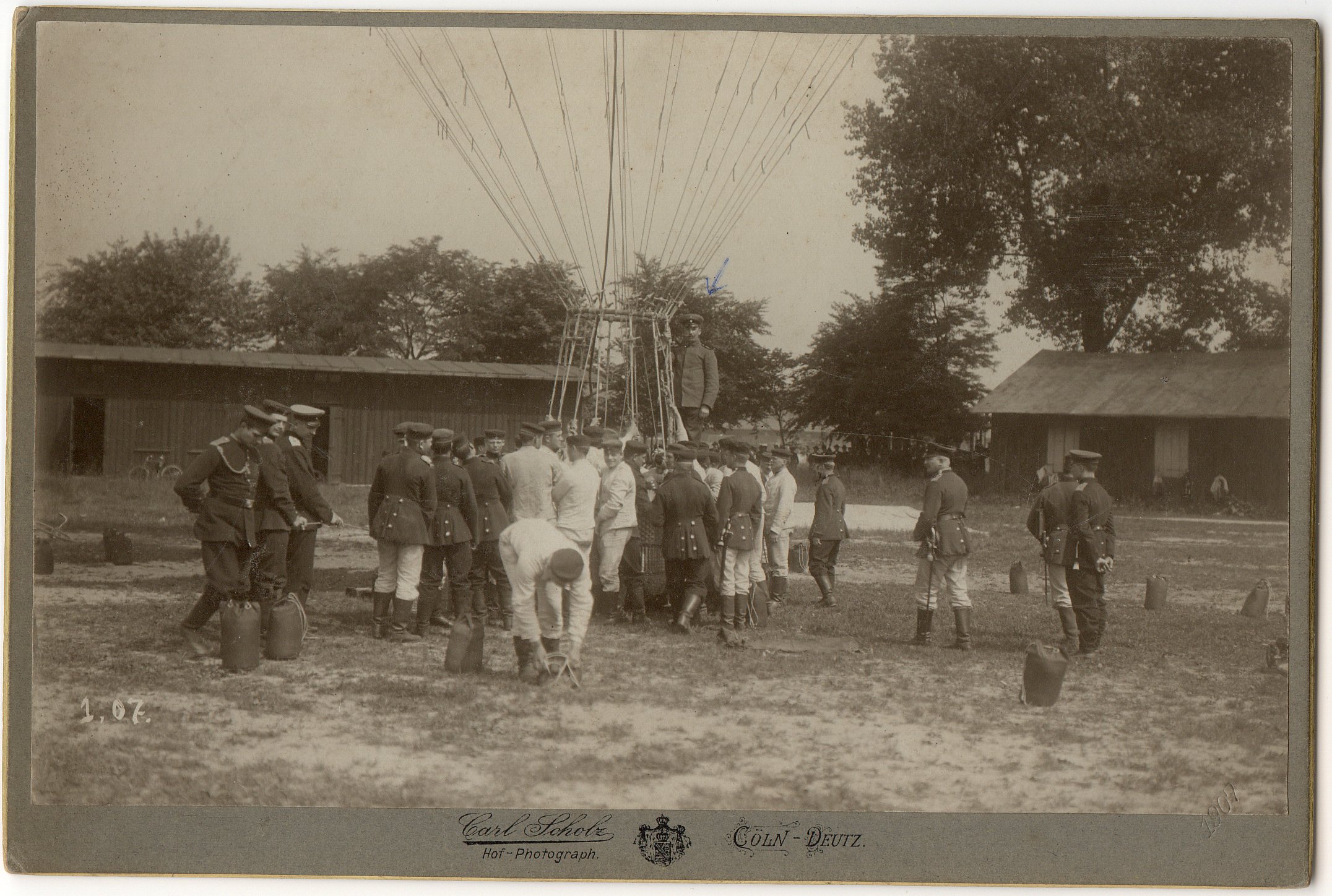
 Als 1870/71 der
deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine
Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung
wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische
Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte
sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert
und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes
bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein
Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“
Als 1870/71 der
deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine
Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung
wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische
Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte
sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert
und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes
bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein
Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“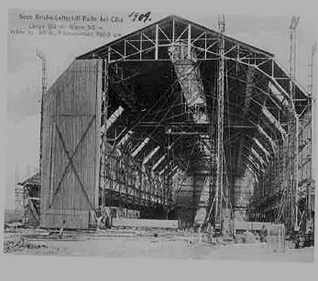 Im Spätsommer des für
den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das
Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August
Im Spätsommer des für
den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das
Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August 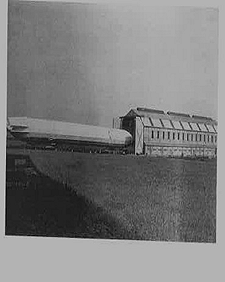 und weist eine einzelne
Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an
beiden Giebeln mit Toren versehen“
und weist eine einzelne
Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an
beiden Giebeln mit Toren versehen“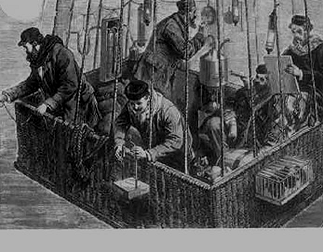 Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“
Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“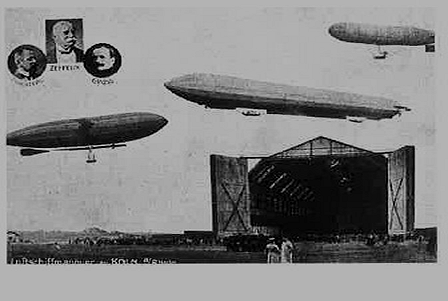
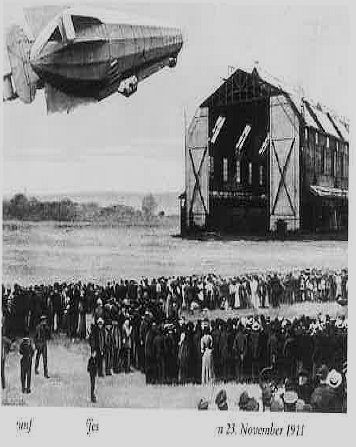 Der Status der
Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen
Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.
Der Status der
Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen
Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt. Stande werden Luftschiffe im Kriege der
Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der
Aufklärung.“
Stande werden Luftschiffe im Kriege der
Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der
Aufklärung.“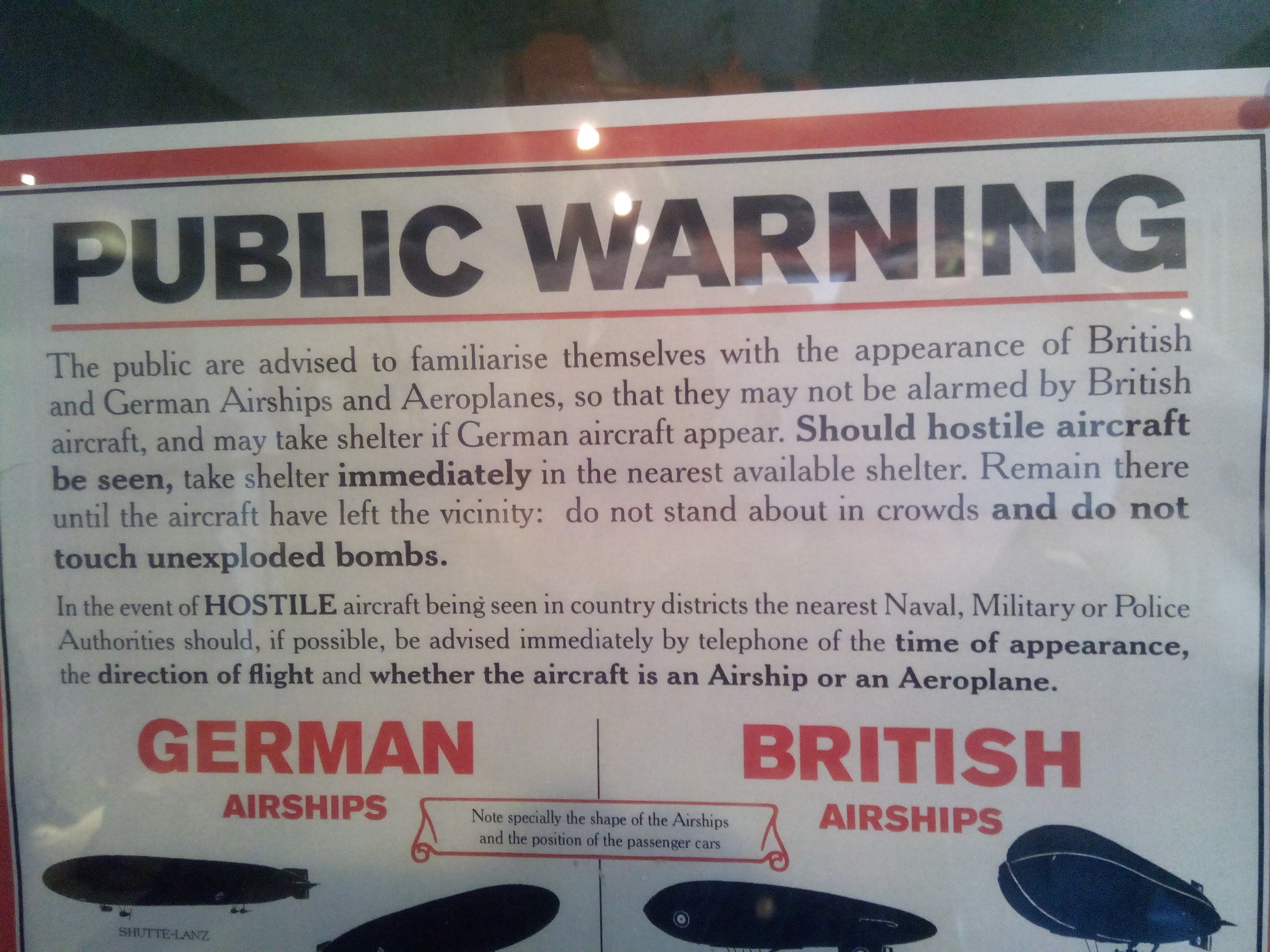
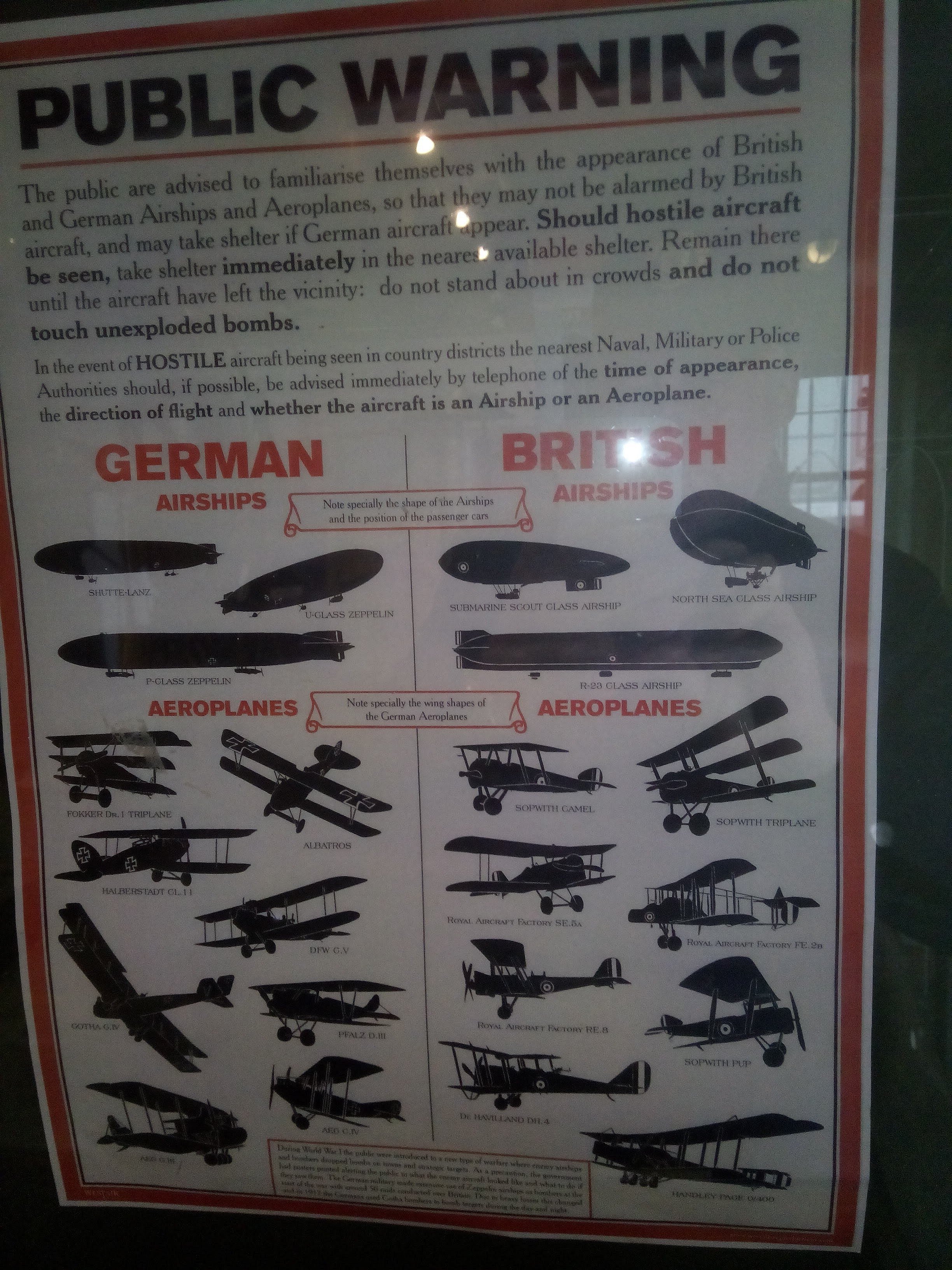
 zweifellos
aus den bitteren Erfahrungen des ersten Angriffs gelernt hatten. Man hatte sich
dafür zusätzlich im Bodeneinsatz eine 75 mm Kanone aus Frankreich besorgt, wohl gesagt „eine“, die
aber auch erste Abschusserfolge erzielte. Somit wurden zumindest besser bewaffnete Flugzeuge
eingesetzt, die im September 1916 zwei maßgebliche Abschüsse von deutschen Zeppelinen erzielten und
damit den Deutschen klarmachen sollten, dass aufgrund der Unbeweglichkeit der
Luftschiffe im Vergleich zum Flugzeug Erstere den Kürzeren ziehen würden. Die
Deutschen antworteten mit einem 196 m langen Superluftschiff, geführt durch
Luftkapitän Mathy, dessen Luftgefährt dann mit Leuchtspurmunition abgeschossen
wurde. Er kam bei diesem 15. Luftangriff um. Die
Engländer setzten als effektivere Flugmaschinen künftig den
zweifellos
aus den bitteren Erfahrungen des ersten Angriffs gelernt hatten. Man hatte sich
dafür zusätzlich im Bodeneinsatz eine 75 mm Kanone aus Frankreich besorgt, wohl gesagt „eine“, die
aber auch erste Abschusserfolge erzielte. Somit wurden zumindest besser bewaffnete Flugzeuge
eingesetzt, die im September 1916 zwei maßgebliche Abschüsse von deutschen Zeppelinen erzielten und
damit den Deutschen klarmachen sollten, dass aufgrund der Unbeweglichkeit der
Luftschiffe im Vergleich zum Flugzeug Erstere den Kürzeren ziehen würden. Die
Deutschen antworteten mit einem 196 m langen Superluftschiff, geführt durch
Luftkapitän Mathy, dessen Luftgefährt dann mit Leuchtspurmunition abgeschossen
wurde. Er kam bei diesem 15. Luftangriff um. Die
Engländer setzten als effektivere Flugmaschinen künftig den
 wurden
auch im Zweiten Weltkrieg noch verwendet, u.a. von Kriegsschiffen. Rammte ein
Flieger das Kabel oder den Ballon, war er für gewöhnlich verloren. Ein beliebter
Trick war, den Ballon unsichtbar in den Wolken schweben zu lassen, so daß die
Flieger ohne Warnung in die Kabel flogen.
wurden
auch im Zweiten Weltkrieg noch verwendet, u.a. von Kriegsschiffen. Rammte ein
Flieger das Kabel oder den Ballon, war er für gewöhnlich verloren. Ein beliebter
Trick war, den Ballon unsichtbar in den Wolken schweben zu lassen, so daß die
Flieger ohne Warnung in die Kabel flogen.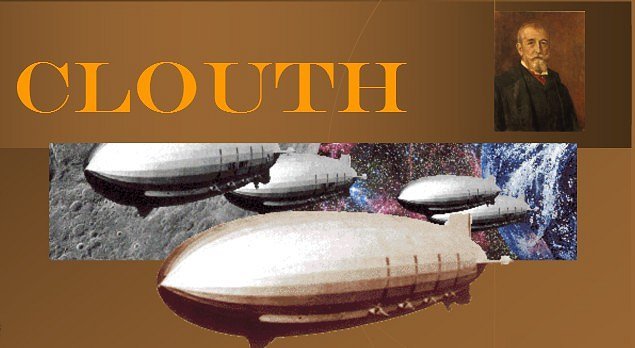
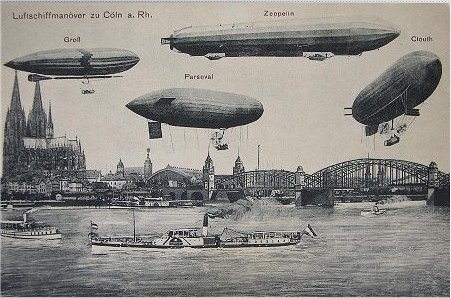
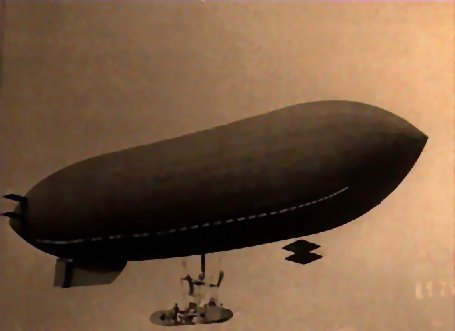
 Groß war auch das Erstaunen, als
das von Hauptmann von Kleist gesteuerte Luftschiff und angemeldet am 21. Juni
1910 auf der Internationalen Industrieausstellung in Brüssel erschien. Für die
200 Kilometer lange Strecke hatte es fünf Stunden benötigt. Die Brüsseler und
viele andere ausländische Blätter würdigten das Ereignis in ausführlichen
Artikeln. Im Jahre 1910 wurde die Abteilung " Luftschiff-Bau " mit der
Luftfahrzeuggesellschaft mbH. in Berlin vereinigt, nachdem Clouth noch ein
zweites lenkbares Luftschiff nachdem halbstarren System "Parseval gebaut hatte.
Beide Luftschiff gingen in den Besitz der Berliner Gesellschaft über. Goldene
Medaillen sind die bis heute noch verbliebenen Auszeichnungen für die Erfolge,
die Clouth in der Luftschiff errang
Groß war auch das Erstaunen, als
das von Hauptmann von Kleist gesteuerte Luftschiff und angemeldet am 21. Juni
1910 auf der Internationalen Industrieausstellung in Brüssel erschien. Für die
200 Kilometer lange Strecke hatte es fünf Stunden benötigt. Die Brüsseler und
viele andere ausländische Blätter würdigten das Ereignis in ausführlichen
Artikeln. Im Jahre 1910 wurde die Abteilung " Luftschiff-Bau " mit der
Luftfahrzeuggesellschaft mbH. in Berlin vereinigt, nachdem Clouth noch ein
zweites lenkbares Luftschiff nachdem halbstarren System "Parseval gebaut hatte.
Beide Luftschiff gingen in den Besitz der Berliner Gesellschaft über. Goldene
Medaillen sind die bis heute noch verbliebenen Auszeichnungen für die Erfolge,
die Clouth in der Luftschiff errang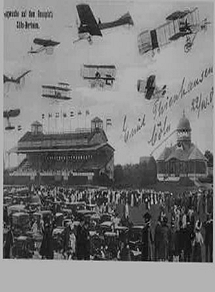



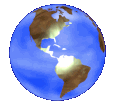

 In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat
In Frankreich ist mit
dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit
geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“
finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt
überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des
Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist
man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht
bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit
Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“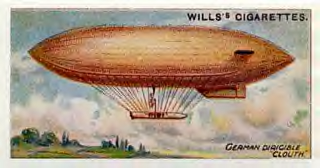 Einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Kölner als auch zur allgemeinen Entwicklung der
Luftfschifffahrt sowie zum städtischen Industrialisierungsprozess leistet der
Kölner Fabrikant Franz Clouth mit seiner Firma „Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik
Cöln-Nippes“.
Einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Kölner als auch zur allgemeinen Entwicklung der
Luftfschifffahrt sowie zum städtischen Industrialisierungsprozess leistet der
Kölner Fabrikant Franz Clouth mit seiner Firma „Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik
Cöln-Nippes“.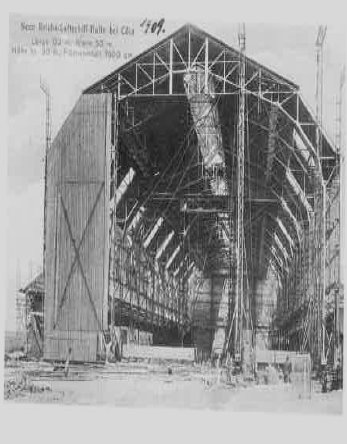 doch erst nach
der Rückkehr nach Köln erhält das Luftschiff eine komplett überarbeitete
Steuerung; das Schiff gewinnt dadurch erheblich an Manövrierfähigkeit. Auch zur
Weltausstellung 1910 in Brüssel
doch erst nach
der Rückkehr nach Köln erhält das Luftschiff eine komplett überarbeitete
Steuerung; das Schiff gewinnt dadurch erheblich an Manövrierfähigkeit. Auch zur
Weltausstellung 1910 in Brüssel
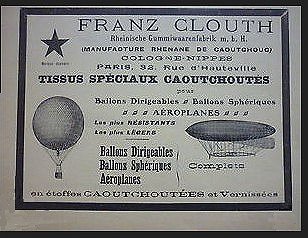 unternimmt das Luftschiff eine Fahrt, wo es
mehrere Rundfahrten absolviert und vom Flugkomitee der Ausstellung mit dem
Preis für Luftschiffe ausgezeichnet wird.
unternimmt das Luftschiff eine Fahrt, wo es
mehrere Rundfahrten absolviert und vom Flugkomitee der Ausstellung mit dem
Preis für Luftschiffe ausgezeichnet wird.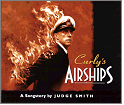 Luftschiffahrt e. V.“ (CCfL) umbenannt wird.
Luftschiffahrt e. V.“ (CCfL) umbenannt wird.
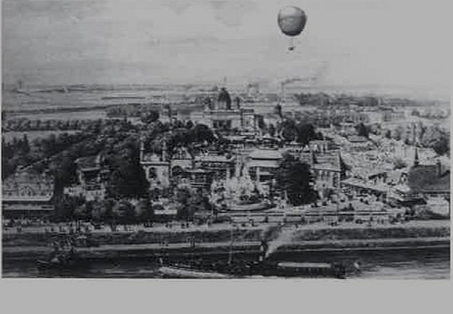 Eine der Höhepunkte
der frühen Ballonsportgeschichte ist zweifellos die vom Kölner Verein
veranstaltete „Internationale Ballonwettfahrt“ am 27. und 29. Juni 1909. An
diesem größten internationalen Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.
zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten
Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35
Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer
Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als
Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den
Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten
Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich
tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der
Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine
Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der
hohen Eintrittspreise unerschwinglich.
Eine der Höhepunkte
der frühen Ballonsportgeschichte ist zweifellos die vom Kölner Verein
veranstaltete „Internationale Ballonwettfahrt“ am 27. und 29. Juni 1909. An
diesem größten internationalen Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.
zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten
Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35
Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer
Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als
Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den
Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten
Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich
tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der
Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine
Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der
hohen Eintrittspreise unerschwinglich. Landeeigenschaften des Areals und errichten, wie bereits Hugot zuvor,
dauerhafte Unterstellräume für ihre Flugzeuge.
Landeeigenschaften des Areals und errichten, wie bereits Hugot zuvor,
dauerhafte Unterstellräume für ihre Flugzeuge.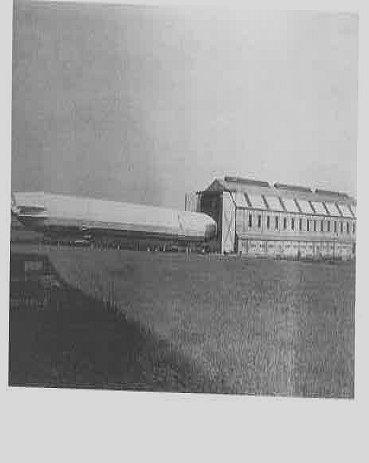 Mansardengiebels. Entlang des Dachfirstes sind in drei Segmenten
dreiecksförmige Dachaufbauten als Oberlichter eingezogen.
Mansardengiebels. Entlang des Dachfirstes sind in drei Segmenten
dreiecksförmige Dachaufbauten als Oberlichter eingezogen.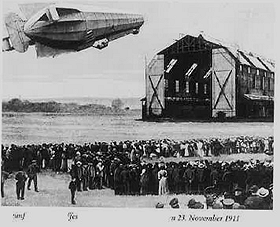
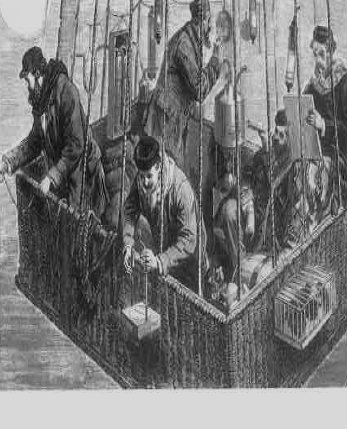
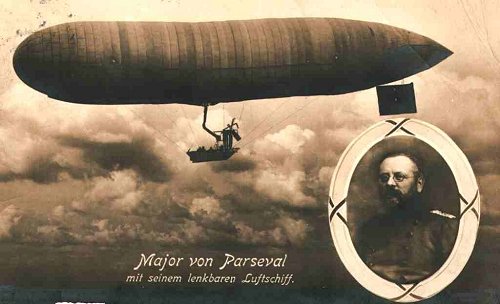 Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“
Die seit 1887 in
‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente
als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen
und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“ Am 23. November 1911 erreicht das von Graf Zeppelin
persönlich von Friedrichshafen nach Köln überführte (Ersatz-)Luftschiff ‘Z II’
Am 23. November 1911 erreicht das von Graf Zeppelin
persönlich von Friedrichshafen nach Köln überführte (Ersatz-)Luftschiff ‘Z II’ Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.
Luftverkehr und
insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche
Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen
und Fotografieren der Stadt.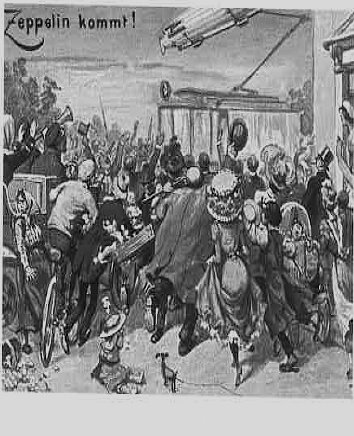 Passagieren zu gewerblichen Zwecken durch.
Passagieren zu gewerblichen Zwecken durch.