|
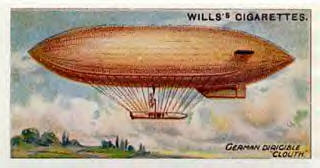
Lenkbares Luftschiff
Clouth
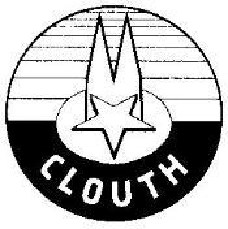
Clouth Firmen Logo

Tiefsee-Kabel

Altreifen
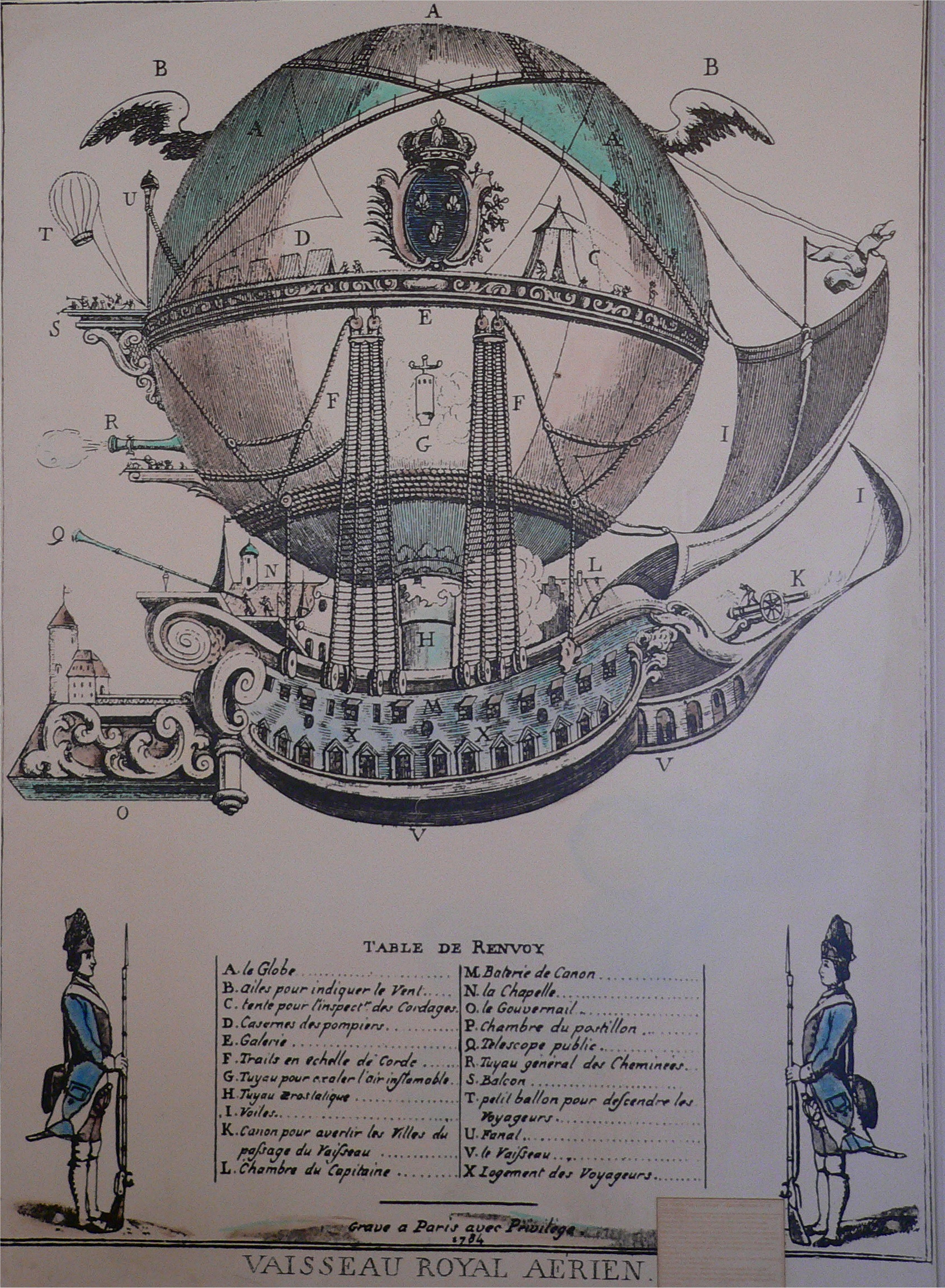
Erste Militärballons

Bakelite Radio
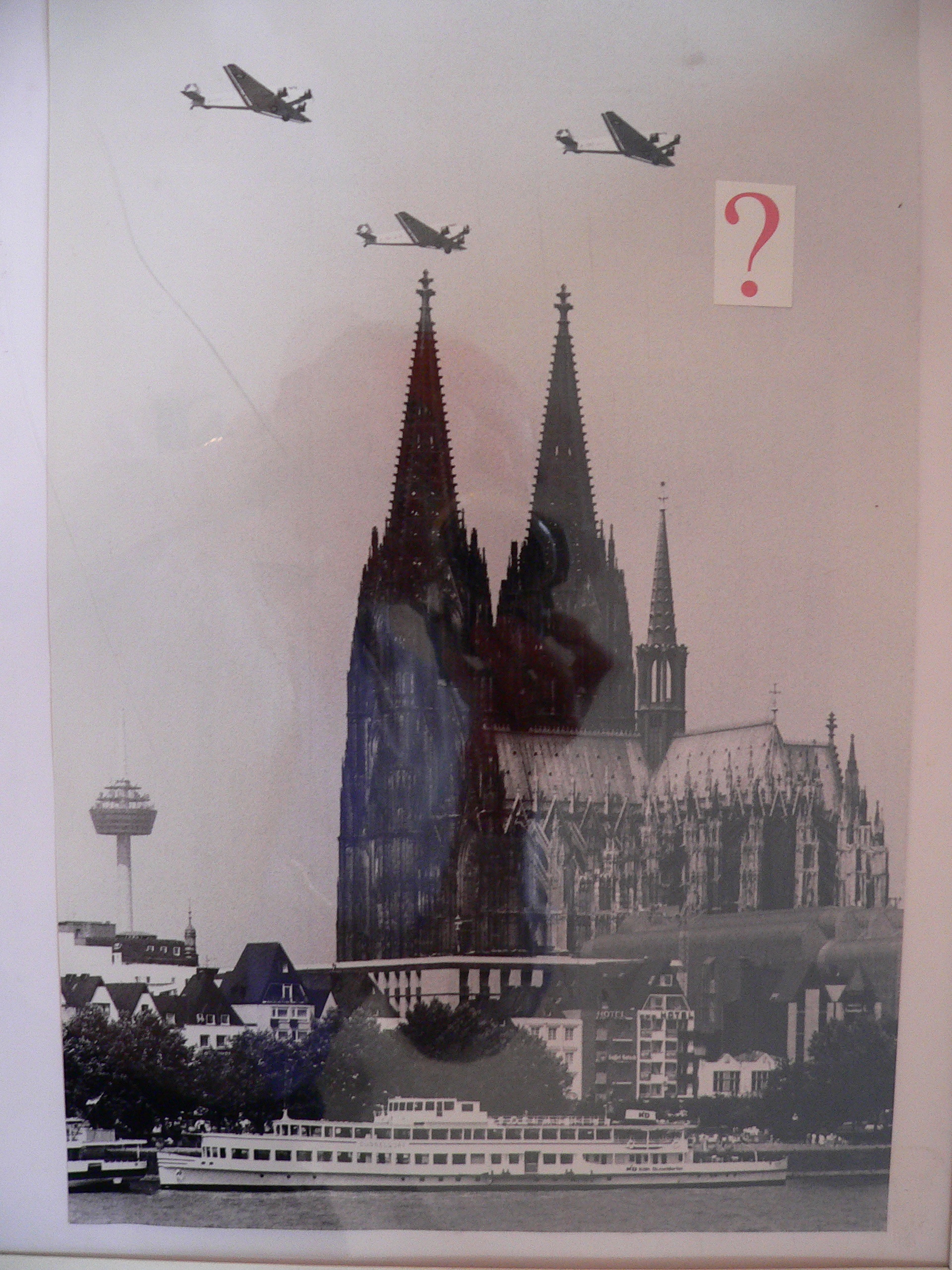
Cöln Anfang 20 Jhdt.
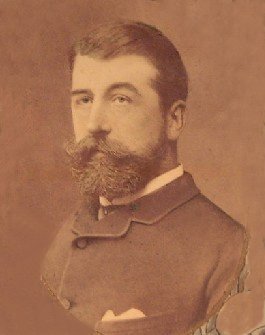
Franz Julius Hubert
Clouth
1862
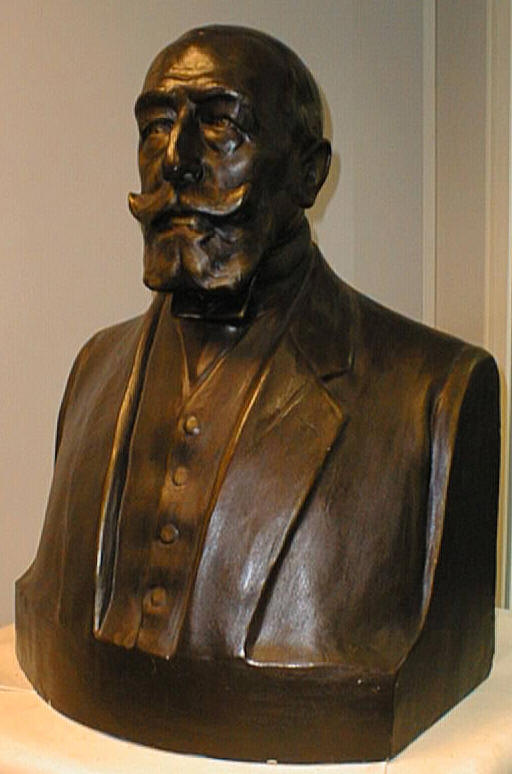
Bronze Büste Franz
Clouth

Franz Clouth 1905
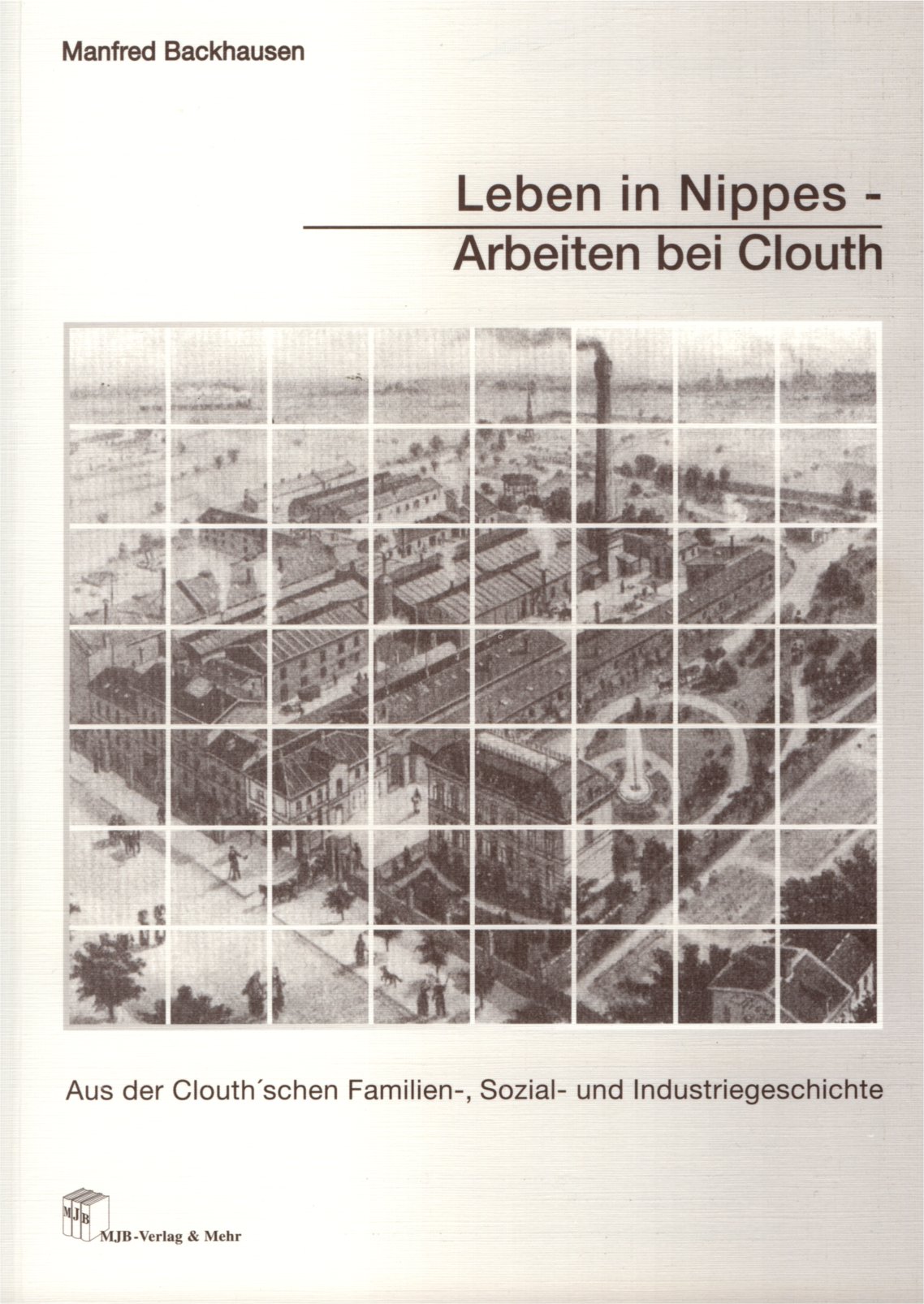
Clouth Book 1st Edition

Tauchhelm Clouth
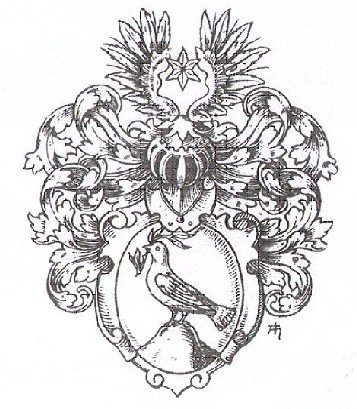
Altwappen Clouth
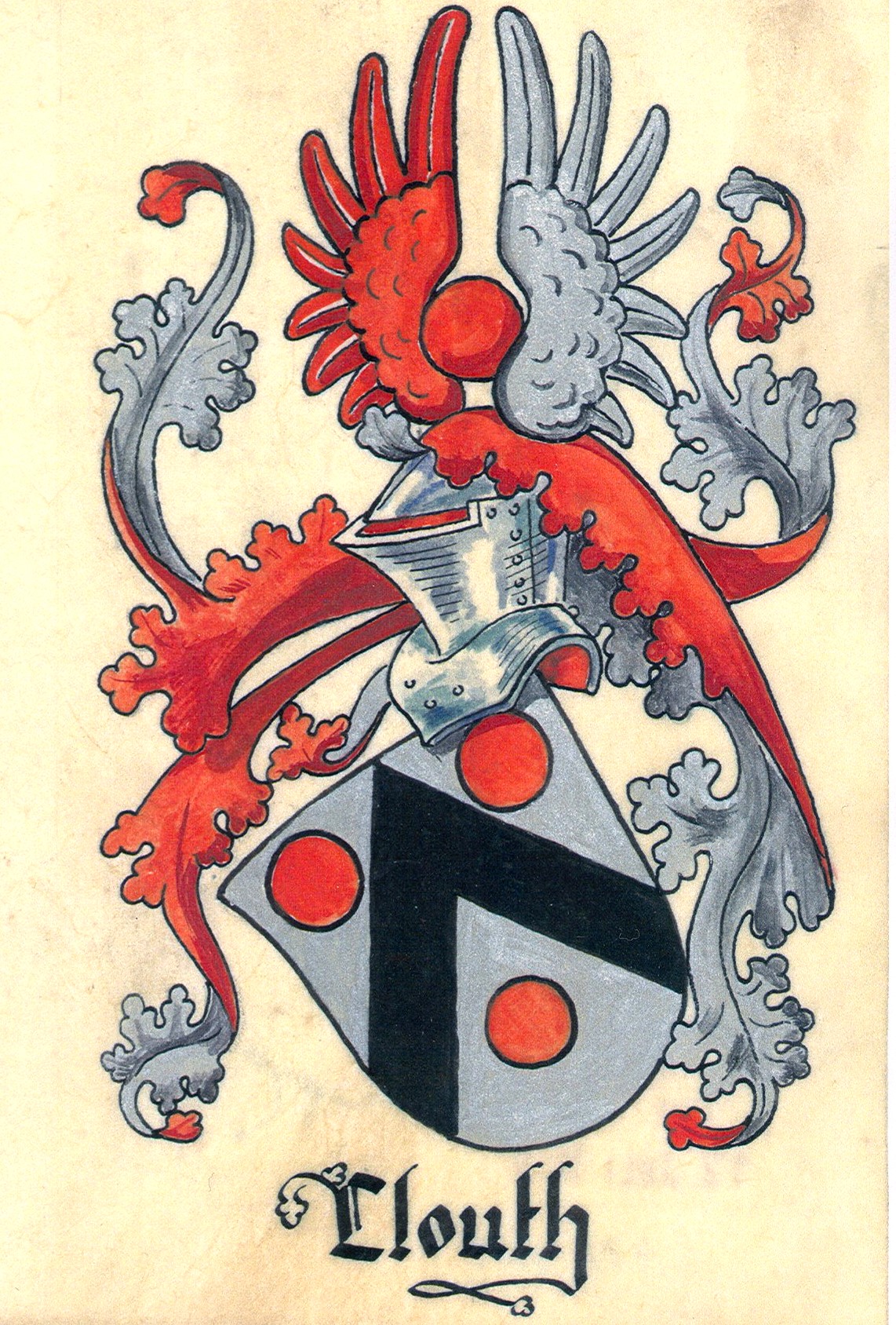
Clouth-Wappen 1923

Max Josef Wilhelm
Clouth
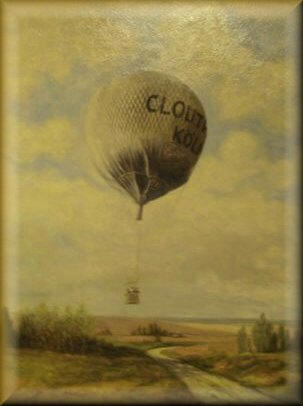
Preisbild
Ballonwettbewerb
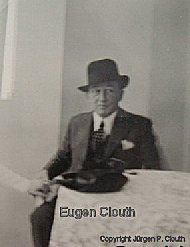
Eugen Clouth

"Anni" Heine Clouth
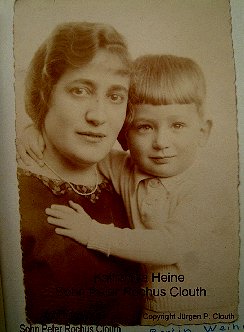
Anni & Peter

Peter Rochus Clouth

Margot Clouth, geb.
Krämer
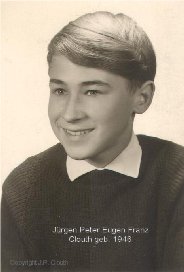
Jürgen Clouth 12

Vettern Peter (l) &
John (r)

Rechtsanwalt J.P.
Clouth

Ehefrau Audrey Clouth
15.1.1950-22.11.2017
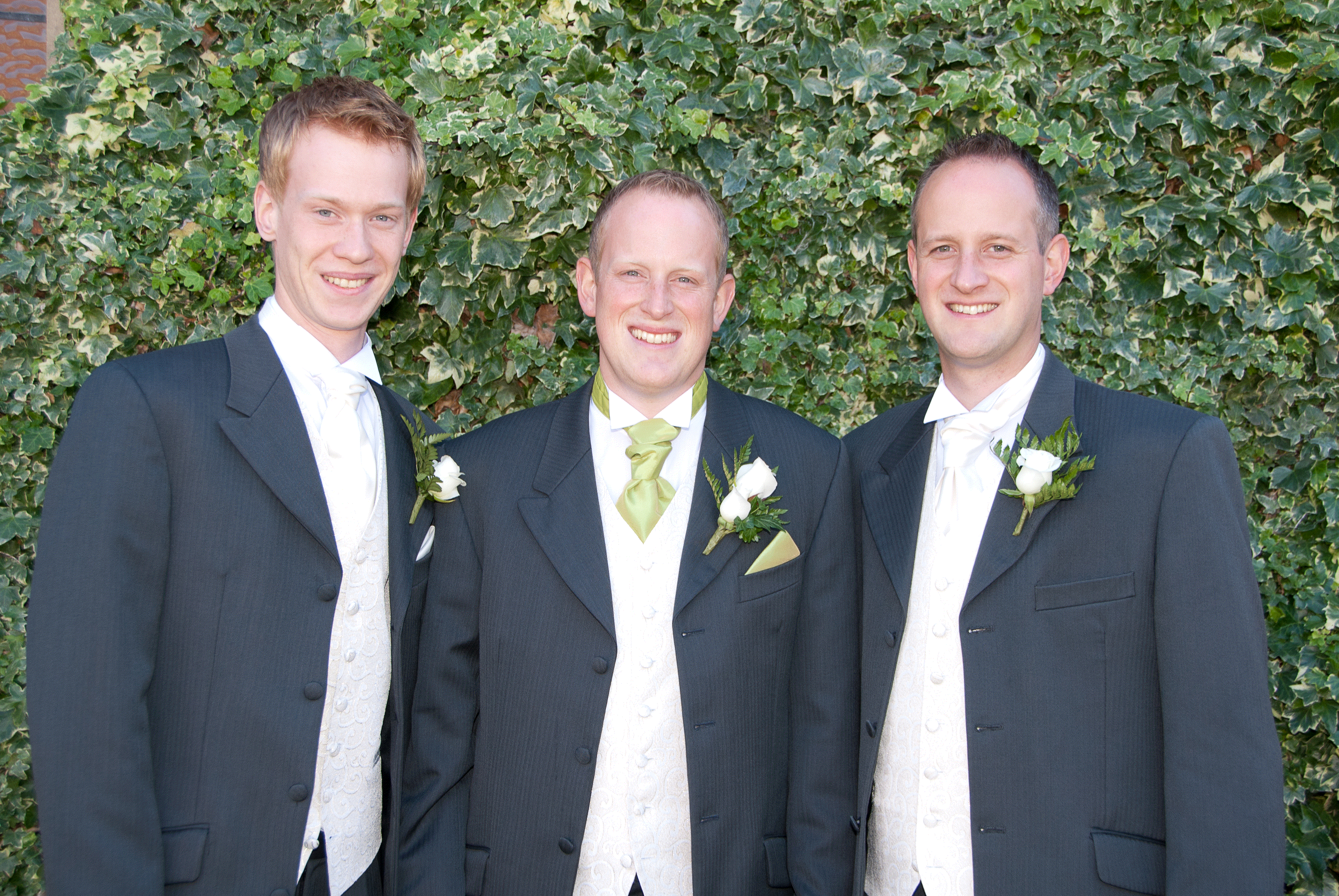
Bryan, Oliver,
Phillip

Jürgen Peter Clouth

Max Clouth
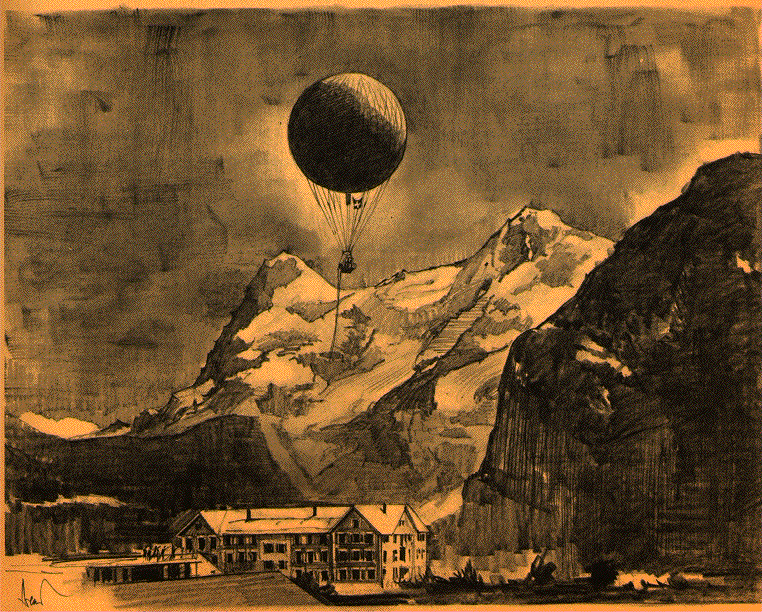
Ballon Sirius
Alpenquerung

Bakelite
Verteilerfinger
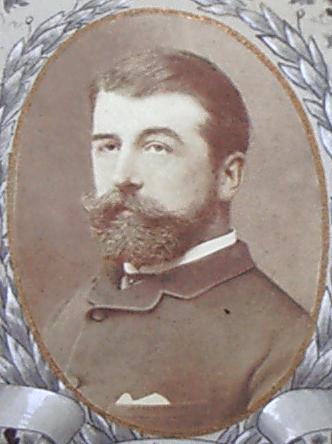
Franz Clouth

Eugen Clouth
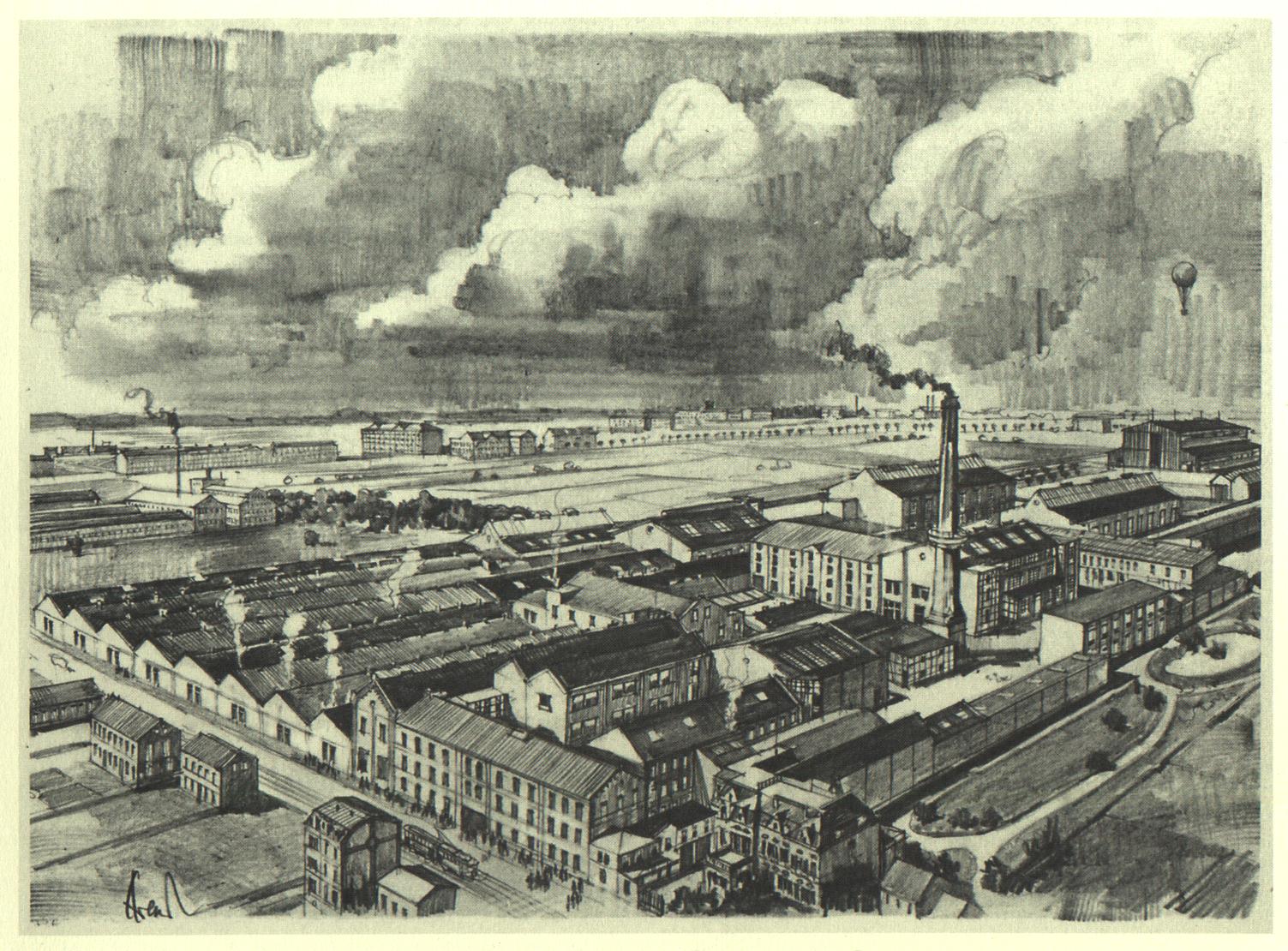
Clouth Werk
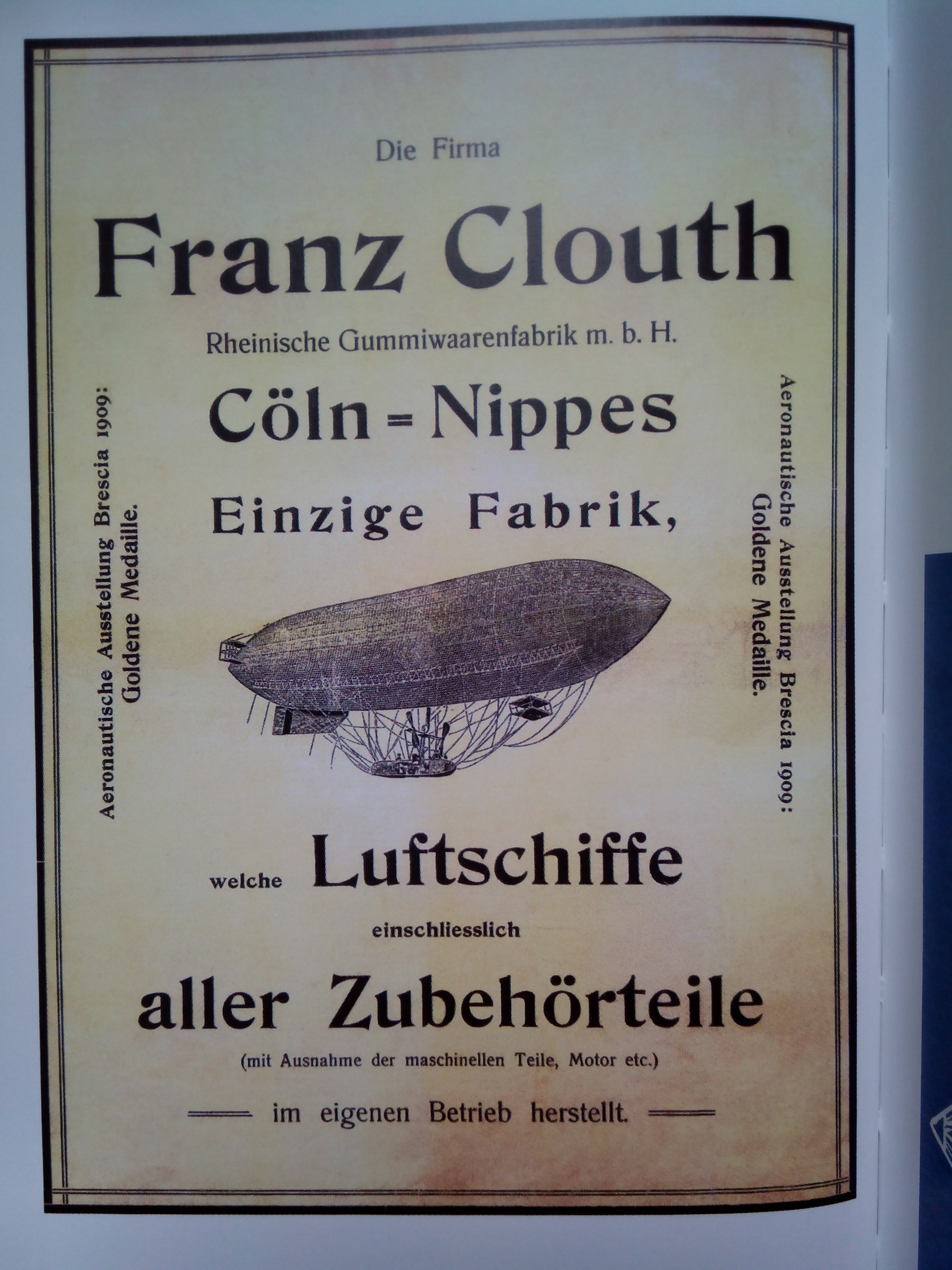
Clouth Werbung
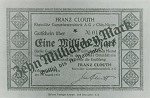
Clouth Notgeld

Clouth Werk

Alt-Autoreifen

Altfahrzeug

Daimler
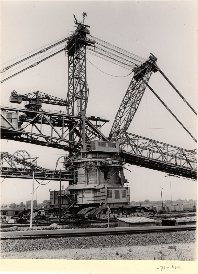
Förderbandkran
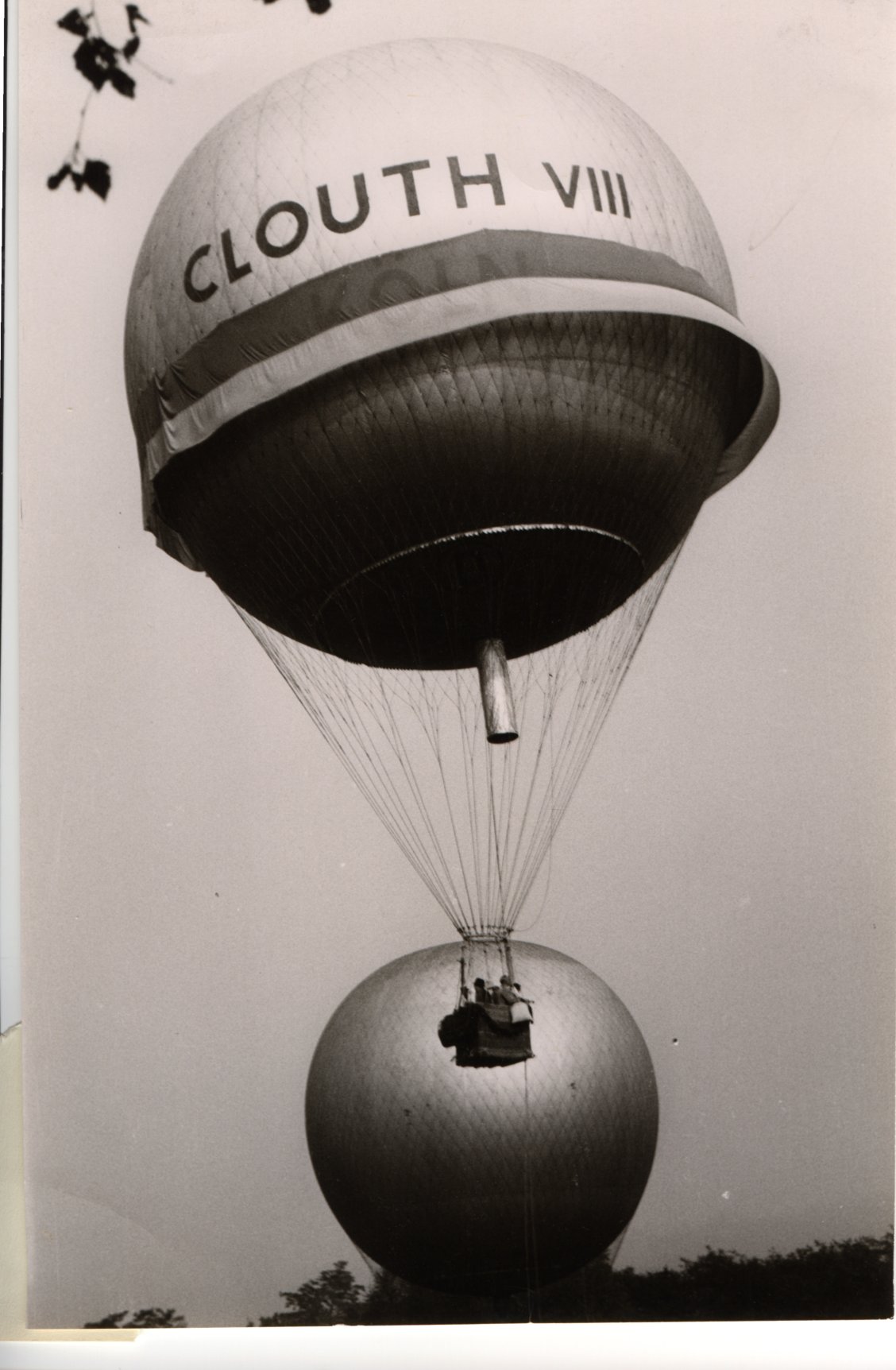
Clouth VIII Ballon

Wilhelm Clouth

Katharina Clouth

Caouchoc Golf Ball
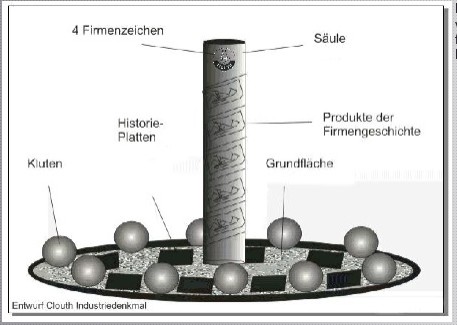
Skizze Clouth Denkmal
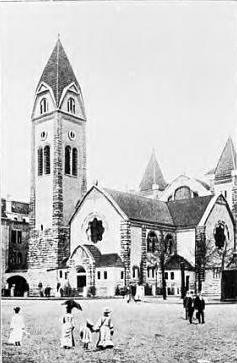
Altkatholische Kirche
Köln

Kabelaufroller
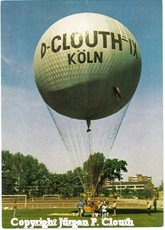
Clouth IX

Flugticket Clouth IX
.jpg)
Ballon Clouth IX über
Alpen
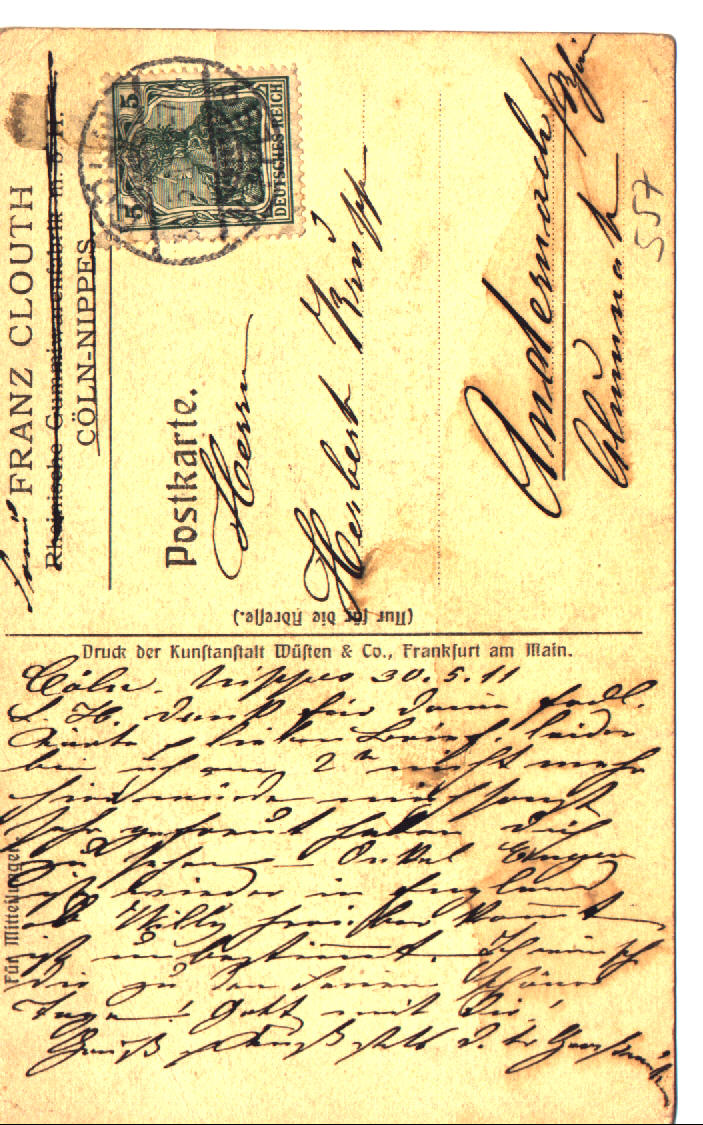
Post-Karte Franz Clouth
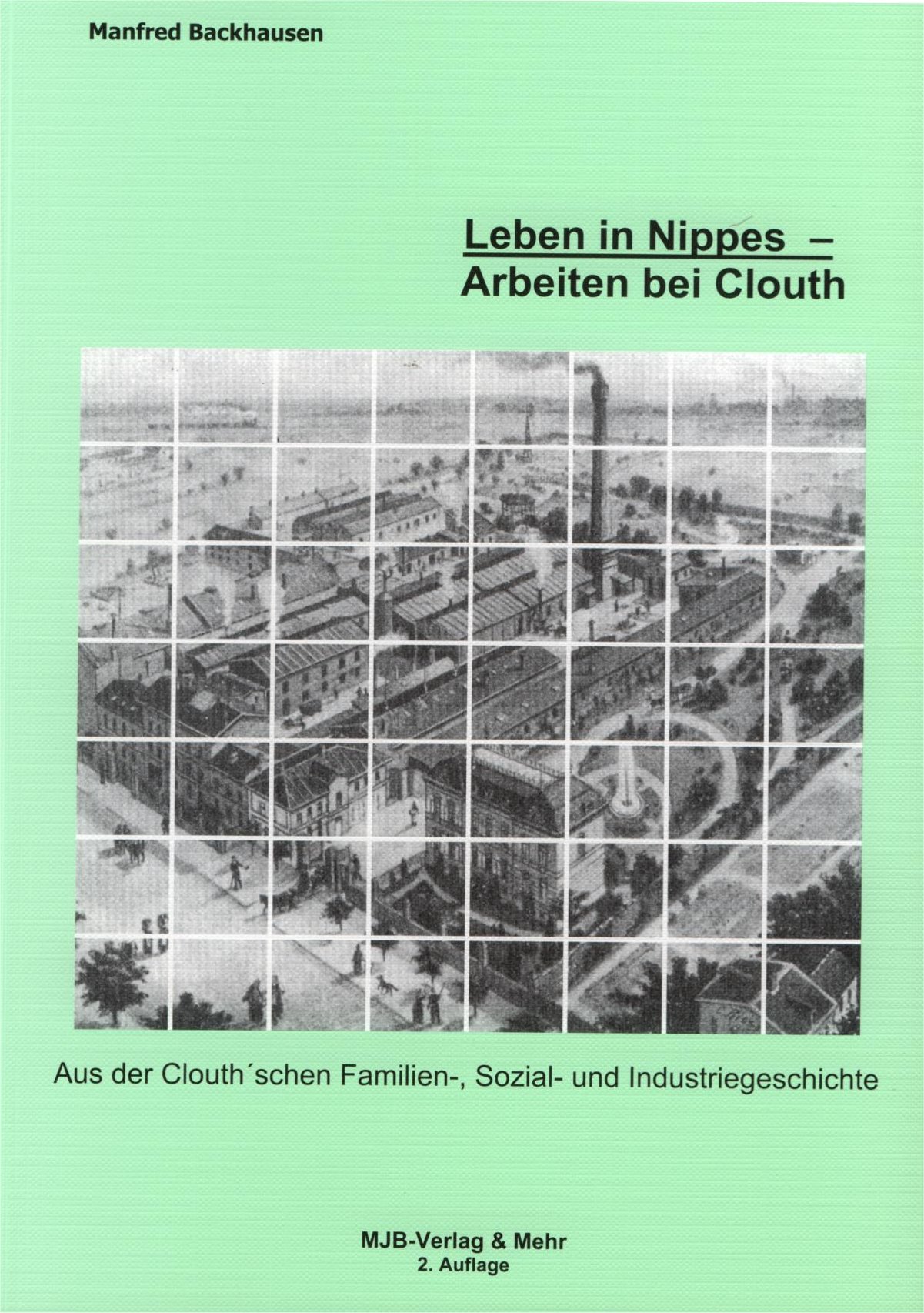
Clouth Buch 2.Ausgabe
.jpg)
Franz Clouth

Ballonkorb

Butzweilerhof Köln

Caouchoc Baum

Caouchoc Trocknung
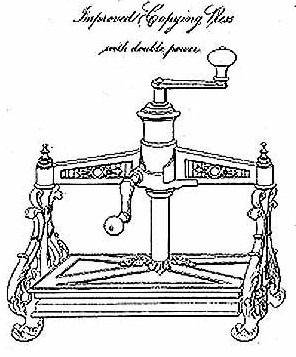
Kautschuk-Kopier System
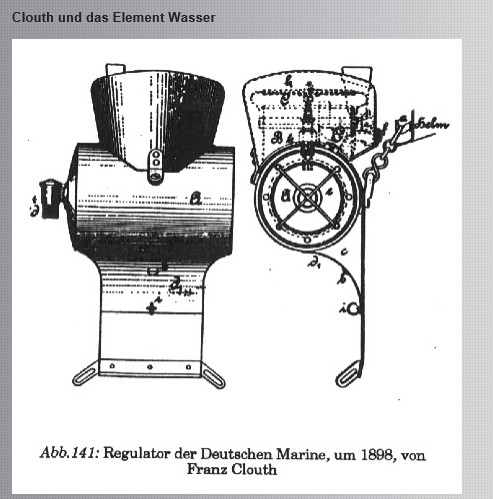
Wasser-Regulator
Clouth

Land & See Altes Logo

Land & See NEULogo
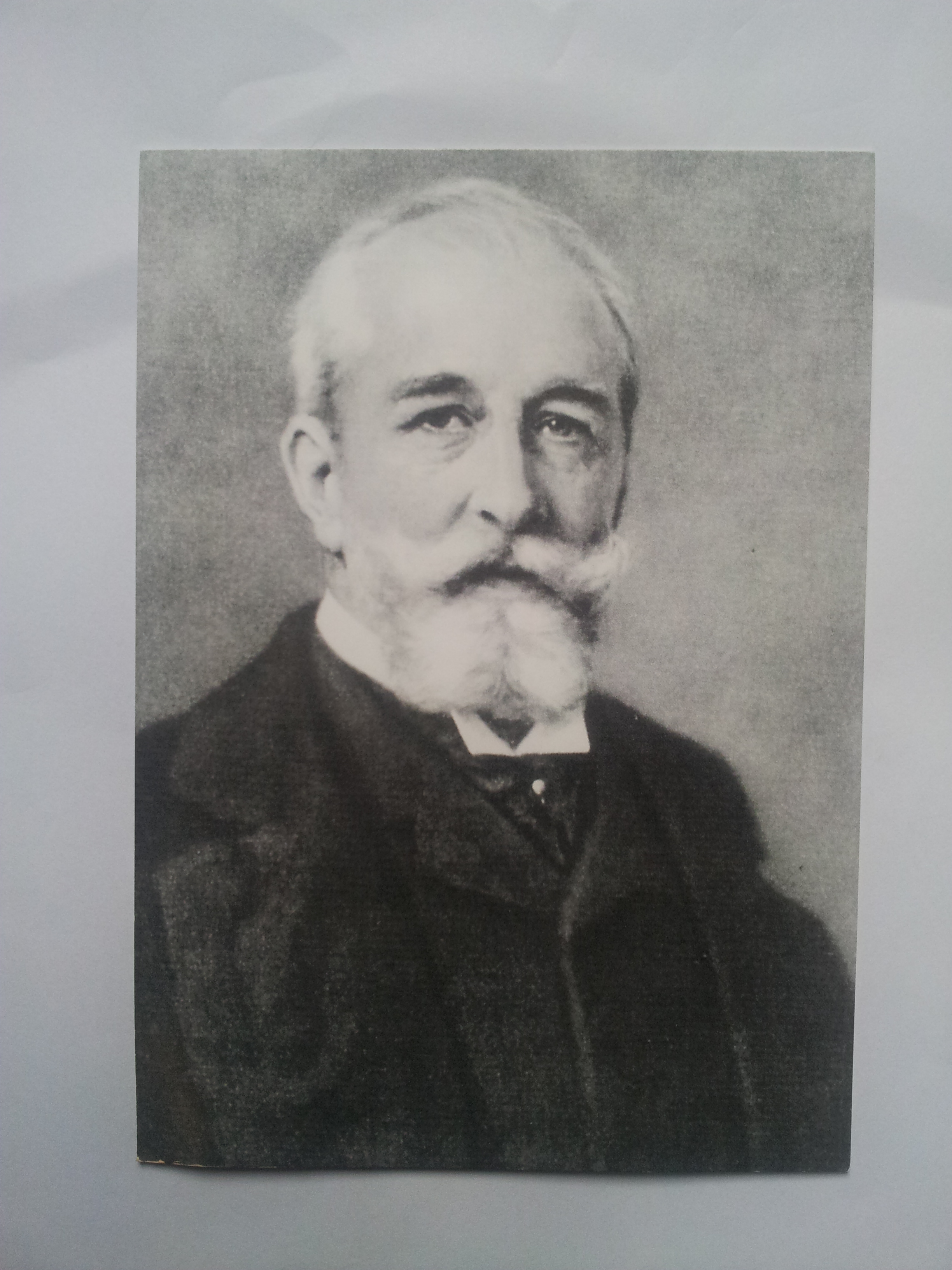
Franz Clouth

Richard Clouth
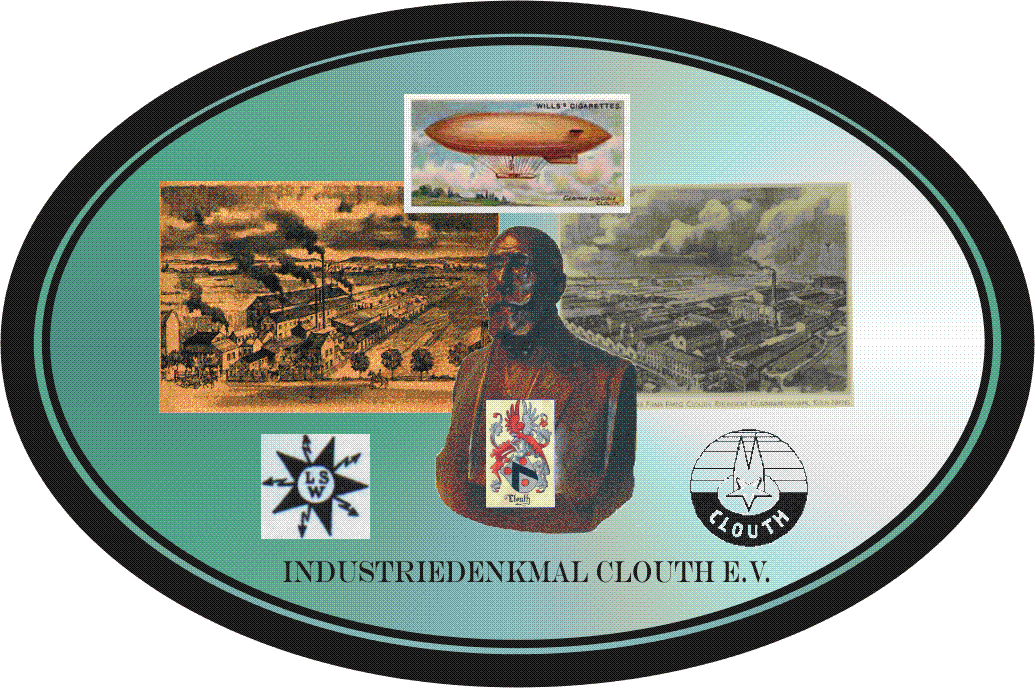
Industrieverein
Altlogo

Tauchergesellschaft
LOGO

Halle Förderband
Produktion

Firmentor 2

Bakelite Telefon

Podbielski
Kabellegeschiff
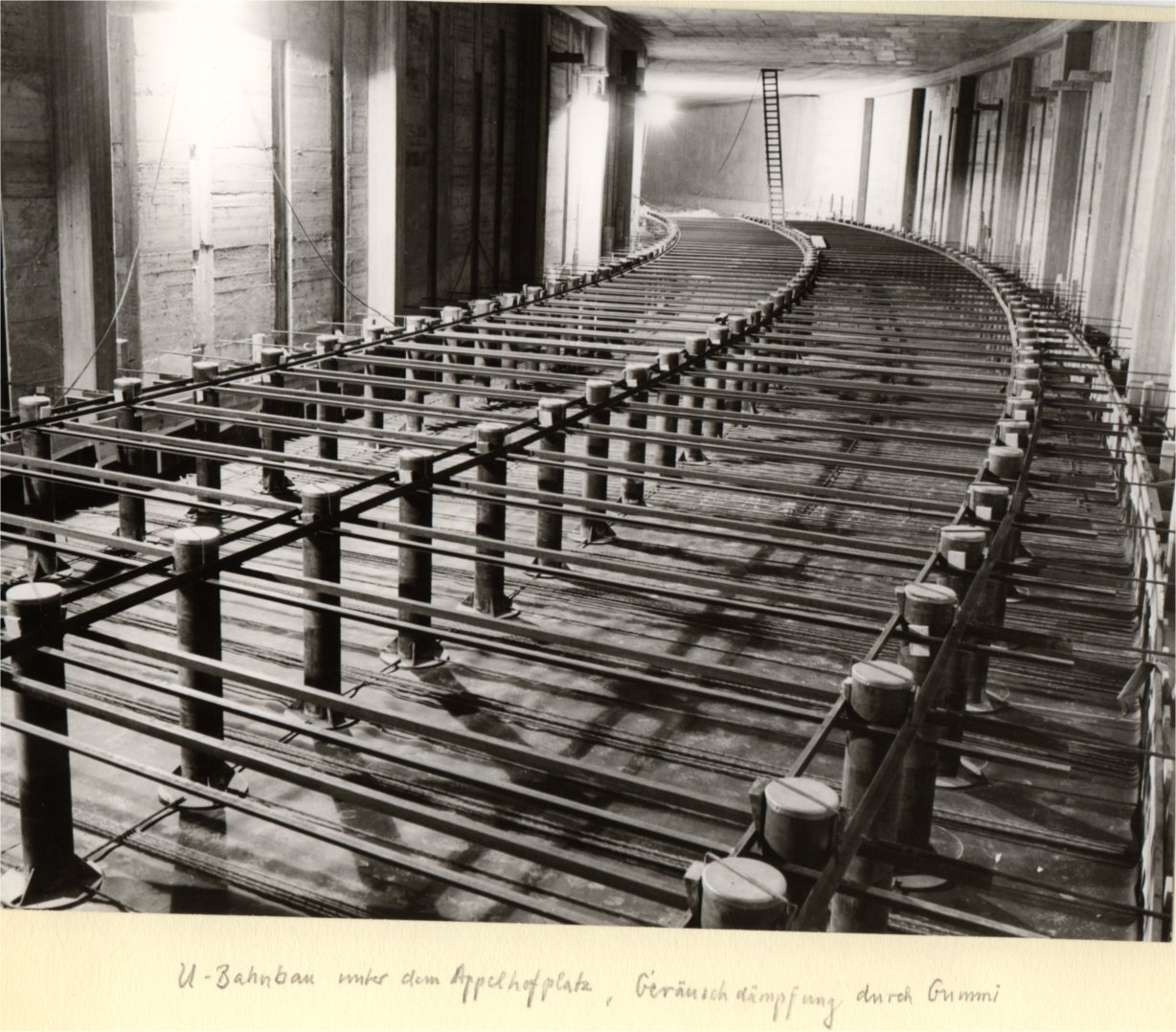
Kölner Ei
Geräuschdämmung
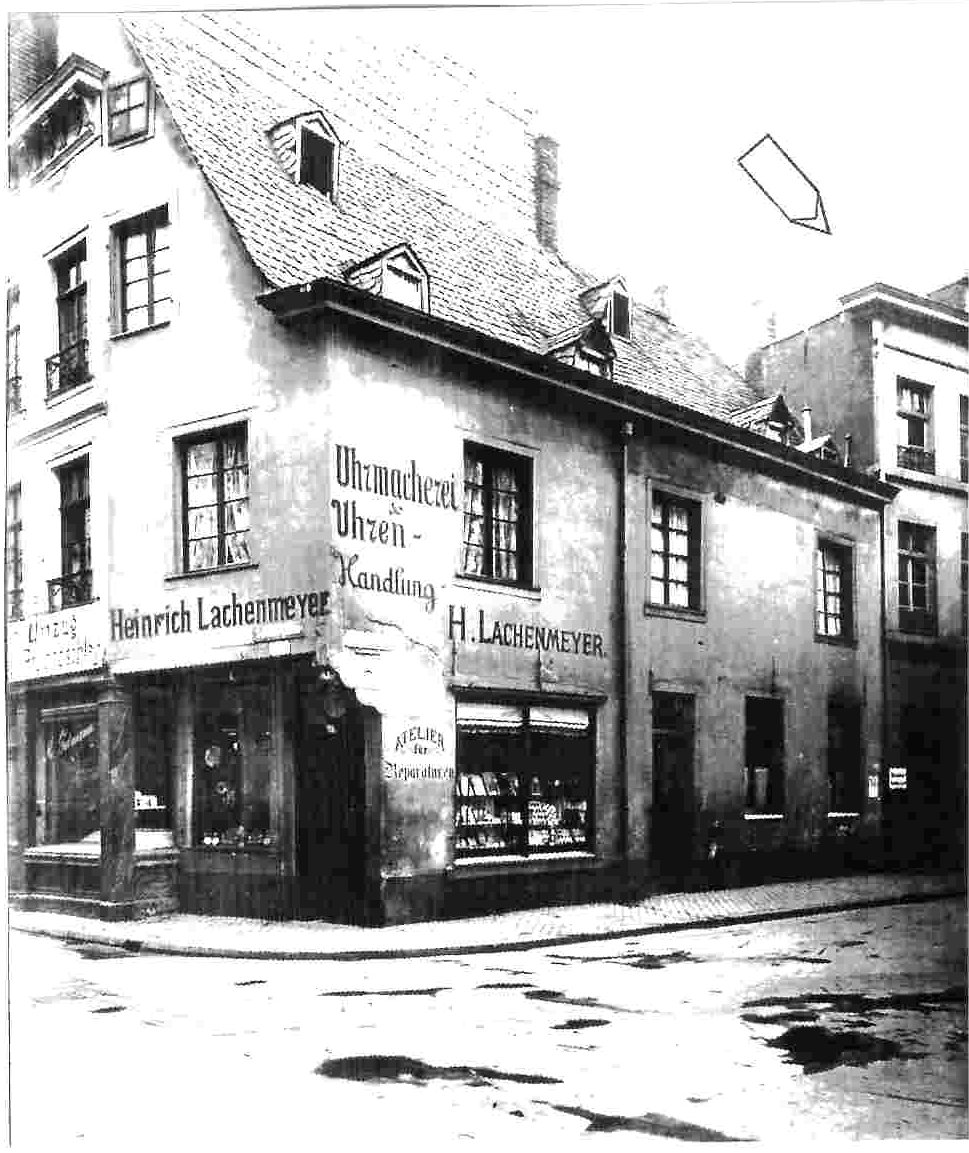
Druckerei Wilhelm
Clouth

Max Clouth ca.1950
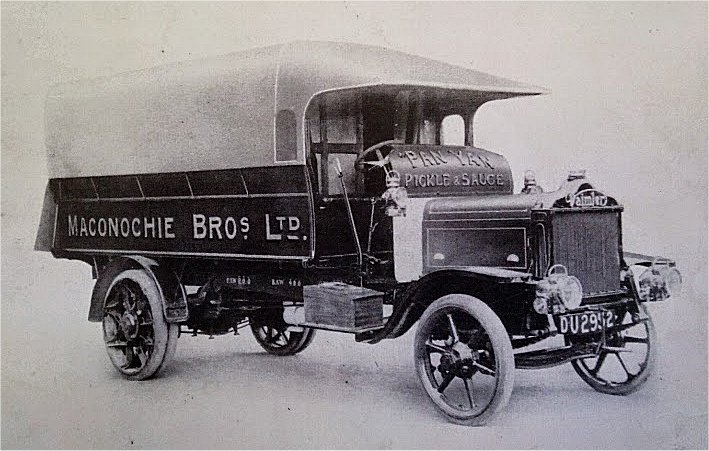
engl. Laster Daimler
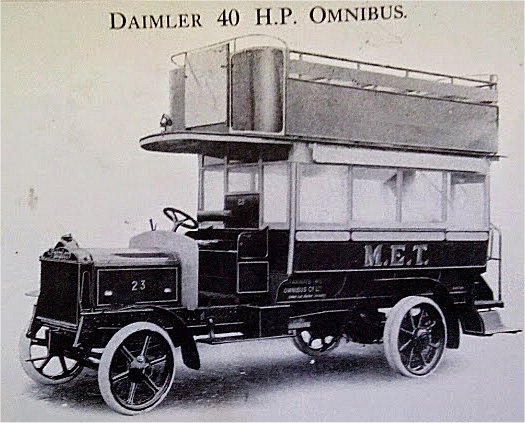
Daimler Bus

Ebonit-Telefon

Dampfmaschinen
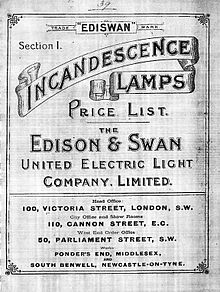
Lampenfortschritt

Bekelit-Radio

KNG Senatspräsident
J.Clouth

Juliane Heine/Hardware

Pfarrer W. Kestermann

Alt-Katholische Kirche
Köln
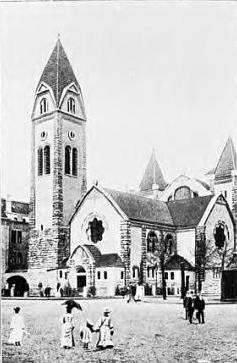
Alte Alt-Kath. Kirche
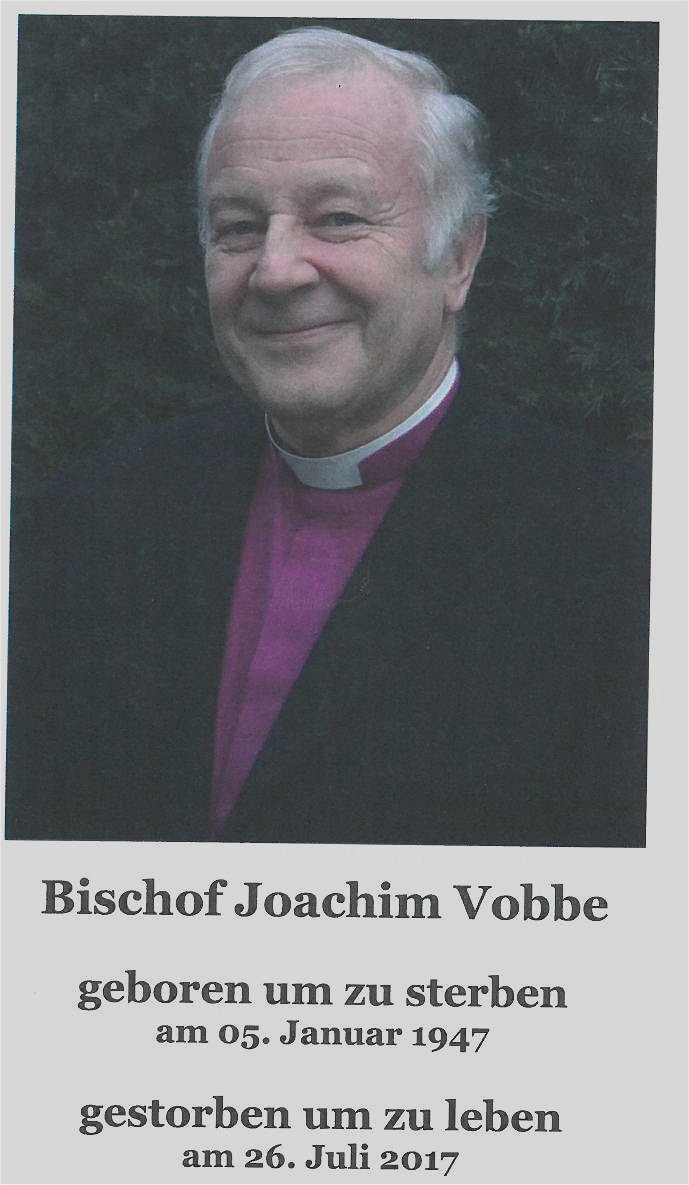
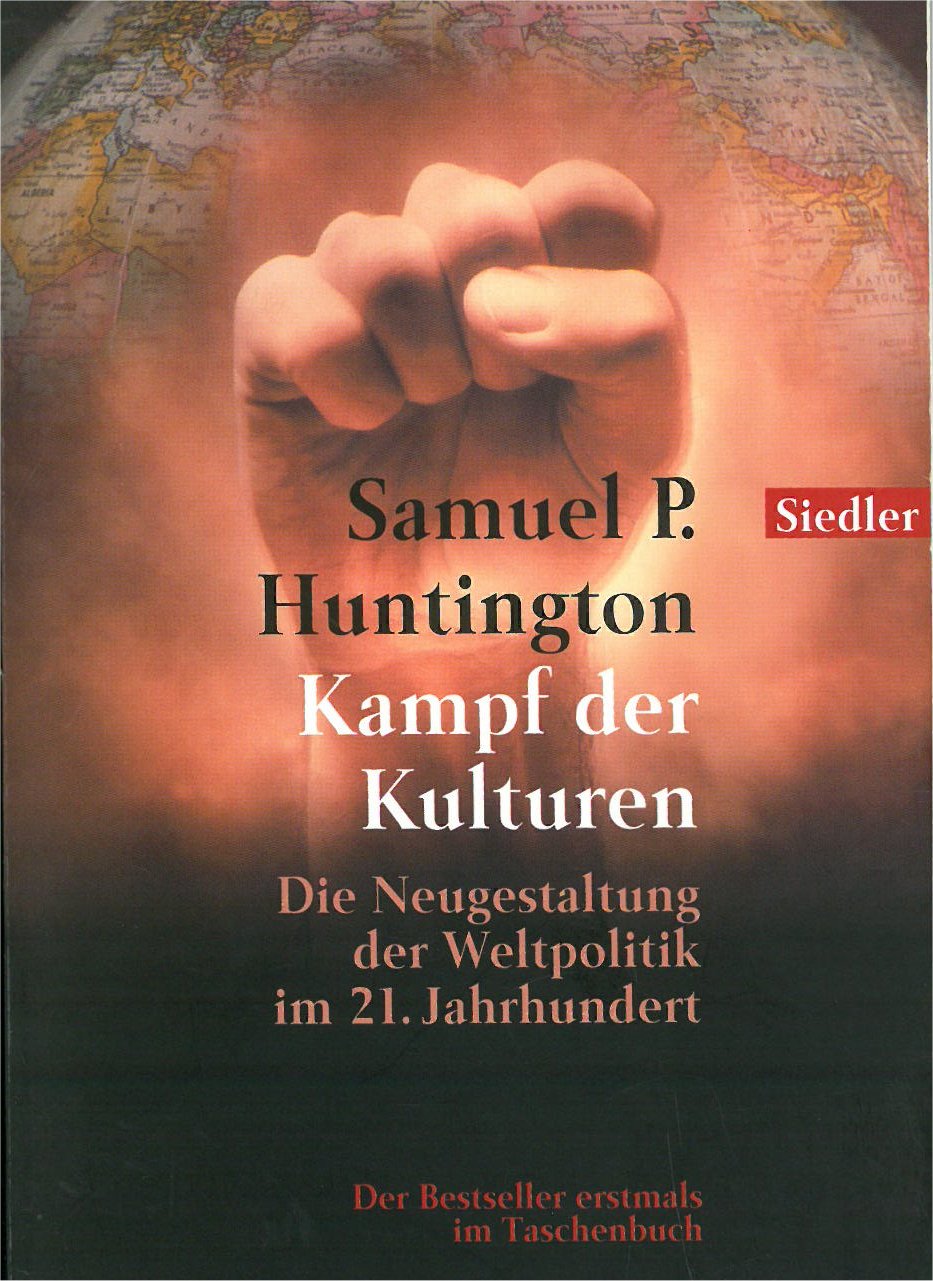
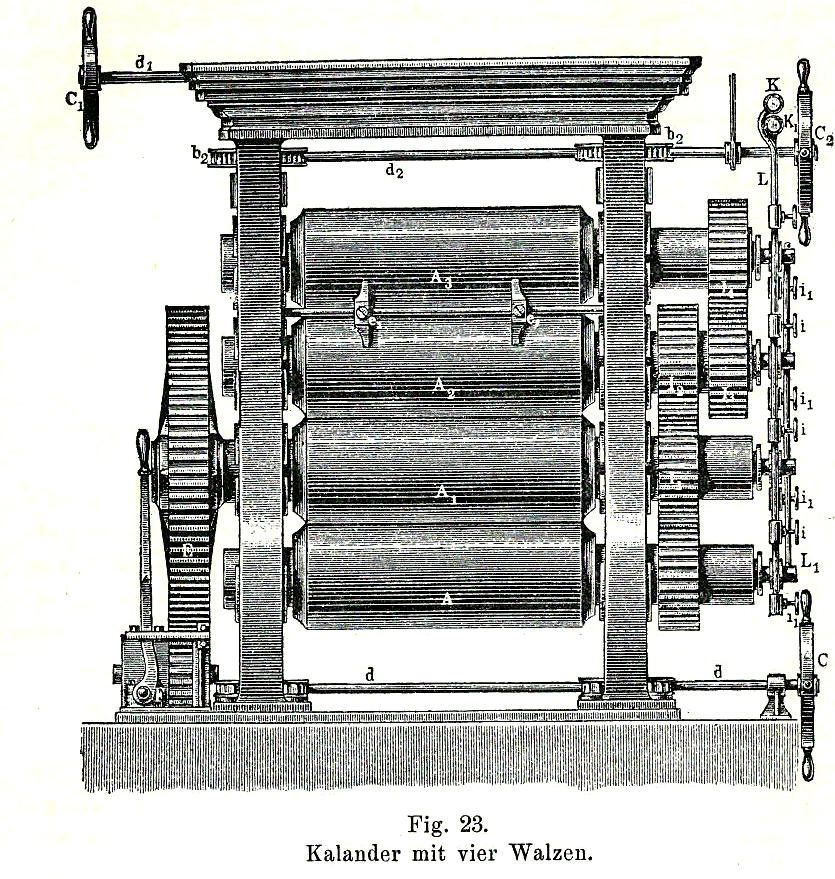
Walzwerk für Gummi
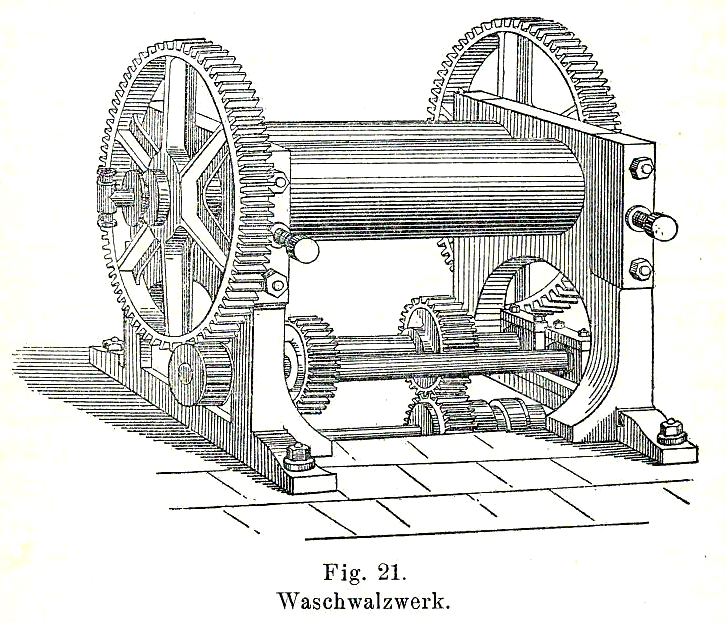
Walzwerk 2

Guttapercha
Pflanze
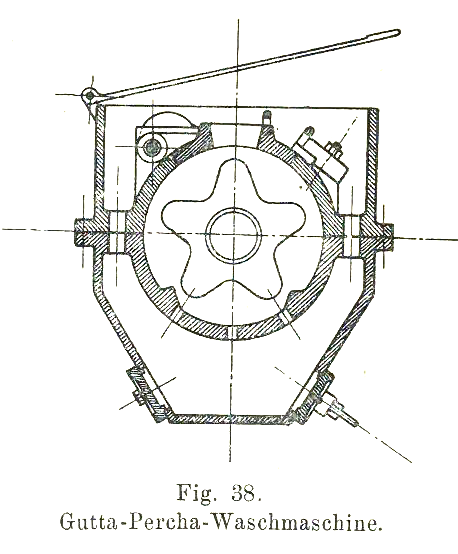
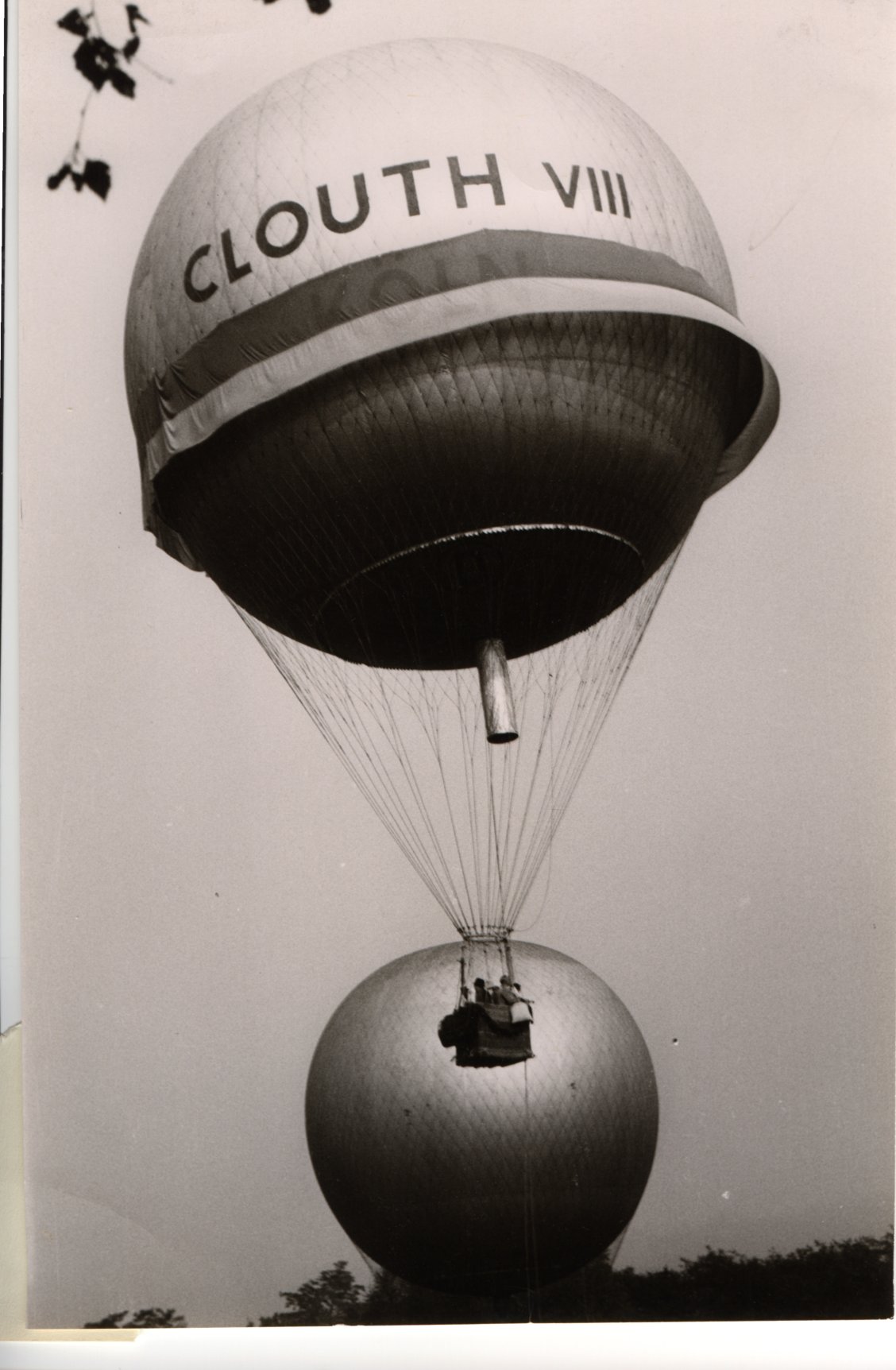
Tauffahrt Clouth VIII

Katharina Clouth
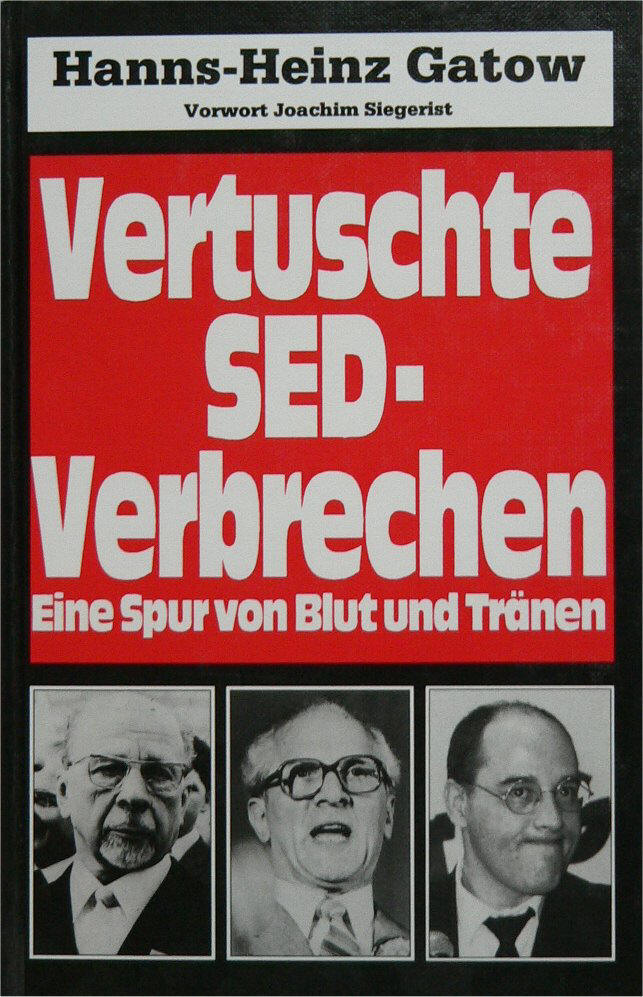
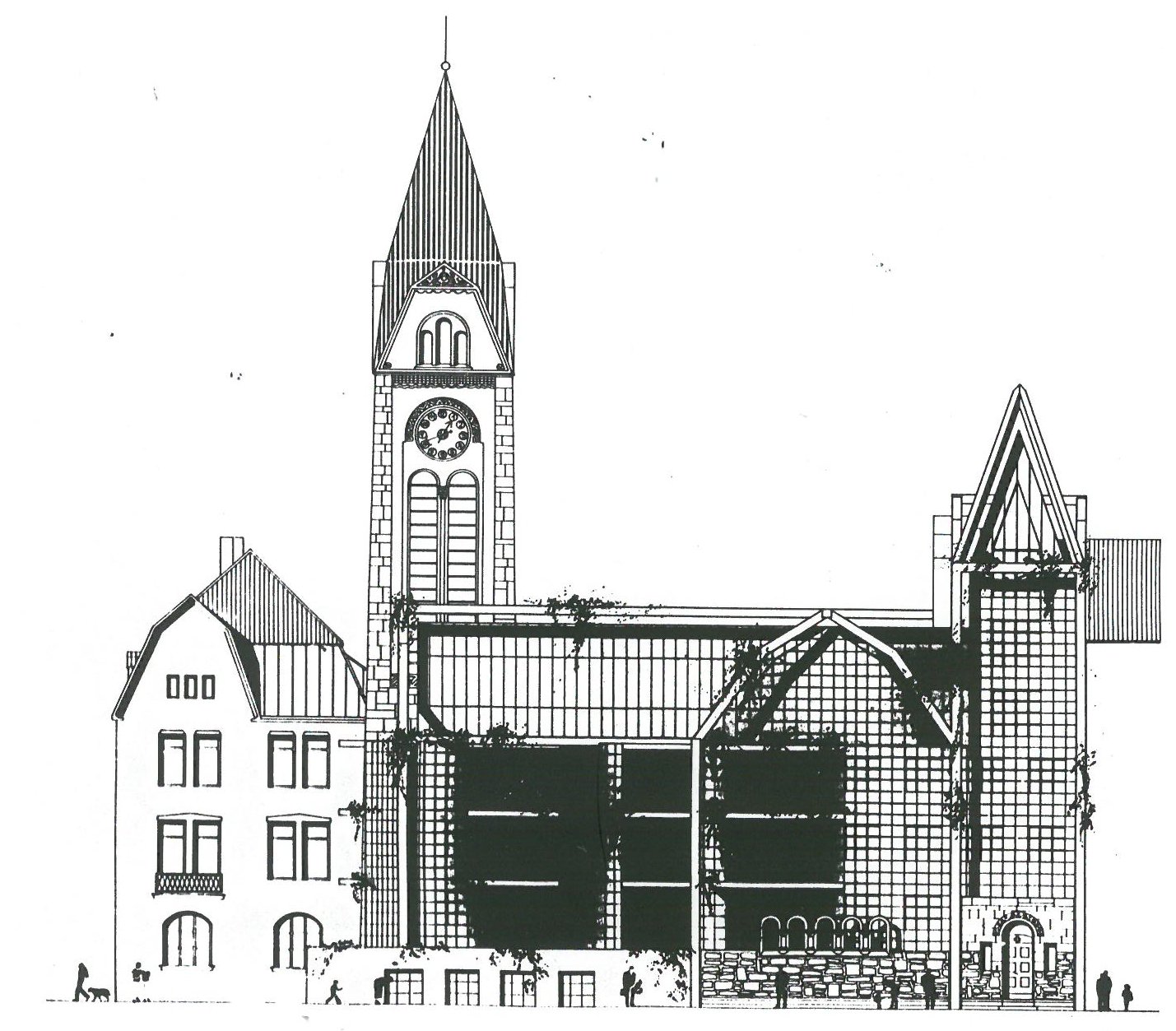
Alt-Katholische Kirche
Köln
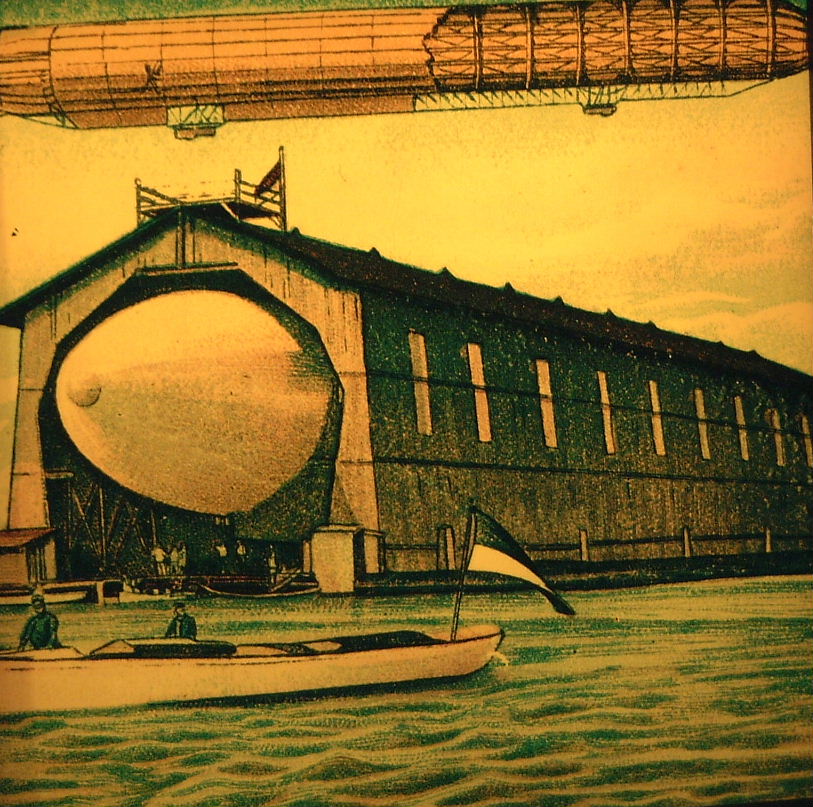
Ballonhalle

Flugobjekt-Wandel ab
1910

Charles Goodyear

Rubber Sheets
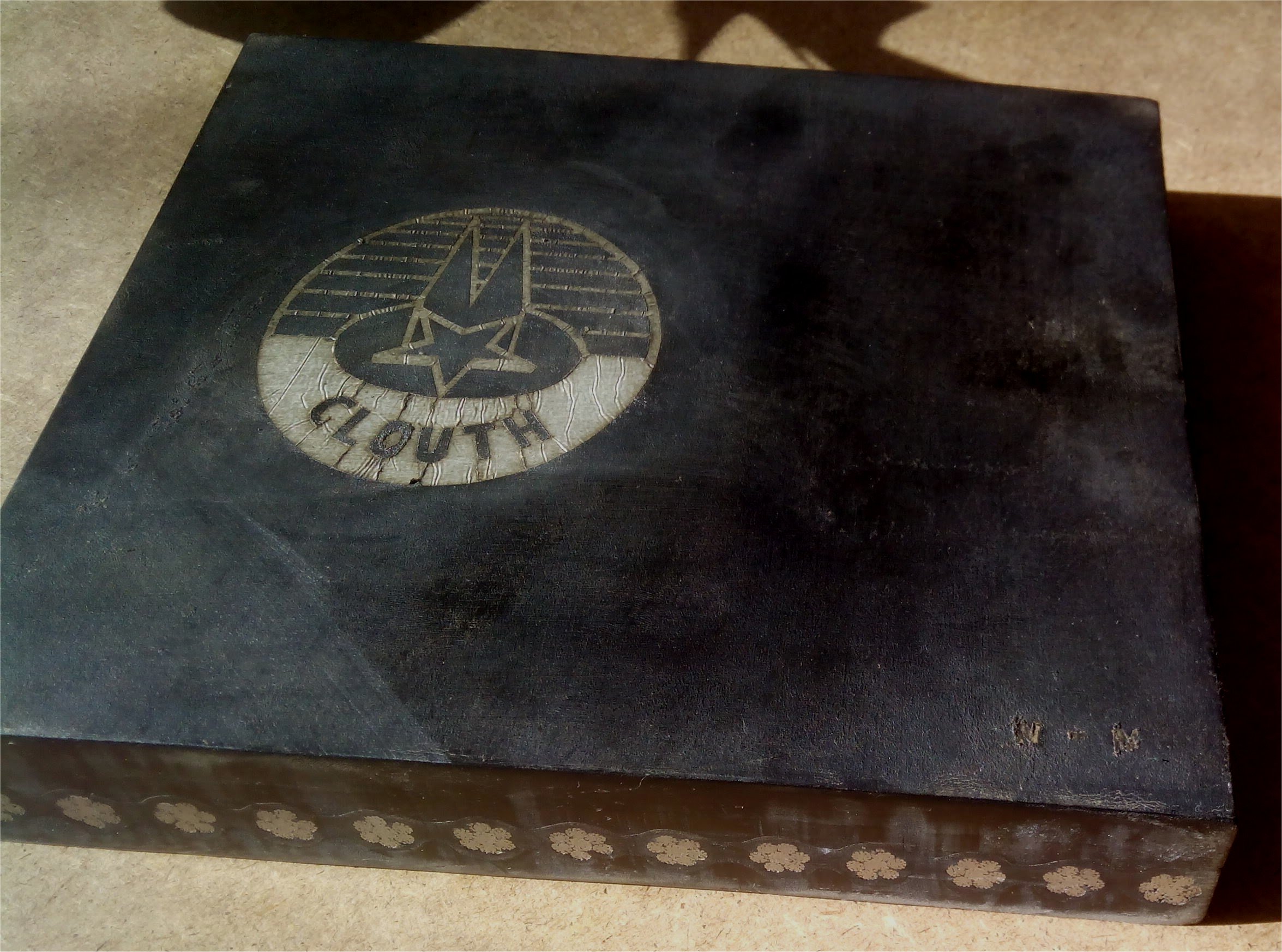
Clouth Förderband

Clouth Pentagon 1899

Audrey Clouth 2017

Rohkautschuk
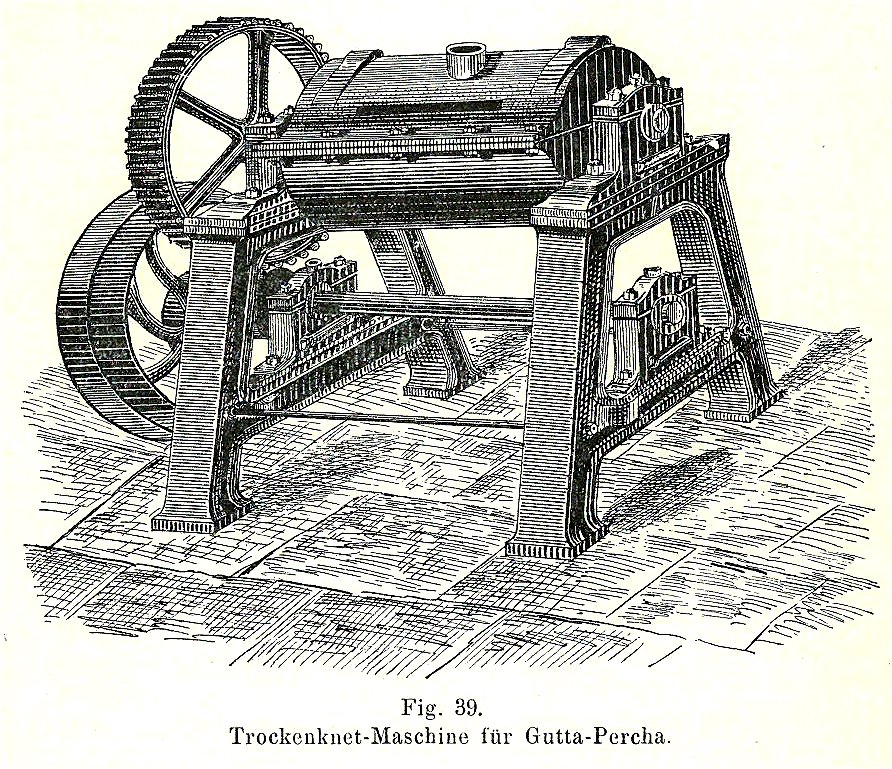
Guttapercha Wäscher
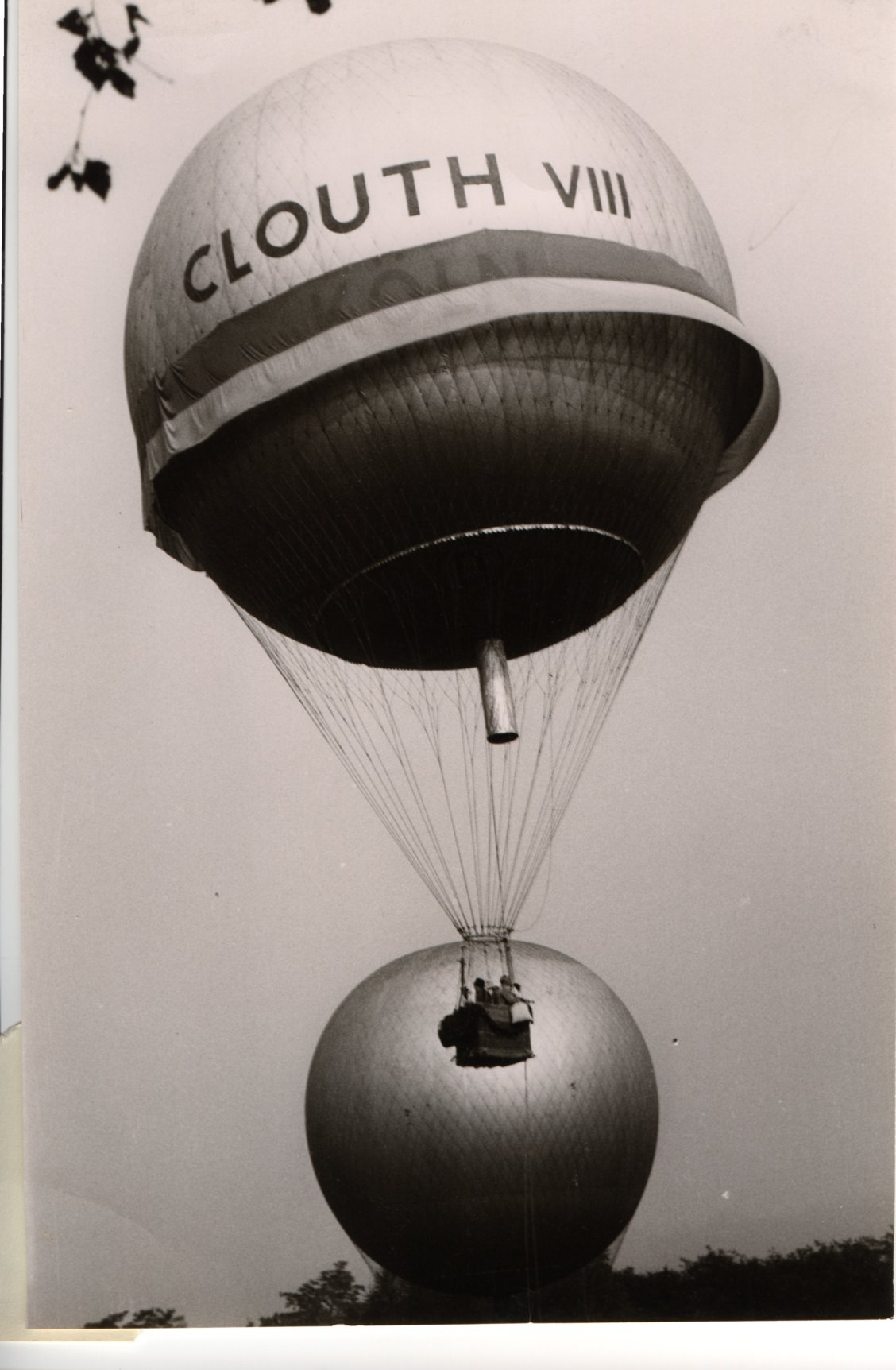
Ballon Clouth VIII

Anni Heine-Clouth
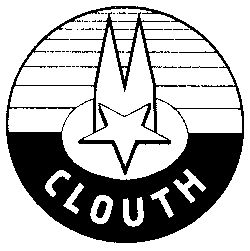
LOGO Sternengasse

J.P. Clouth

Josefine Clouth

Ella Clouth

Altkatholische Kirche
Köln

Köln

Cölner Dom
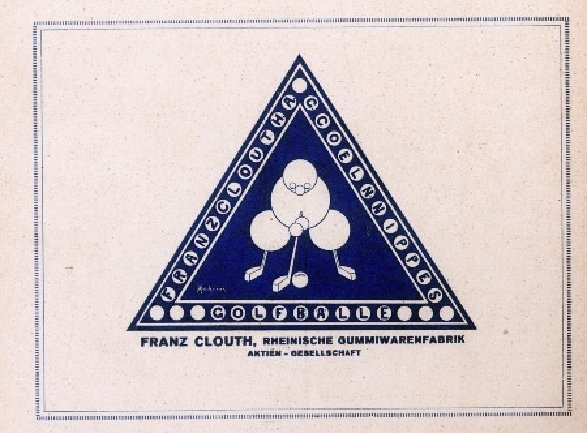
Golfballwerbung

Clouth Tauchhelm

Clouth Taucheranzug
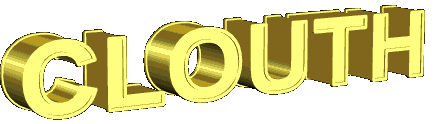
| |
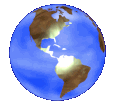
Die
Geschichte des Kautschuks
Vom
Naturstoff zum Industrieprodukt (english
see page end)
 wenn
Sie noch mehr wissen wollen in Details wenn
Sie noch mehr wissen wollen in Details
 Gummi Anbaugebiete (rot gekennzeichnete Gebiete)
Gummi Anbaugebiete (rot gekennzeichnete Gebiete)
Kautschuk und
andere Kunststoffe
 Kautschuk
ist, wie bekannt, der Milchsaft (Latex) gewisser Pflanzen, die, soweit sie für
seine Gewinnung in Betracht k Kautschuk
ist, wie bekannt, der Milchsaft (Latex) gewisser Pflanzen, die, soweit sie für
seine Gewinnung in Betracht k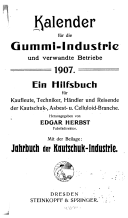 ommen,
den Familien der Euphorbiazeen, Ulmazeen, Apocinazeen, und Asklepiadeen
angehören. Ihre Heimat liegt etwa zwischen dem 25° nördlicher und dem 25°
südlicher Breite, umfasst also das Äquatorial-Guinea Amerika und Afrika, Indien,
den indischen Archipel und die Nordlichter Hälfte von Australien. Die
kautschukreichsten Gebiete, in denen das Kautschuk in großen Mengen wild
wachsend vorkommt, lagen und liegen in Brasilien und im Kongogebiet Afrikas. In
Brasilien sind es hauptsächlich die dort heimischen Hevea- und Manihot-, in
Mexiko die Guayule-, in Afrika die heimischen Landolphia- und Kickxia-, in
Indien und Australien die Fikus-Arten die wild wachsend Kautschuk liefern. ommen,
den Familien der Euphorbiazeen, Ulmazeen, Apocinazeen, und Asklepiadeen
angehören. Ihre Heimat liegt etwa zwischen dem 25° nördlicher und dem 25°
südlicher Breite, umfasst also das Äquatorial-Guinea Amerika und Afrika, Indien,
den indischen Archipel und die Nordlichter Hälfte von Australien. Die
kautschukreichsten Gebiete, in denen das Kautschuk in großen Mengen wild
wachsend vorkommt, lagen und liegen in Brasilien und im Kongogebiet Afrikas. In
Brasilien sind es hauptsächlich die dort heimischen Hevea- und Manihot-, in
Mexiko die Guayule-, in Afrika die heimischen Landolphia- und Kickxia-, in
Indien und Australien die Fikus-Arten die wild wachsend Kautschuk liefern.
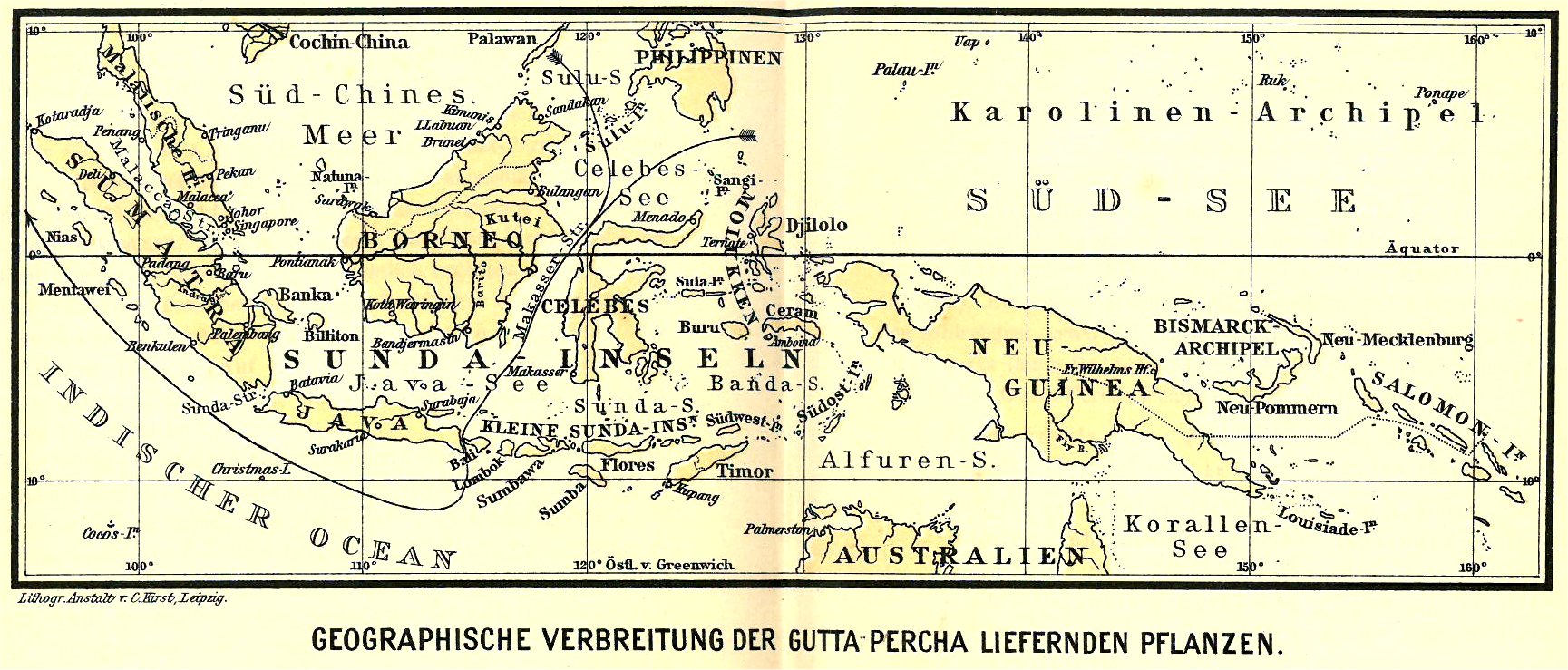
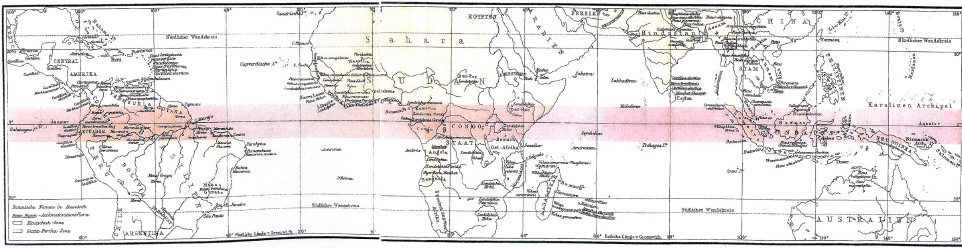
Kautschukgebiete (rosa
eingefärbt)
Die Schwierigkeiten der Ernte in den
Urwäldern, weit entfernt von Verkehrswegen, haben bereits früh dazu geführt,
Versuche mit plantagemäßigem Anbau in günstiger gelegenen Gebieten
wirtschaftlicher zu arbeiten, was nach Überwindung vieler Schwierigkeiten
durchweg später dann günstige Erfolge erzielte und immer größeren Umfang
annahm.die Ausdehnung der angebauten Flächen wurde für 1911 auf insgesamt
400.000 ha angegeben, wovon auch die deutschen Kolonien in Afrika damals etwa
25.000 ha entfielen. Die Produktion an Plantagenkautschuk wurde für 1910 zum
Beispiel insgesamt auf etwa 6.000 t angegeben . Da die Mehrzahl der Pflanzungen
noch jung war und die Kautschukbäume durchweg erst nach 6-8 Jahren anfangen,
eine regelrechte Ernte zu liefern, brauchte man auch hierfür Zeitpunkt.
 Die
beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien
gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine
Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg
akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon
Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser
Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei
der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild
wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen
geringeren Waschverlust. Die
beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien
gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine
Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg
akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon
Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser
Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei
der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild
wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen
geringeren Waschverlust.
Die ungeheure Hausse des Kautschukmarktes
der Jahre 1909-1911 hatte ihre vornehmste Ursache in den mit dem gesteigerten
Weltverbrauch nicht Gleichschritt haltenden Zufuhren von Wild-Para-Kautschuk,
Spekulation und künstliche Treiberei, wie dies in solchen Entwicklungen nicht
ausbleiben kann, wirkten natürlich mit. Demgegenüber befanden sich die Fabriken
in einer höchst schwierigen Lage, die ihnen erhebliche Opfer auferlegte, weil es
damals nicht möglich war, die Erhöhung der Preise für Fertigwaren in dem Maße
vorzunehmen, wie es der Preis des Rohproduktes in seiner Preissteigerung
verlangt hätte.
Die
Geschichte der Menschheit ist eng mit den jeweils verfügbaren Werkstoffen
verbunden. Die Menschen lernten, neben den Materialien natürlichen Ursprung, zum
Beispiel klebenden Baumharzen auch künstlich erzeugte Werkstoffe einzusetzen.
Später wurden aus Naturprodukten wie Milch, Kautschuk und Zellulose sowie aus
fossilen und nachwachsenden Rohstoffen Kunststoffe gefertigt. Die Entwicklung
derartiger Kunststoffe hat die Entwicklung unserer Zivilisation und Kultur seit
dem Mittelalter in einer Weise gesteuert und beschleunigt, die ohne diese
Werkstoffe aus Menschenhand nicht denkbar wären. Die sich nach dem 18.
Jahrhundert rasch verändernden sozialen Strukturen führten zu einer Fülle von
Imitationen und Surrogatsstoffen, die dem Bürger Zugang zu bis dahin nur
wenigen, meist wohlhabenden Schichten vorbehaltene Dinge ermöglichten. Beispiele
hierfür sind damalige Möbel, Puppenköpfe und Ornamente aus Pappmaschee, später
Linoleum als Bodenbelag und schließlich das im 19. Jahrhundert erfundene
Zelluloid als künstliches Elfenbein.
schließlich
erschien es selbstverständlich, dass die chemische Wissenschaft einem Artikel,
der wie das Kautschuk eine so außerordentliche Wortbedeutung im Weltmarkt
errungen hatte, schon frühzeitig seine gesteigerte Aufmerksamkeit erhielt, ein
solches Naturerzeugnis letztlich durch ein synthetisches Verfahren zu ersetzen.
Die ersten bemerkenswerten Versuche in diese Richtung lagen um ein
anderthalbiges Jahrhundert zurück. Hauptsächlich waren esBouchardat,
Tilden und Wallach, die sich mit dem Problem damals beschäftigten. Ihnen war es
gelungen, durch trockene Destillation aus dem Kautschuk
Isopren
herzustellen, das später auch aus anderen Stoffen gewonnen wurde. Umgekehrt aber
gelang es nicht, aus dem Isopren Kautschuk oder ein Diesem ähnliches Material
zurückzugewinnen. Rastlos wurde in den Laboratorien an der Lösung dieser Frage
gearbeitet, lange ohne Erfolg. Dagegen wurden nach einer anderen Seite, die
jener parallel verlief, gute Ergebnisse erzielt. Diese betraf die Regenerierung
und Wiederverwendbarkeit des verbrauchten vulkanisierten Kautschuks, des
sogenannten Altgummis, welches früher als vollkommen wertlos meistens in die
Feuerung unter die Dampfkessel wanderte. Wenn auch zunächst nicht erreicht
wurde, aus diesem Altmaterial ein dem jungfräulichen Kautschuk gleichwertiges
Produkt zurückzugewinnen, so war es letztlich doch gelungen, Regenerate zu
liefern, die als Beimischungen sehr wohl verwendbar waren, weil in vielen Fällen
vollkommen zweckentsprechend.
Im Jahr 1909
gelang es dann auf einem anderen, viel wichtigeren Gebiet, dem Chemiker
bei den Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer & Co in Elberfeld, Dr. Fritz
Hofmann, in Gemeinschaft mit Dr. Coutelle, einen technischen Weg zu finden,
reines Isopren und auch andere diesem nahestehende Verbindungen aus Kohlenstoff
und Wasserstoff durch entsprechende Behandlung in ein Produkt überzuführen,
welches sich in seinen chemischen Eigenschaften vom natürlichen Kautschuk so gut
wie nicht unterscheidet. Zu dem selben Resultat kam auch Professor Harries in
Kiel. Letztlich unterlag es damit keinem Zweifel mehr, dass die stets offene
Frage der synthetischen Erzeugung des Kautschuk damit wissenschaftlich gelöst
war. Die Kostspieligkeit des damaligen Verfahrens schloss damals die praktische
Verwendung des synthetischen Kautschuks für die Zwecke der Industrie noch
weitgehend aus, weil zu teuer. Gleichwohl war es damals nur noch eine Frage der
Zeit, das ebenso, wie es beispielsweise beim künstlichen
Indigo
geschehen war, auch ein billigeres Verfahren gefunden werden würde.
Dadurch aber
eröffnete sich für die Kautschuk-Industrie eine ganz neue Zukunft, die nur als
eine segensreiche angesehen werden konnte. Vornehmlich eröffnete diese Zukunft
die Aussicht auf künftig stetigere Preise des Rohgummimarktes, die durch das
künstliche Produkt reguliert werden konnten. Außerdem würde die absehbare
Verbilligung des Rohmaterials es künftig gestatten, sich der Herstellung einer
großen Reihe von Artikeln zuzuwenden, für die Kautschuk zwar vorzüglich geeignet
erschien, deren Herstellung aus dem teuren Stoffen, eben wegen des hohen
Preises, bis dahin ausgeschlossen waren. Nach alledem konnte man annehmen, dass
die Kautschukindustrieeiner vollkommen umwälzenden Zukunft entgegensah.
Bis 1850 nur
brasilianischer Kautschuk
Bis
etwa zum Jahre 1850 war Brasilien der einzige wichtige Kautschuk-Erzeuger. Es
lieferte nach dem Ausfuhrhafen PARA benannten Para-Kautschuk des
Amazonasgebietes. Die um das Jahr 1800 40-jährlich erzeugten etwa 400 t reichten
in den folgenden Jahrzehnten bei weitem nicht mehr aus.der Kautschuk kam damals
teilweise noch in Form von Flaschen und Schuhen, also Gebrauchsgegenständen der
Kautschuksammler nach Europa. Einige dieser Schuhe waren eine Zeit lang im
Museum der Firma Clouth zu sehen. Nach 1840 wurden auch andere Gebiete zur
Kautschuklieferung herangezogen, unter anderem Süd-Ost-Asien und etwa 1870 auch
Afrika. Mit der Erfindung des Pneumatiks und dem dadurch bedingten aufblühen der
Kautschukindustrie brach eine neue Epoche an. Immer größere Mengen des
Rohproduktes wurden gebraucht und immer neue Gebiete in den Bildnissen Amerikas,
Afrikas und Asiens wurden erschlossen, sodass um die Jahrhundertwende etwa nur
noch die Hälfte des Kautschuk aus dem Amazonas-Gebiet, die andere Hälfte aus den
übrigen Gebieten gewonnen wurde. Praktisch war das alles aber noch
Wildkautschuk. Um 1860 erfolgten auf Java erkennbare Versuche der
plantagenmäßigen Gummierzeugung aus
Ficus Elastica
auch bei den Engländern auf ihren indischen Besitzungen, die zum Erfolg
führten.bei den Engländern allerdings mit einem anderen Baum, nämlich der
Hevea
Brasiliensis.
Sir Henry Wickham hatte 1876 etwa 70.000 Stück Hevea -Samen nach
Kew-Graden in London gebracht. 2000 Stück Kanten und wurden sorgsamst in den
botanischen Garten von
Peradeniya (Ceylon) überführt und bildeten den Grundstock für die
asiatische Plantagenwirtschaft. Im Jahre 1899 kamen die ersten 4 t in den Handel
bei einer Welt Kautschuk-Erzeugung von damals 49.000 t. Die Erzeugung von diesem
Plantagenkautschuk stieg nun langsam an.
1905 -
143 t = 0,2 % der Welterzeugung von 62.000 t
1910-
8200 t = 11,6 % der Welterzeugung von 70.500 t
1915 -
107.000 t = 68 % der Welterzeugung von 158.000 t
1920 -
305.000 t = 88,7 % der Welterzeugung von 343.000 t
1927 -
481.000 t = 93,4 % der Welterzeugung von 516.000 t
1930 -
797.000 t = 97,6 % der Welterzeugung von 817.000 t
Aus
dieser Zusammenstellung ersieht man eine Umstellung der Weltwirtschaft, wie man
sie bei anderen Produkten kaum finden wird. Der wirtschaftende Mensch hatte im
Verlauf von etwa 25 Jahren unter ungeheurem Aufwand an Arbeitskräften, Kapital
und wirtschaftlicher, betrieblicher Forschung eine einzigartige räumliche
Verlegung der Kautschuk-Erzeugung durchgeführt. London, der Finanzier der Welt,
hatte sich des Kautschuk angenommen, ein stark spekulatives Element kam zu der
Verbrauchssteigerung hinzu und die Jahre der Hochkonjunktur 1908-1912 (die die
Jahre des „Rubberbooms") zeigten massiv steigende Durchschnittspreis.
Das
Monopol des Wildkautschuks, insbesondere Brasiliens, war, wie aus der Tabelle
ersichtlich, schon in den Jahren um 1920 herum gebrochen. Die hohen Preise
hatten zur Ausweitung der Plantagenwirtschaft in einem Maße geführt, welches die
Erzeugungsmengen dem Verbrauch vorauseilen ließen. Die Preise kamen dadurch ins
Abwärtsgleiten und erreichten um 1922 ihren vorläufig tiefsten Stand. damals
entstand der Plan, die Produktion und den Verbrauch wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, der sogenannte Stevenson-Plan. Dieser ging von den Engländern aus, die
Holländer lehnten nach langwierigen Verhandlungen ab, sodass am 1.11.22 der
Stevenson-Plan für Malaysia und Ceylon gesetzlich in Kraft trat. Ihm schlossen
sich die übrigen englischen Kolonien freiwillig an. Der Plan sah für jede
Plantage eine Standardproduktion vor, fußend auf der Zeit vom 1.11.19 bis zum
31.10. 20. Von dieser Standardproduktion durfte nach dem Stevenson
Restriktionsschema nur die zulässige Exportquote (zunächst 60 %) zu einem
Mindest-Zollsatz ausgeführt werden. Mengen darüber hinaus wurden mit einer
gleitenden Ausfuhrtaxe belegt. Man suchte den Kautschukpreis zu
stabilisieren. Die Folge war eine allmähliche Preissteigerung.
aber
die Hausse währte nicht lange. In erster Linie durch Gegenmaßnahmen des
Hauptkonsumenten, der vereinigten Staaten von Amerika. Rufer in diesem
Gummikrieg mit dem Schlagwort „use less rubber"
(verbrauche weniger Gummi)
war Staatssekretär Hoover. Der Verbrauch an Autoreifen ging trotz der erhöhten
Automobilproduktion zurück und der erhöhte Verbrauch an Regenerat, dass selbst
in amerikanischen Reifen erster Qualität mit 25 % erhalten war, drückte auf den
Kautschukverbrauch. Amerika ging ferner dazu über, selbst Kautschuk-Pflanzungen
anzulegen und erwarb Plantagen und Ländereien in den verschiedensten Ländern der
Welt, insbesondere auch Sumatra.
Den
inneren Schwierigkeiten des Stevenson-Systems (Holland gehörte ja nicht dazu)
und den äußeren Einwirkungen, insbesondere von Amerika her, musste England sich
beugen. Am 1.November 1928 wurde das Restriktionssystem aufgegeben. Damit war
die freie Wirtschaft in der Kautschuk-Erzeugung und im Kautschukhandel wieder
eingeführt. Die Folge war, dass sehr bald die erzeugten Mengen in steigendem
Maße zunahmen und zwar waren es unter anderem die kleinen Erzeuger, die Besitzer
der "Rubber Gardens", die unvorhergesehene Mengen an sogenanntem "Native
Rubber" lieferten. Die Eingeborenen, die in Malaysia und Ceylon die
Kautschuk-Kultur kennengelernt hatten, begannen, in ihrer Heimat (Süd-Ost-Asien)
zurückgekehrt, auf eigenem Grund und Boden mit der Kultur von Kautschuk-Bäumen.
Dieser Native Rubber (Eingeborenen-Gummi), in gewöhnlichen kleinen Betrieben
gewonnen, den der Besitzer mit seinen Familienangehörigen und notfalls wenigen
Lohnarbeitern bewirtschaftet, war aus kleinen Betrieben, die also sehr beweglich
in der Anpassung an Konjunkturschwankungen waren und wurden. Besser als die
Großbetriebe. Waren die Preise schlecht, stellten sie den Betrieb ein, waren die
Preise gut, dann wurde wieder eröffnet. Das führte aber dazu, dass die
Kautschuk-Erzeugung nunmehr dem Verbrauch wieder vorauseilte. Dadurch und durch
den Zusammenbruch der Weltwirtschaft hatten dann die Preise stark fallender
Tendenz. Trotz der bisherigen Misserfolge wurde weiter der Plan einer
zwangsweisen Beschränkung der Rohgummi-Erzeugung wieder aufgenommen.
Waren
es damals beim "Stevenson-Plan" die europäischen Pflanzer, die für eine
Zwangsregelung eintraten, so waren es jetzt die asiatischen Kleinpflanzer,
insbesondere die Gummipflanzervereinigung Malaysias (damals Malaya genannt).
Diese erließ Aufforderungen an die Pflanzerinsidern und niederländisch-Indien
und ihre neuen Restriktionsbestrebungen fanden gute Aufnahme bei den
maßgeblichen holländischen Pflanzer-und Regierungskreisen.
Am 18.
September 1933 sprach sich auch die "Rubber Growers Association" für eine
Beschränkung aus. Die britische Regierung forderte die Mitwirkung aller
Erzeugungsgebiete, während die Franzosen Indo-China von einer Beschränkung
ausgenommen haben wollten, was sie auch später durchsetzten. Nach mancherlei
Schwierigkeiten wurde am 1. Juni 1934 die Restriktioneingeführt, wobei außer
Indo-China zunächst auch Siam von der Restriktion frei blieb. Die
niederländisch-indische Regierung belegte, um auch die Eingeborenen zur
Einschränkung zu zwingen, die Ausfuhr von Nativem Kautschuk mit einer besonderen
Ausfuhrabgabe.
Deutschland stand im Jahre 1936 bezüglich der Kautschuk-Einfuhr an dritter
Stelle hinter den vereinigten Staaten mit 573.500 t und England mit 99.700
t. Über die Welt Kautschuk-Wirtschaft lässt sich sagen, dass die Restriktionen
im Jahre 1936 erfolgreich gewesen ist. Die Kautschuk-Pflanzung Wirtschaft kam
wieder auf eine ertragsfähige Basis.
Kautschukprodukte
der Zeit
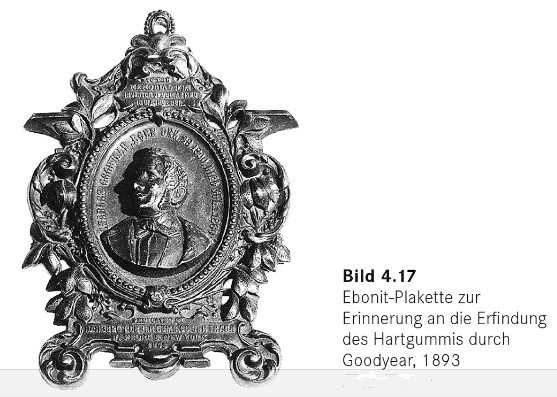 Der
erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische
Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für Der
erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische
Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für Ebenholz wurde und sogar natürliches Schildpatt ersetzte. Den chemisch
modifizierten Naturstoffabkömmlingen aus Naturkautschuk, Kasein und Zellulose
folgte zu Anfang des 20. Jahrhunderts als erster voll- synthetischer Kunststoff
das von Leo Hendrik Baekeland entwickelte „BAKELIT“, ein Polymeeres aus Phenol
und Formaldehyd, das zwar schon 1872 entdeckt worden war, aber zunächst kaum
Anwendungsinteresse erregte, denn man fand zunächst keine praktische Anwendung
dafür. Mit den sogenannten Phenolharzen begann in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts die moderne „Kunststoffzeit“ in der auch zahlreiche weitere
synthetische Produkte wie Polyvinylchlorid, Polystyrol und die Poliolefine ihren
Ursprung haben.
Ebenholz wurde und sogar natürliches Schildpatt ersetzte. Den chemisch
modifizierten Naturstoffabkömmlingen aus Naturkautschuk, Kasein und Zellulose
folgte zu Anfang des 20. Jahrhunderts als erster voll- synthetischer Kunststoff
das von Leo Hendrik Baekeland entwickelte „BAKELIT“, ein Polymeeres aus Phenol
und Formaldehyd, das zwar schon 1872 entdeckt worden war, aber zunächst kaum
Anwendungsinteresse erregte, denn man fand zunächst keine praktische Anwendung
dafür. Mit den sogenannten Phenolharzen begann in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts die moderne „Kunststoffzeit“ in der auch zahlreiche weitere
synthetische Produkte wie Polyvinylchlorid, Polystyrol und die Poliolefine ihren
Ursprung haben.
Durch das
Zusammenwirken wissenschaftlicher Grunddisziplinen des Kunststoffgebietes gelang
es später schließlich, die in der Anfangszeit nur empirisch erkannten
Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften der Kunststoffe zu verstehen.
Gleichzeitig entstand mit den Verfahren zum Formen von Kunststoffen zu
Fertigprodukten ein eigenständiger Zweig der Ingenieurwissenschaft, sodass heute
Chemie, Physik und Verarbeitungstechnik mit den dafür verwendeten Maschinen
gemeinsam die Säulen dieser jüngsten Werkstoffgruppe in der Geschichte der
Technik bilden.
Kautschuk
werden getrennt von den Kunststoffen als eigene Werkstoffgruppe betrachtet. Das
hängt in erster Linie mit seinem elastischen Verhalten zusammen und den dadurch
von den klassischen Kunststoffen sehr verschiedenen Eigenschaften. Der
Naturkautschuk gehört zusammen mit einigen synthetischen Stoffen mit ähnlichem
Verhalten zu den Elastomeren, wie im technischen Sprachgebrauch die schwach, d.
h. weiten, vernetzten kautschukelastischen Polymeren genannt werden, für die
auch die Bezeichnung „Gummi“ gebräuchlich ist.
Physikalisch beruht der Unterschied zwischen Kunststoffen und Kautschuk vor
allem auf der sehr verschiedenen Lage der Glastemperatur, also dem
charakteristischen Übergang vom glasartigen, harten in den elastischen Zustand
der relativ weitmaschigen Netzstruktur der vulkanisierten Kautschuke.
Bei
Kautschuk handelt es sich um weitgehend amorphe mehr oder minder elastische
Polymere mit Glastemperaturen unterhalb der Gebrauchstemperatur. Eine besondere
Gruppe bildet der starre, also engmaschig vernetzte Hartgummi, der zum Beispiel
als EBONIT in vielen Eigenschaften und seinen Anwendungen eher den
pyroplastischen Kunststoffen entspricht, da er nur wenig elastisch ist und sich
deshalb auch kaum gummiartig verhält.Die Gummi-Elastizität ist eine Folge der
besonderen Anordnung der Kettenmoleküle
Der aus
Brasilien stammende Kautschuk, Havea Brasiliensis, ist bereits seit dem 16.
Jahrhundert in Europa bekannt. Dieser Naturkautschuk hatte aber erst seine
große wirtschaftliche Bedeutung aus drei Gründen im späteren 19. Jahrhundert:
1. die Entdeckung der
Vulkanisation machte aus dem klebrigen Kautschuk dauerhaft
stabilen Gummi
2. die technische Entwicklung des Gummireifens führte zu einem rasanten Anstieg
des Kautschukbedarfs
3. nur durch das schrittweise verdrängen des Wildkautschuks durch
Plantagenkautschuk konnte der rasch steigende Verbrauch um die Wende zum 20.
Jahrhundert gedeckt werden
Die größte
Bedeutung für die Entwicklung der Kautschukindustrie kam zweifellos der
Vulkanisierung zu, die dem Kautschuk die Klebrigkeit und die Löslichkeit nimmt.
Nicht ganz klar ist die Herkunft des Wortes „Vulkanisierung“, vielfach wird
vermutet, dass die mit Schwefel und Hitze, den Attributen des Vulkanismus,
verbundene Behandlung des Kautschuks daher ihren Namen erhalten hat
Im Jahr
1839 entdeckte der Amerikaner Charles Goodyear vermutlich zufällig beim Erhitzen
einer Mixtur aus Kautschuk und Schwefel auf einer heißen Herdplatte die
Vulkanisation des Kautschuks .Er untersuchte diesen Vorgang genauer, konnte aber
damals noch nicht wissen, dass bei etwa 140 °C die linearen Ketten des
Naturkautschuks über Schwefelbrücken zu einem dreidimensionalen Netzwerk
verknüpft werden.
Charles
Goodyear erteilte sofort nach dem Patentieren seines Verfahrens zur
Kautschuk-Vulkanisation 1844 Lizenzen an verschiedene Fabrikanten zum Herstellen
von Gummischuhen. Die nach seinem Verfahren erzeugten Schuhe wurden jedoch beim
Gebrauch rasch hart und erweichten bei heißem Wetter. Die Herstellung war auch
umständlich, da jeder Schuh aus vier Teilen bestand, die einzeln hergerichtet
und dann zusammengesetzt werden mussten. Ein Nachteil seines Verfahrens war die
lange Dauer von einigen Stunden, die zum vollständigen vulkanisieren
erforderlich war.
Im Rahmen
dieser Vulkanisation des Kautschuks festigte sich aber schnell die Auffassung,
dass das Ganze ein chemischer Prozess sei. Im Jahre 1846 erfand dann der
Engländer Alexander Parkes den sogenannten kalten
Vulkanisierprozeß. Durch
diesen Vorgang wurde erzielt, dass der Kautschuk in einer Lösung von
Chlorschwefel in Schwefelkohlenstoff getaucht wurde, was hauptsächlich zum
wasserdicht machen von Geweben damals benutzt wurde.
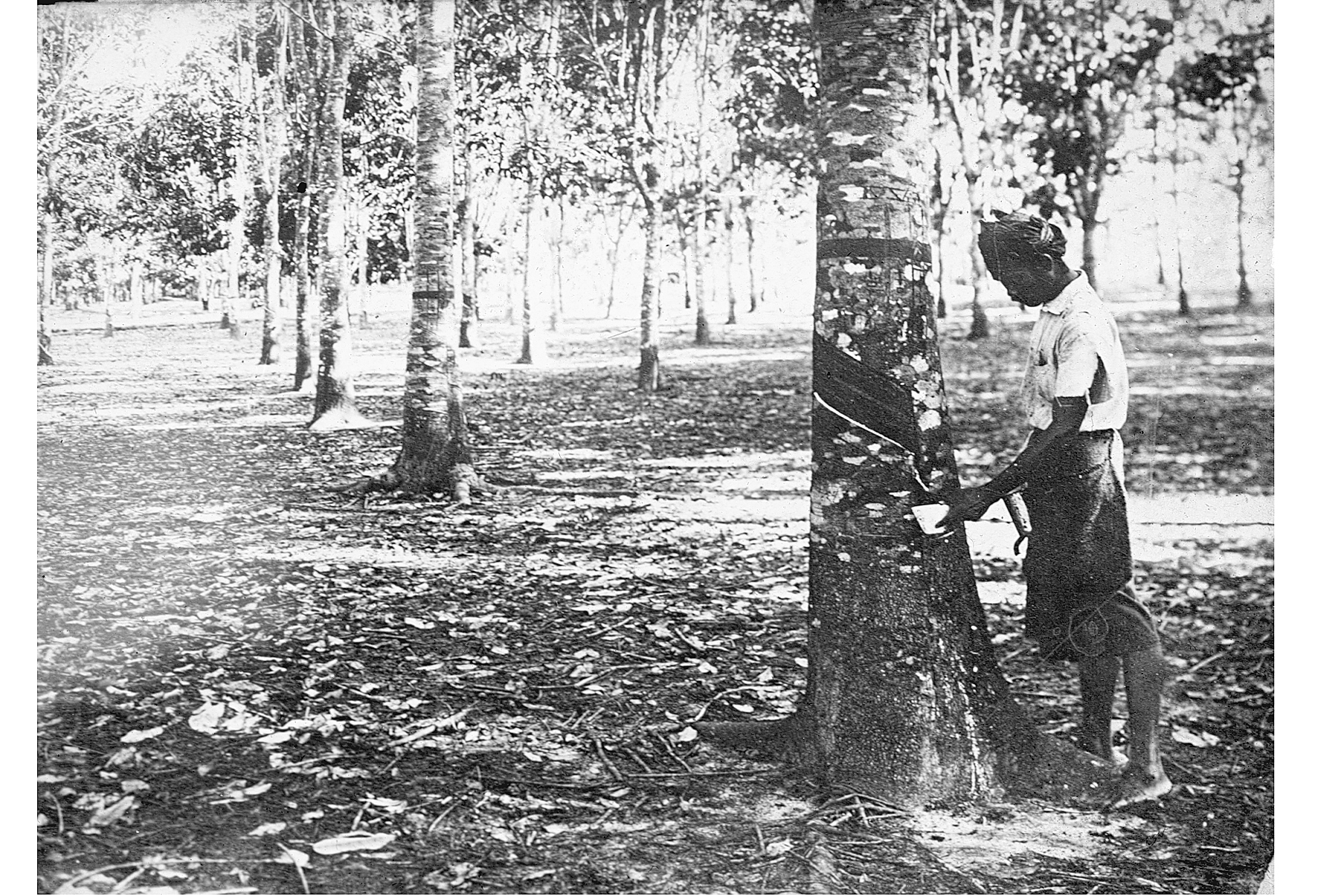
Kautschuk
ist und bleibt einer der vielfältigsten Einsatzmittel für den menschlichen
Alltag
Ursprünglich in Brasilien mit Weltmonopolstellung zu Hause, wurden, wie bereits
beschrieben, 70.000 Samen
durch den im Amazonasgebiet lebenden Engländer Henry Wickam 1876 aus Brasilien
heraus geschmuggelt, 2000 keimten in englischen Gewächshäusern aus und gelangen
als junge Pflanzen nach Ostasien, insbesondere Indonesien. Während in Brasilien und dem Amazonasgebiet
Gummibäume vereinzelt im Wald standen und deshalb zeitaufwendig angezapft werden
mussten, entwickelte Fernost schnell ein Plantagensystem, mit dem vermehrt
Verkaufspotential für den Weltbedarf beschaffen werden konnte. Das
brasilianische Verkaufsmonopol wurde damit durchbrochen. Wer in Peru den Amazonas
sehen möchte, fliegt nach Iquitos. Der Kautschuk hatte auch Iquitos in den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts reich gemacht. Gummibarone wie
"Fitzcarraldo", verkörpert von Klaus Kinski in dem Film von Roman Herzog, ließen
sich pompöse Villen an die Uferpromenade bauen. Die Jugendstilfassaden sind
heute zum Teil restauriert noch anzusehen. Nach 30 Jahren war es aber auch dort
damals mit dem Kautschuk-Boom vorbei.
Die Entwicklung der
Fahrzeugindustrie heizte zudem den Weltbedarf an Kautschuk rasant an. Daraus
entwickelten sich schnell Kautschukverarbeitungsbetriebe, zu denen dann auch die Fa. Clouth in Köln Nippes gehören sollte.
Vom Wildkautschuk
zum Plantagenkautschuk
Durch die
Suche nach komfortableren Reifen für Kutschen und die ersten Fahrräder und Autos
stieg der Kautschukbedarf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so stark,
dass der Wildkautschuk nicht mehr ausreichte. Die Erzeugung von Wildkautschuk
(im Jahre 1830:150 t, im Jahr 1856:7.000 t) war auch naturgemäß nicht beliebig
zu steigern. Schon im Jahre 1890 stand der Weltproduktion von 29.000 t ein
Verbrauch von 27.000 t gegenüber.
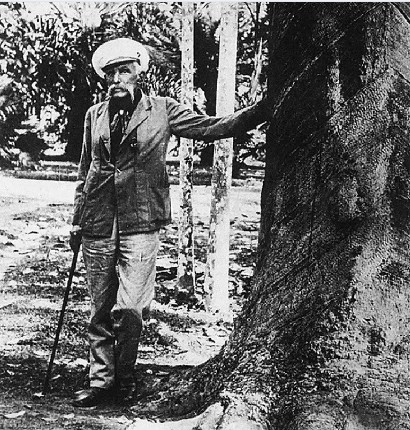 Das
für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der
Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach
Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des
Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen
Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen
begannen. Das
für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der
Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach
Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des
Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen
Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen
begannen.
Um das zu
verhindern, achtete vor allem Brasilien, wie eingangs bereits erwähnt,
zunächst streng darauf, dass keine Samen des Kautschuks ins Ausland gebracht
werden durften. Dennoch schmuggelte Henry Wickham der dafür 1926 geadelt wurde,
schon im Jahre 1876 etwa 70.000 Haveasamen von Brasilien nach London, aus denen
2600 Pflänzchen gezogen werden konnten. 1800 dieser Pflanzen bildeten um 1880 in
Ceylon und Malaysia den Grundstock der ersten Plantagen in Südostasien. Im Jahre
1889 wurden daraus 550 kg Plantagenkautschuk gewonnen und 1900 kamen bereits
4.000 t auf den Weltmarkt.
1910 und 1920 übernahmen die Plantagen nach und nach die Kautschukproduktion
fast völlig.
Die
Geschichte um Henry Wickham ist übrigens im Film "Kautschuk" treffend wiedergegeben.:
https://youtu.be/_JYXnJB_wgE
Gummiherkunft
und aktuell im Einsatz:
https://youtu.be/UlGqFrnS9M0
Aktuell größter
Kautschuk Gewinner Thailand:
https://youtu.be/JwN2GJUpWgM
Synthetischer
Kautschuk:
https://youtu.be/uQ2IUkhQOY0
 Details zur
Kautschuk-Gewinnung nach Buch von Franz Clouth
Details zur
Kautschuk-Gewinnung nach Buch von Franz Clouth

Asiatische
Kautschukplantage
(angeblich Indonesien)
als Belieferer Fa. Clouth
(siehe Bilder)
Als
vor über 100 Jahren Firmengründer Franz Clouth eine der ersten
Gummiwarenfabriken in Deutschland gründete, mußte der dafür notwendige Rohstoff
Kautschuk ausschließlich aus Südamerika eingeführt werden, denn nur dort wuchsen
Kautschuk-Bäume, aus deren dickflüssigem Saft Naturkautschuk gewonnen wird.
Schon Kolumbus sah in Südamerika Eingeborene mit springenden Kugeln spielen, die
aus gehärtetem Pflanzensaft hergestellt wurden. Davon fasziniert, brachten die
Spanier Kautschuk nach Europa. Erst wesentlich später entdeckten Engländer auch
andere Nutzungsmöglichkeiten für diesen Naturstoff. Man bemerkte, daß man damit
durch Reiben Bleistiftstriche von Papier entfernen kann, was dem Material den
englischen Namen ‘rubber’ (dt.: reiben) einbrachte. Charles Macintosh meldete
1823 das erste Patent auf ein Produkt an, bei dem Kautschuk verwendet wurde. Er
brachte zwischen zwei Schichten aus Textilfasern eine dünne Kautschukschicht und
wurde so zum Erfinder des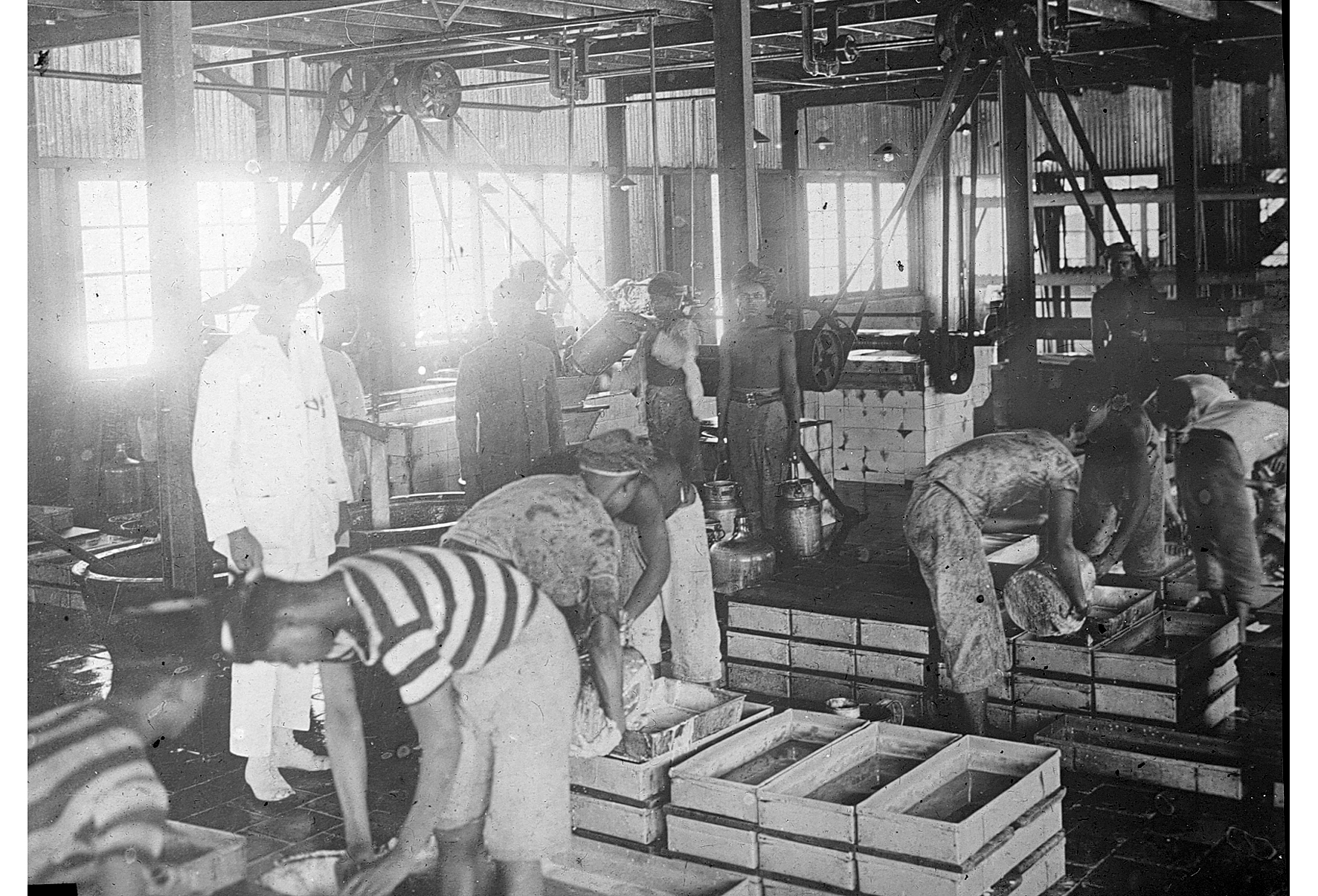 Regenmantels (in England heute noch ‘mack’ genannt). Kautschuk hatte die
unangenehme Eigenschaft, bei höheren Temperaturen weich und klebrig, in der
Kälte aber lederartig und hart zu sein. Der Amerikaner Charles Goodyear fand
1839 heraus, wie man dem Kautschuk diese Eigenschaften nehmen kann.
Versehentlich geriet ihm ein Gemisch aus Kautschuk und Schwefel auf eine heiße
Herdplatte. Er kratzte es sofort ab und stellte zu seiner Verblüffung fest, daß
die Mischung, obwohl noch warm, sich trocken und nicht weich und klebrig
anfühlte. Das Material blieb auch in der Kälte elastisch. Diese Entdeckung
markierte die Geburtsstunde der Gummiindustrie, die mit zunehmender
Industrialisierung einen rapiden Aufstieg erfuhr. Das Verfahren, bei dem man dem
Kautschuk Schwefel beimischt, bezeichnet man heute als Vulkanisieren (nach dem
röm. Feuergott Vulcan, wie Manche ebenfalls meinen). Mit geschmuggelten Pflanzensamen wurden Ende des letzten
Jahrhunderts
Regenmantels (in England heute noch ‘mack’ genannt). Kautschuk hatte die
unangenehme Eigenschaft, bei höheren Temperaturen weich und klebrig, in der
Kälte aber lederartig und hart zu sein. Der Amerikaner Charles Goodyear fand
1839 heraus, wie man dem Kautschuk diese Eigenschaften nehmen kann.
Versehentlich geriet ihm ein Gemisch aus Kautschuk und Schwefel auf eine heiße
Herdplatte. Er kratzte es sofort ab und stellte zu seiner Verblüffung fest, daß
die Mischung, obwohl noch warm, sich trocken und nicht weich und klebrig
anfühlte. Das Material blieb auch in der Kälte elastisch. Diese Entdeckung
markierte die Geburtsstunde der Gummiindustrie, die mit zunehmender
Industrialisierung einen rapiden Aufstieg erfuhr. Das Verfahren, bei dem man dem
Kautschuk Schwefel beimischt, bezeichnet man heute als Vulkanisieren (nach dem
röm. Feuergott Vulcan, wie Manche ebenfalls meinen). Mit geschmuggelten Pflanzensamen wurden Ende des letzten
Jahrhunderts
in
Indonesien und Teilen Asiens große Kautschuk-Plantagen durch europäische
Kolonialmächte angelegt. Doch schon zu Beginn dieses Jahrhunderts (1909) wurden
die ersten synthetischen Kautschuke hergestellt, die dem Naturrohstoff viel an
Bedeutung nahmen.
Teil
des Geländes wurde seit 2007 bis 2015 nicht mehr für die Produktion genutzt
sondern zu Gewerbezwecken vermietet, 2015 wurde das gesamte Firmengebiet geräumt
für ein neues Wohnungsbauprojekt.
Kautschukplantage in Indonesien, vermutlich Clouth-eigen, aber bisher nicht
belegt!
Rubber plantation in Indonesia,
presumably Clouth-own, but so far not proven!



Kautschukplantagen/Kautschukbäume; ein
Baum produziert pro Schnitt durchschnittlich 20-30 mg, wobei es natürlich auf
die jeweilige Baumhöhe und Stammstarke ankommt. Nach Erfahrungen geben die Bäume
nachts mehr Milch ab als am Tag.
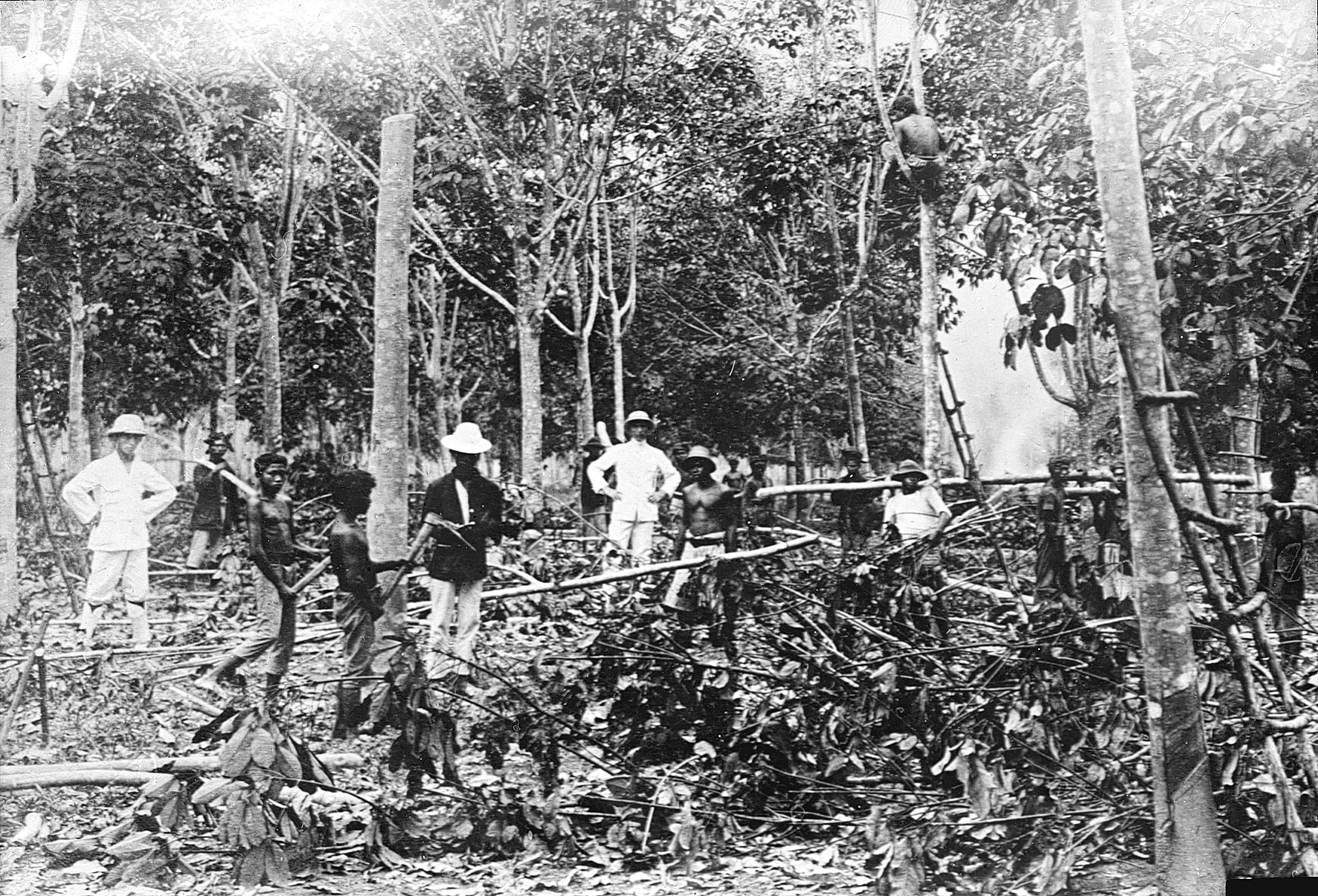
 
Kautschukbaum-Plantagen
(Wikipedia)
Nachdem Kautschuk in
Form von
Gummi zu einem wichtigen Werkstoff
geworden war, gab es Versuche, Kautschukbäume in
Plantagen zu züchten. In Südamerika
gelang dies nicht, da der Pilz
Microcyclus ulei
diese Produktionsweise verhinderte. Die Engländer konnten in
ihren
Kolonien in Asien aber Plantagen
aufbauen (Microcyclus ulei konnte sich bisher nicht in
Asien etablieren,[3]
dafür aber andere Pilzarten, die mit
Fungiziden bekämpft werden können.[4])
Bereits 1876 hatte
der Engländer
Henry Wickham rund 70.000
Kautschuksamen aus Brasilien in das britische
Ceylon (heute Sri Lanka) geschmuggelt,
aber erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts kamen größere Mengen
Kautschuk aus Asien auf den Markt.[1]
Ein weiteres wichtiges Produktionsgebiet war das tropische
Afrika. Besonders im
Kongo-Freistaat unter der Herrschaft
des belgischen Königs
Leopold II. wurde die einheimische
Bevölkerung mit brutalen Methoden zum Kautschuksammeln gezwungen
(„Kongogräuel“).
Auch in den französischen Kolonialgebieten wie
Gabun und der
Zentralafrikanischen Republik wurden
die Einwohner auf diese Weise ausgebeutet.
Durch die
zusätzlichen Plantagen außerhalb Brasiliens konnte der
Kautschukbedarf besser gedeckt werden, so dass der Preis fiel
und der Kautschukboom in Amazonien zu einem Ende kam. Zwar
führte der große Bedarf während des
Ersten Weltkrieges noch einmal zu
einem Aufschwung, doch dieser war nicht von Dauer.[1]
Neben den Brasilianern litten auch die Briten unter dem
niedrigeren Preis, weshalb sie 1922 den Stevenson-Plan
erdachten, ein Kautschuk-Kartell,
das vornehmlich zu Lasten des größten Verbrauchers, der USA,
ging. Zu dieser Zeit entstand der Plan des Besitzers der
Ford-Werke,
Henry Ford, Kautschuk in Brasilien
selbst anzubauen. Im heutigen
Fordlândia
in der Gemeinde
Aveiro
beschäftigte Ford in den zwanziger Jahren bis zu 5000 Arbeiter,
aber wegen verschiedener Schwierigkeiten, beispielsweise starkem
Befall durch den in Brasilien vorkommenden Pilz
Microcyclus ulei,
misslang das Projekt.[5]
1934 gab es mit dem International Rubber Regulation Agreement
einen weiteren Versuch, den Kautschukpreis zu stabilisieren.


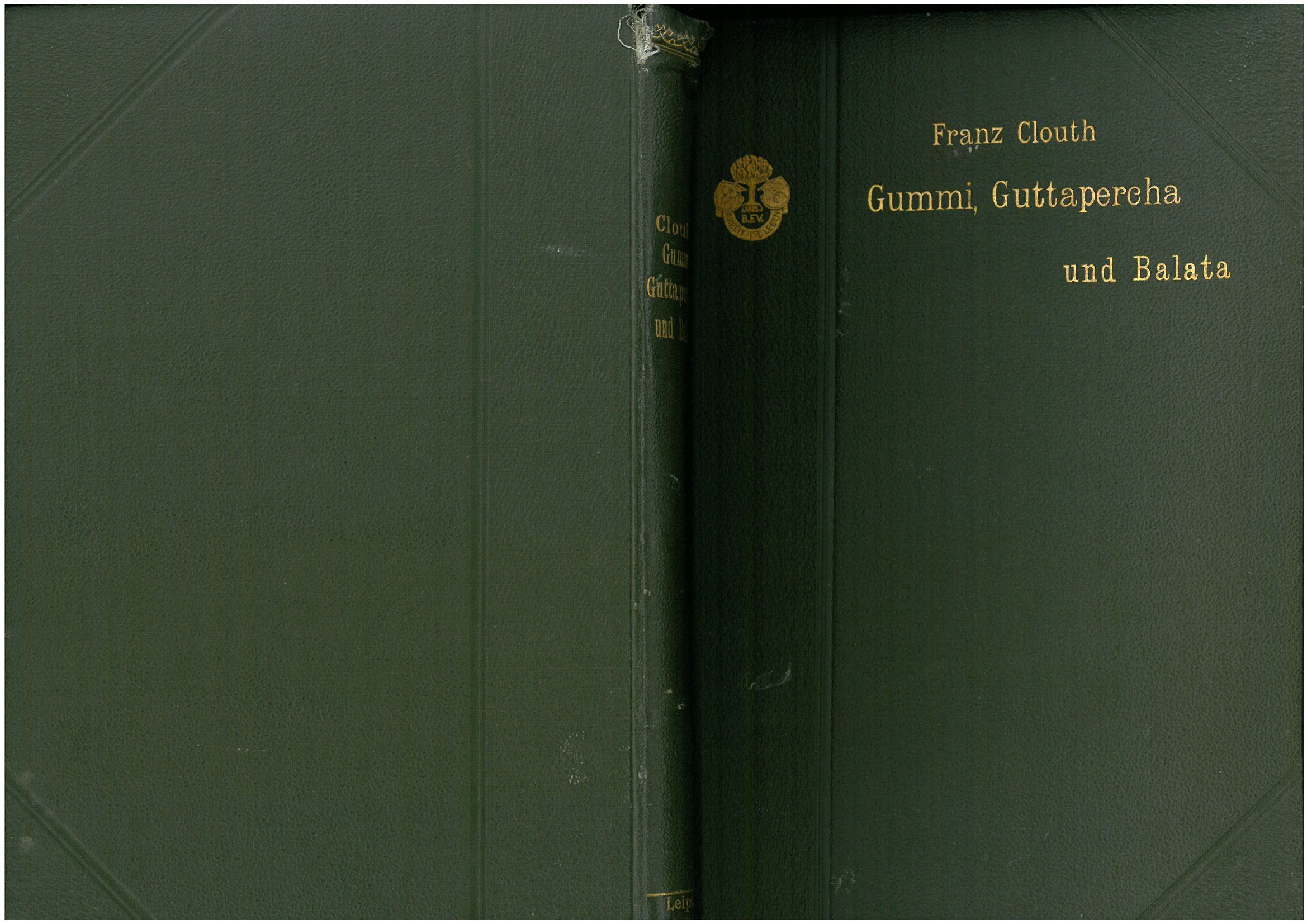 Etwa
um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes
Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war
ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der
schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk
erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch
Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.
Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen
der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,
die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.
Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein
Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit
bekanntzumachen. Etwa
um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes
Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war
ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der
schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk
erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch
Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.
Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen
der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,
die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.
Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein
Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit
bekanntzumachen.
Damaliges Standardwerk über die Gummi-Industrie



Um 1860 konnte
Charles Hanson Greville Williams aus Naturkautschuk
Isopren destillieren und
die
Summenformel
C5H8
bestimmen. Damit ermöglichte er
Gustave Bouchardat 1879, synthetischen Kautschuk in
einem mehrere Monate dauernden Prozess erstmals herzustellen, indem er aus
Kautschuk gewonnenes
Isopren mit
Salzsäure
zusammen erhitzte und eine gummiartige Substanz erhielt. Um 1900 stellte
Iwan Kondakow aus
Dimethylbutadien den
ersten vollsynthetischen Kautschuk her. Das erste Patent zur Herstellung von
synthetischem Kautschuk wurde 1909 an
Fritz Hofmann erteilt.
Von diesem Synthesekautschuk wurden bei
Bayer
in Leverkusen von 1915 bis 1918 2.500 Tonnen hergestellt. Es kam damals auch
frühzeitig bereits zu einem engen Gedankenaustausch und sogar Zusammenarbeit
zwischen Karl Duisberg (Bayer) und Franz Clouth der, wie später die
Kautschukimport-Restriktionen im Ersten Weltkrieg dann auch Probleme für Max
Clouth als späterem Firmenführer mit sich brachten, Gefahren für seine
Produktion im Synthesekautschuk als Konkurrenzprodukt sah. Eine Zeit
lang fertigte Clouth wohl in diesem Zusammenhang auch Autoreifen unter
Verwendung von Synthesekautschuk.
 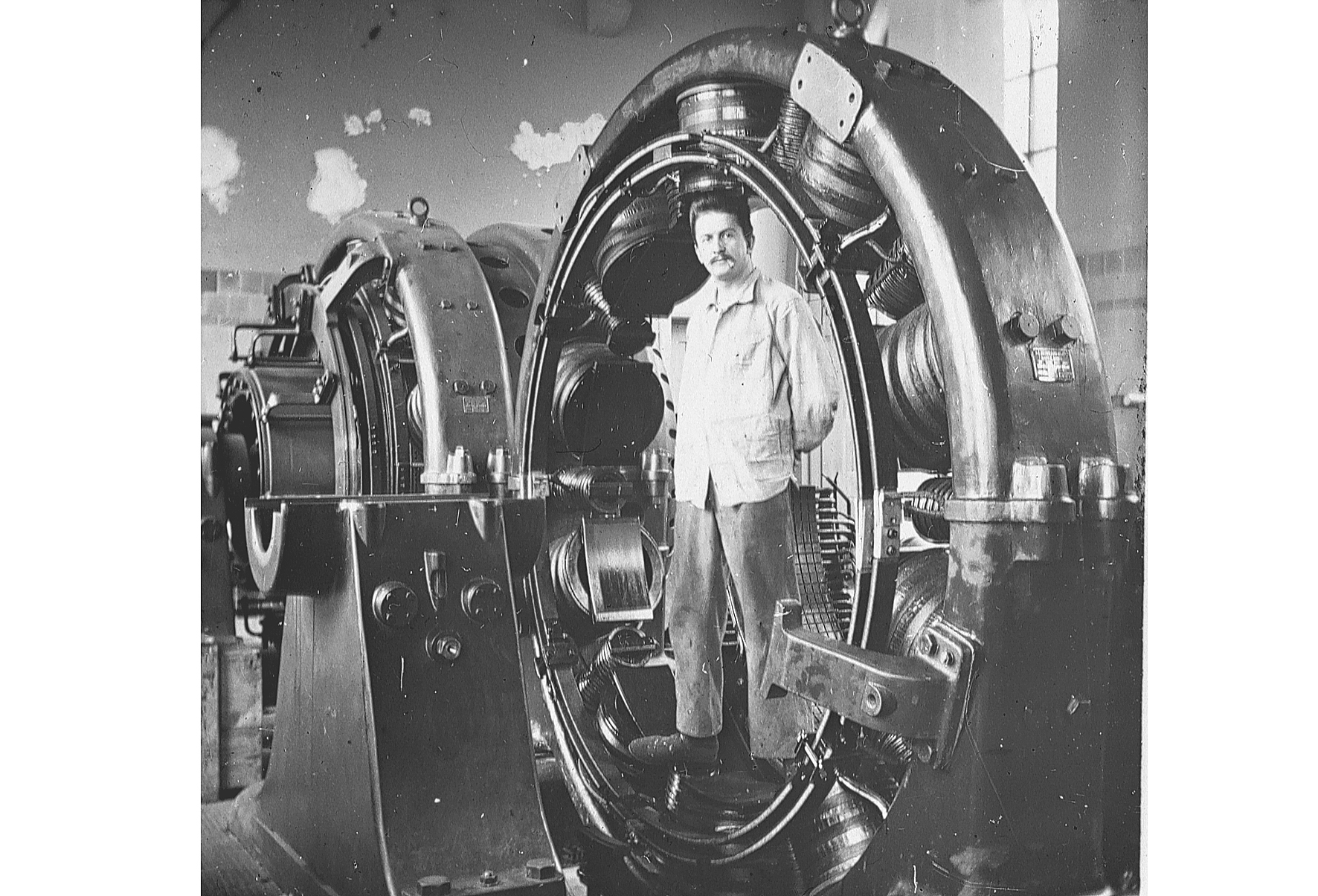
Hartgummi
 Durch
vulkanisieren des Naturkautschuks mit großen Schwefelanteilen (meist 30-40
Teile, mitunter aber auch mehr Schwefel auf 100 Teile Kautschuk) erhielt Thomas
Hancock im Jahr 1841 einen Hartgummi, der wegen seines dem Ebenholz ähnlichen
Verhaltens auch "EBONIT" genannt wird. Durch
vulkanisieren des Naturkautschuks mit großen Schwefelanteilen (meist 30-40
Teile, mitunter aber auch mehr Schwefel auf 100 Teile Kautschuk) erhielt Thomas
Hancock im Jahr 1841 einen Hartgummi, der wegen seines dem Ebenholz ähnlichen
Verhaltens auch "EBONIT" genannt wird.
Das EBONIT
fand zunächst Anwendungen für Mundstücke von Pfeifen, für Medaillons,
Bilderrahmen, aber auch für sogenannten Trauerschmuck (wegen der schwarzen
Farbe). Um 1930 wurde Hartgummi jedoch immer mehr durch Kunststoffe wie BAKELIT
ersetzt, zumal EBONIT eine geringere Wärmebeständigkeit besitzt, die Herstellung
wegen der langen Vulkanisation teuer ist und die Farbauswahl eingeschränkt
bleibt (schwarz, braun, rot). Bedeutung behielt EBONIT letztlich nur noch für
säurebeständige Tank-und Rohrauskleidung
Telefon
mit EBONIT-Gehäuse
From natural
product to industrial product
When company founder Franz Clouth founded one of the first rubber manufactures
in Germany over a hundred years ago, the raw material rubber required for this
purpose had to be imported exclusively from South America, because only there
grew rubber trees from whose thickly liquid natural rubber was extracted.
Already Columbus saw in South America natives play with jumping balls, which
were made from hardened plant juice. This fascinated the Spaniards brought
rubber to Europe. It was not until much later that the British discovered other
possibilities for the use of this natural substance. It was noticed that rubbing
can be used to remove pencil marks from paper, which gave the material the
English name 'rubber' (rubbing). In 1823, Charles Macintosh reported the first
patent for a product using rubber. He applied a thin layer of rubber between two
layers of textile fibers and thus became the inventor of the raincoat (still
called 'mack' in England).
Rubber had the unpleasant property of being soft and sticky at high temperatures,
but being leathery and hard in the cold. The American Charles Goodyear found out
in 1839 how to take these properties to the rubber. Inadvertently, a mixture of
rubber and sulfur fell on a hot plate. He scraped it off immediately, realizing
to his astonishment that the mixture, though still warm, felt dry and not soft
and sticky. The material also remained elastic in the cold.
This discovery marked the birthdays of the rubber industry, which experienced a
rapid ascent with increasing industrialization. The process of adding sulfur to
the rubber is known as vulcanization (according to the Roman fire-god Vulcan).
With the end of the 19th century
plant seeds were smuggled to Europe.
In Indonesia and parts of Asia large rubber plantations by European colonial
powers were established. However, as early as the beginning of this century
(1909), the first synthetic rubbers were produced as an invention from Bayer
Leverkusen/Germany, which were in competition of great importance to the natural
raw material.
Part of the Clouth site has not been used for production since 2007 until 2015,
but rented for commercial purposes. In 2015, the entire company area was cleared
for a new housing construction project.
Rubber is and will
remain one of the most diverse uses for everyday human life

 Originally
in Brazil with world monopolization at home, 70,000 seeds were smuggled out of
Brazil by the Englishman Henry Originally
in Brazil with world monopolization at home, 70,000 seeds were smuggled out of
Brazil by the Englishman Henry Wickam living in the Amazon in 1876, 2000 germinated in English greenhouses and
arrive as young plants to East Asia, in particular Indonesia, from where the
pictures originate. While in Brazil and the Amazon region gum trees were singled
out in the forest and therefore had to be time consumed, Far East quickly
developed a plantation system, with which increased sales potential for world
demand could be procured. The Brazilian sales monopoly was thus broken. Who
wants to see the Amazon in Peru, flies to Iquitos. The rubber had also made
Iquitos rich in the eighties of the nineteenth century. "Rubber Barons" like
"Fitzcarraldo", embodied by Klaus Kinski in the film by Roman Herzog, built
pompous villas on the promenade. The art nouveau facades are still partially
restored. After 30 years, however, the rubber boom was still at its end.
Wickam living in the Amazon in 1876, 2000 germinated in English greenhouses and
arrive as young plants to East Asia, in particular Indonesia, from where the
pictures originate. While in Brazil and the Amazon region gum trees were singled
out in the forest and therefore had to be time consumed, Far East quickly
developed a plantation system, with which increased sales potential for world
demand could be procured. The Brazilian sales monopoly was thus broken. Who
wants to see the Amazon in Peru, flies to Iquitos. The rubber had also made
Iquitos rich in the eighties of the nineteenth century. "Rubber Barons" like
"Fitzcarraldo", embodied by Klaus Kinski in the film by Roman Herzog, built
pompous villas on the promenade. The art nouveau facades are still partially
restored. After 30 years, however, the rubber boom was still at its end.
The development of the vehicle industry also heated the world's demand for
rubber rapidly. This resulted in the rapid development of rubber processing
companies, including Clouth in Cologne Nippes.
The story about Henry Wickham is
incidentally reproduced in the film "Rubber":
https://youtu.be/_JYXnJB_wgE
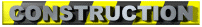 |
 Naturkautschuk
oder Kautschuk (indian. cao ‚Baum‘ und ochu
‚Träne‘; zusammen ‚Träne des Baumes‘) besteht hauptsächlich aus
dem
Polymer cis-1,4-Polyisopren.
Er dient hauptsächlich der Herstellung von
Gummi (Elastomere)
mittels
Vulkanisation.
Naturkautschuk
oder Kautschuk (indian. cao ‚Baum‘ und ochu
‚Träne‘; zusammen ‚Träne des Baumes‘) besteht hauptsächlich aus
dem
Polymer cis-1,4-Polyisopren.
Er dient hauptsächlich der Herstellung von
Gummi (Elastomere)
mittels
Vulkanisation. 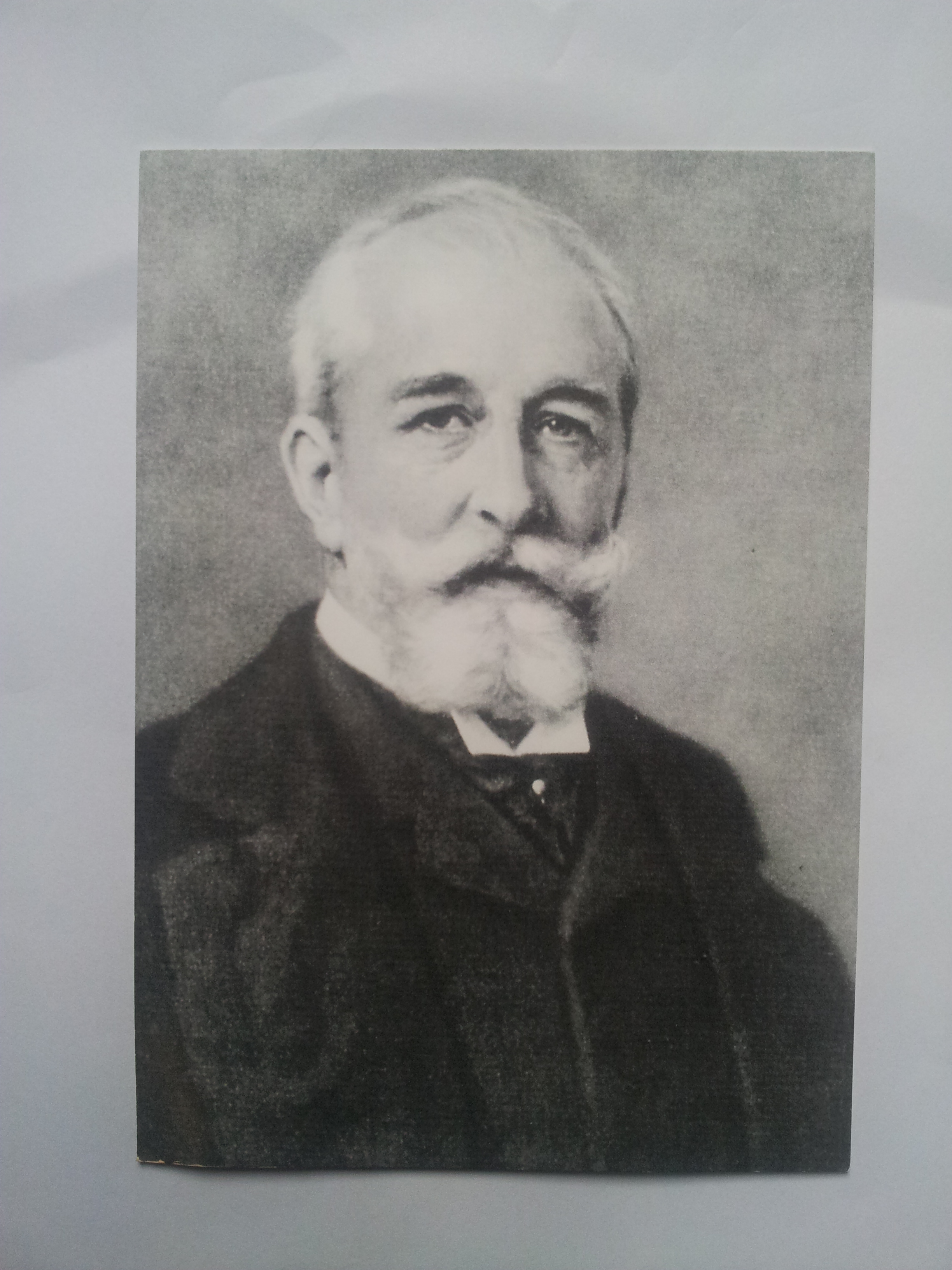

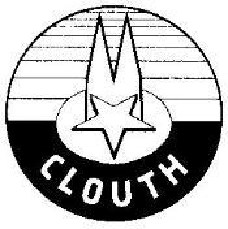

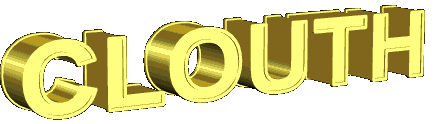


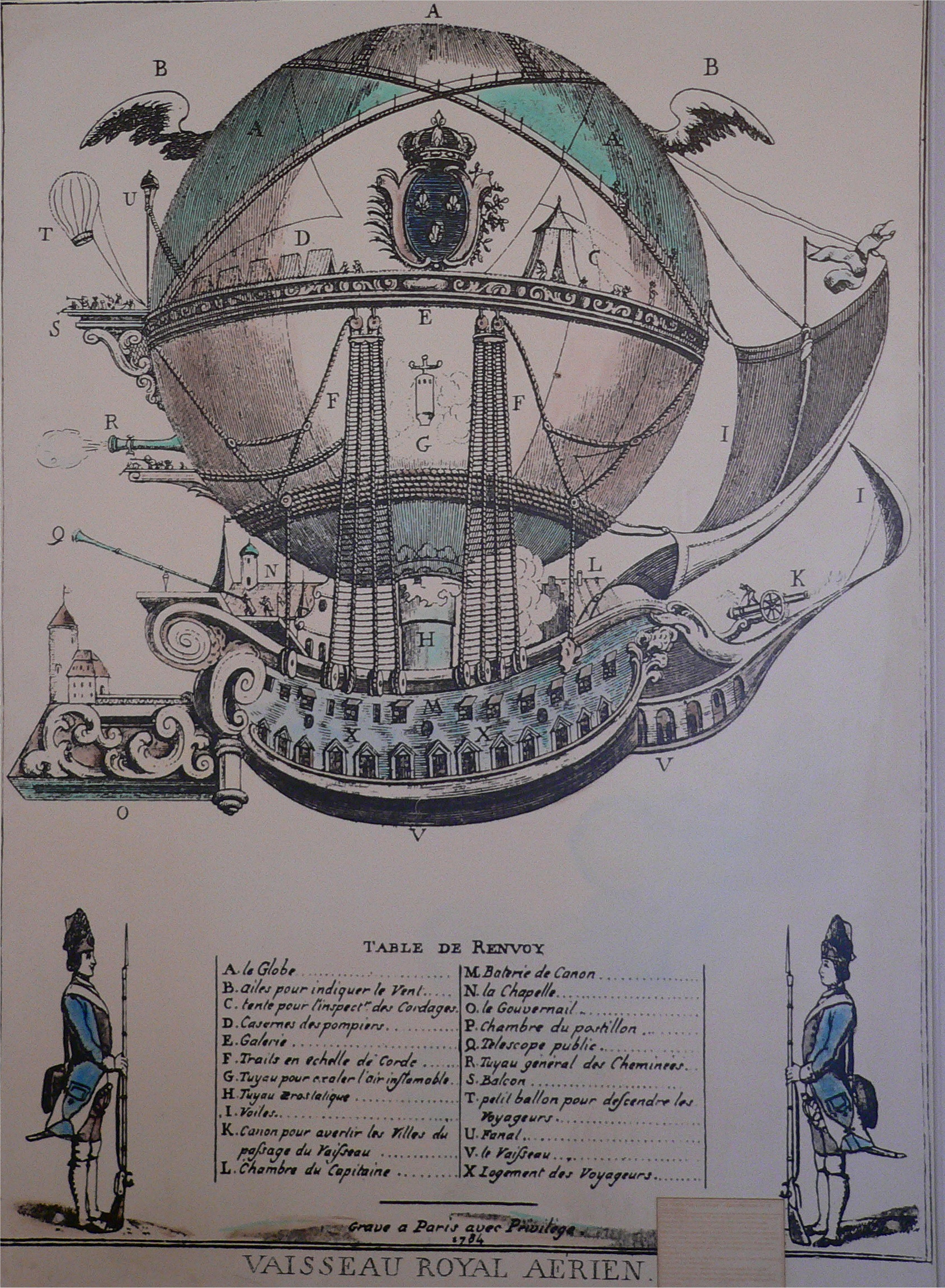

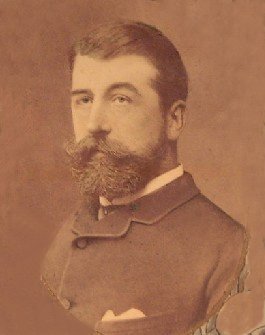
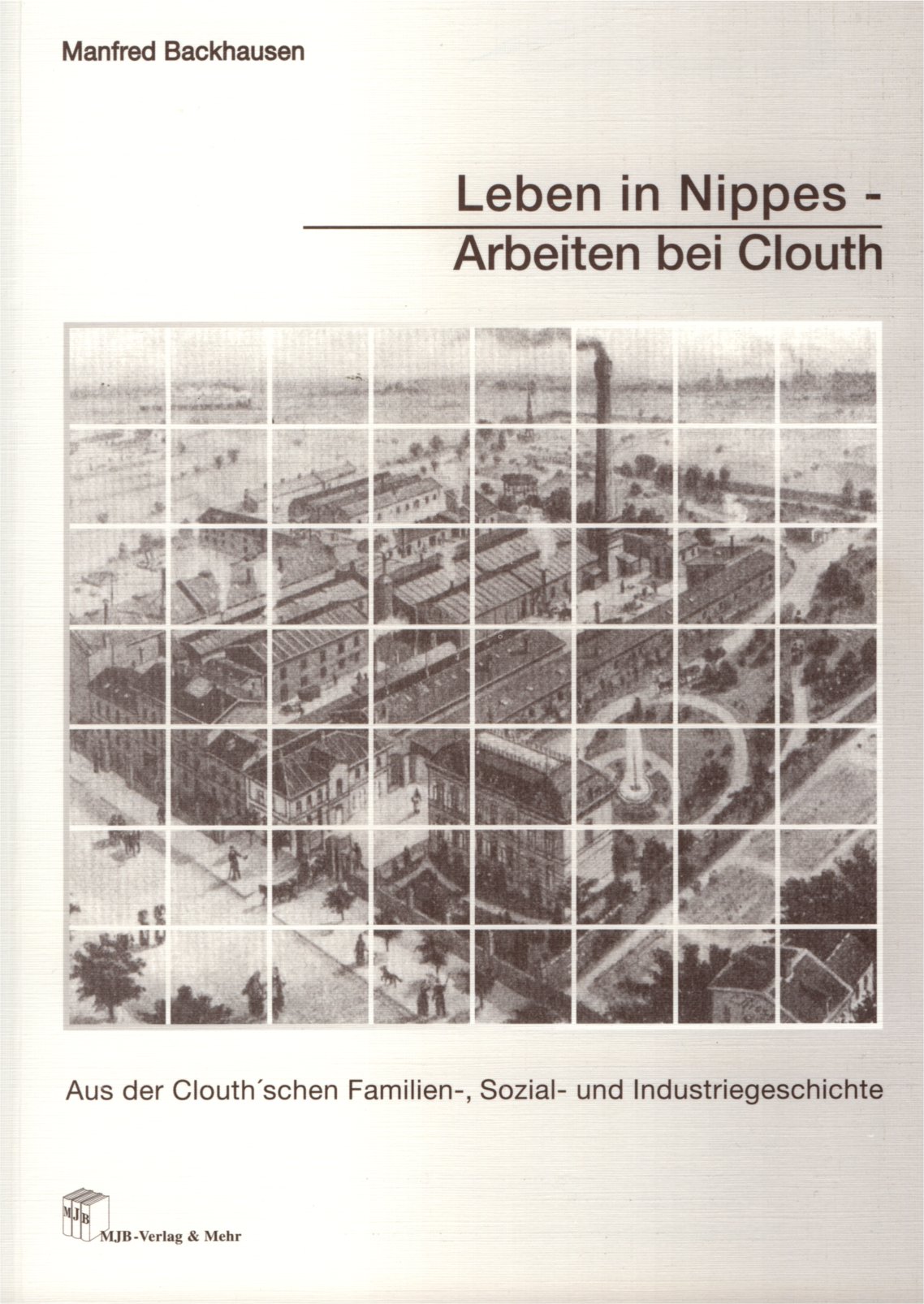

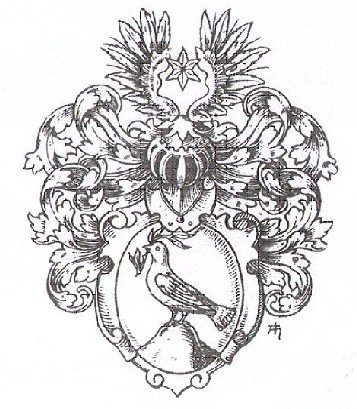
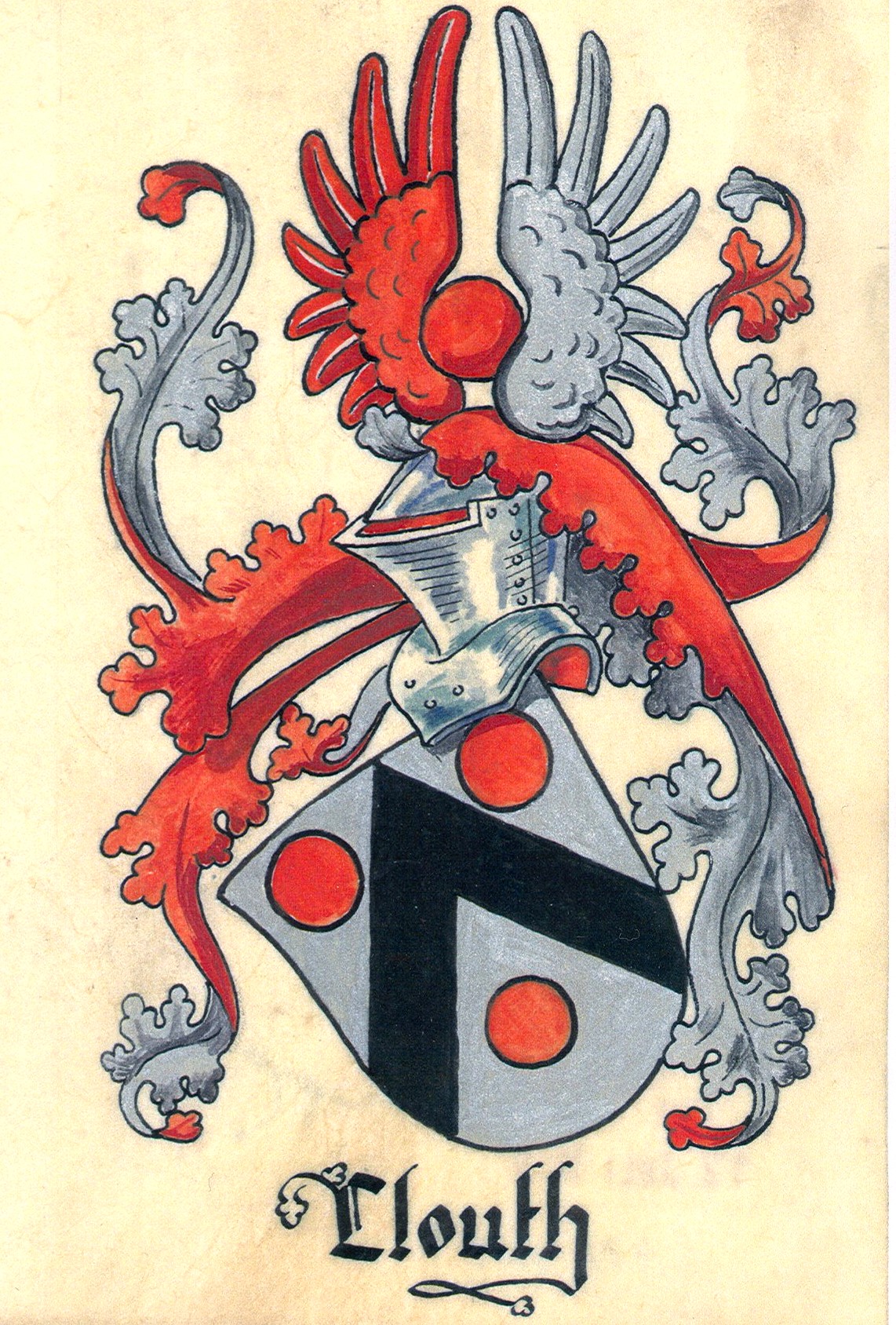

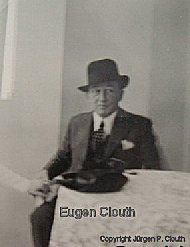
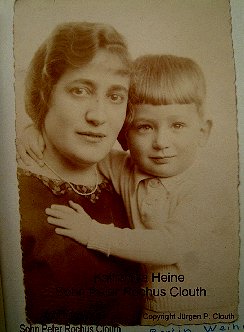


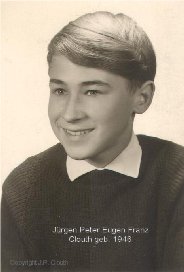



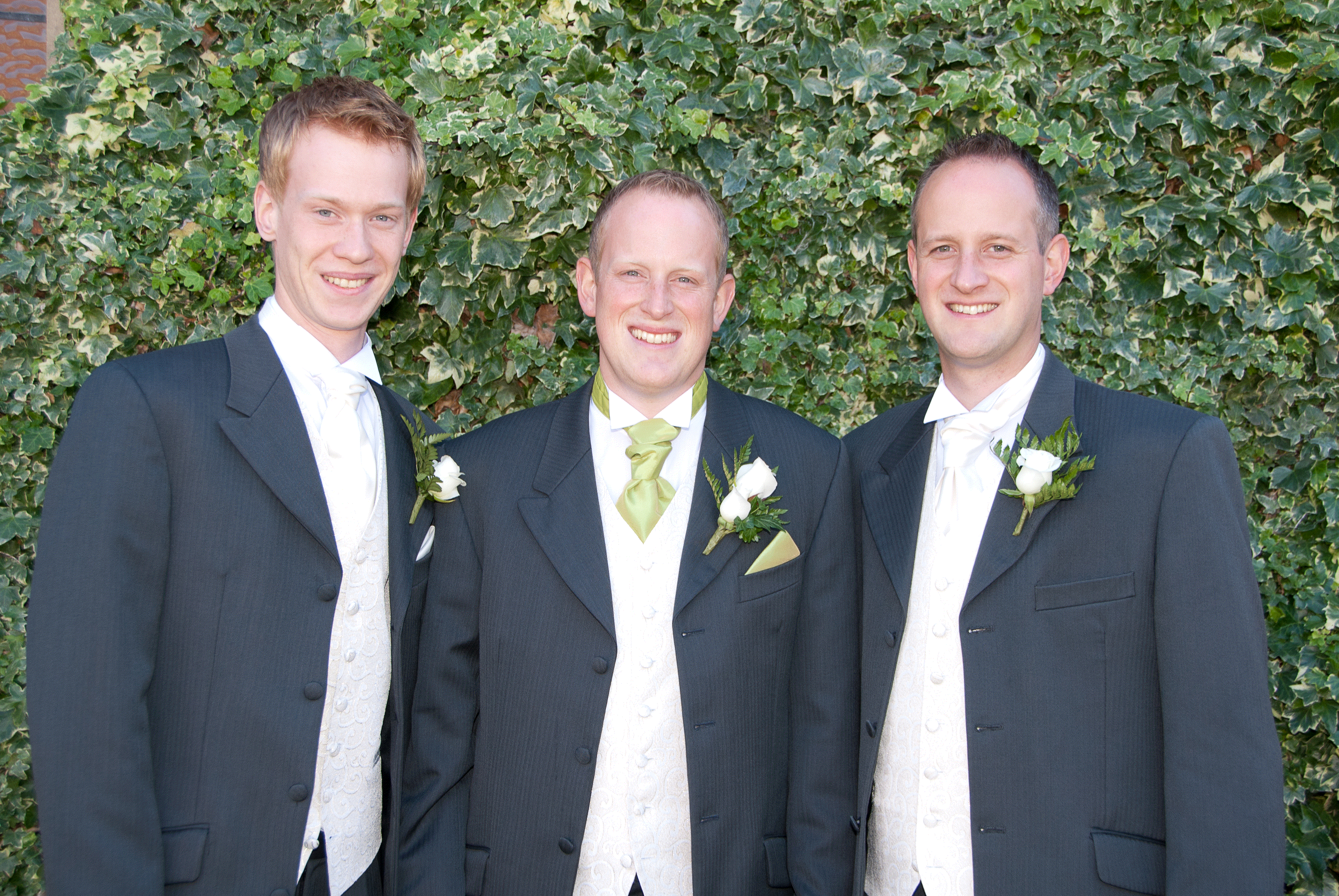


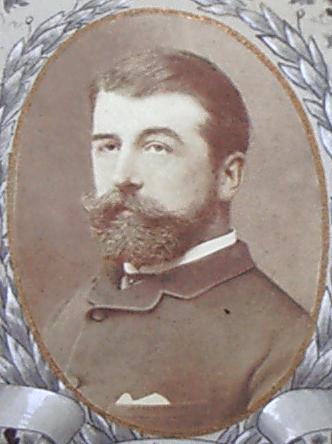

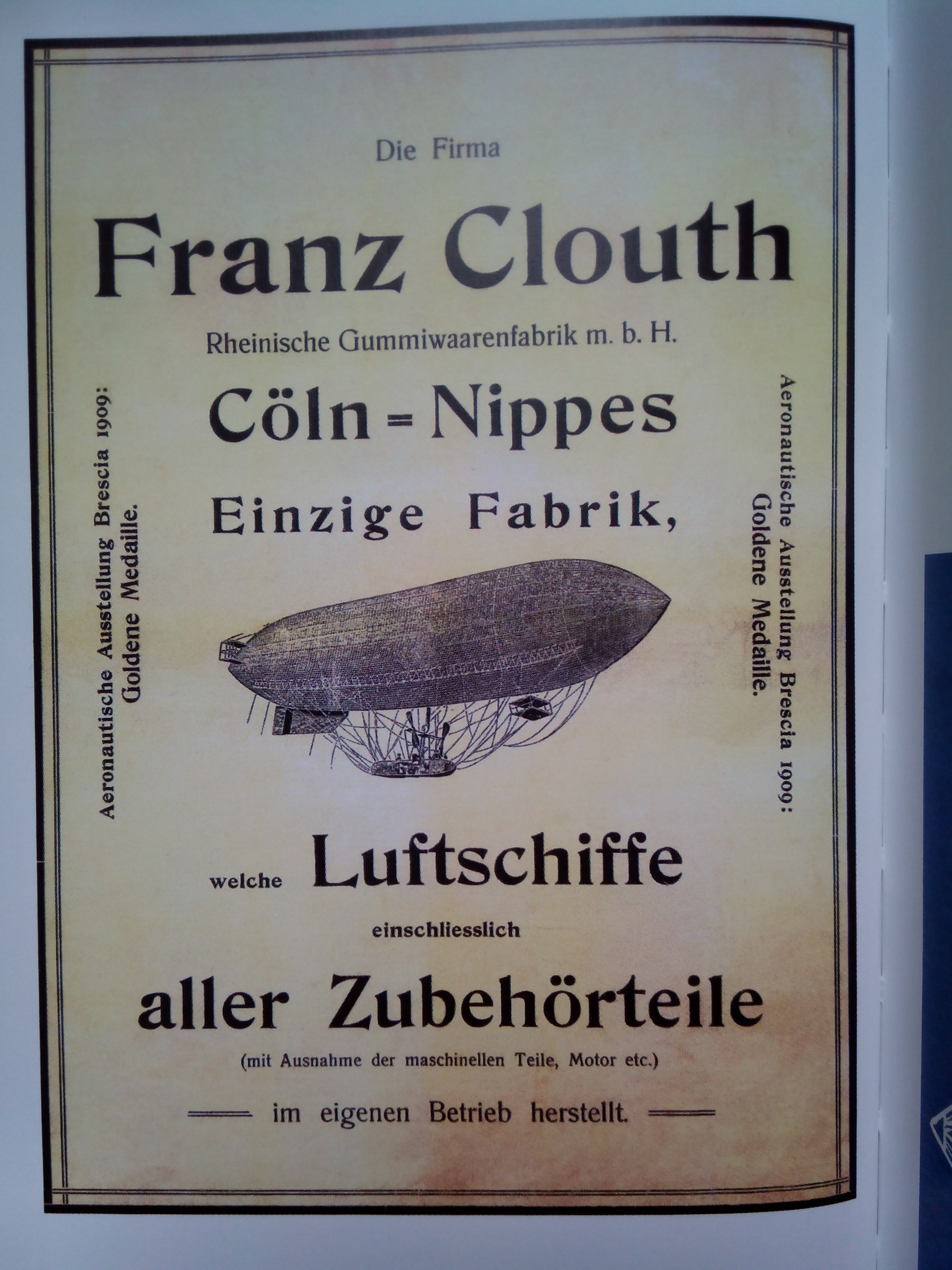
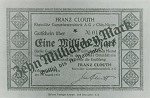




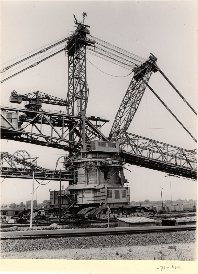
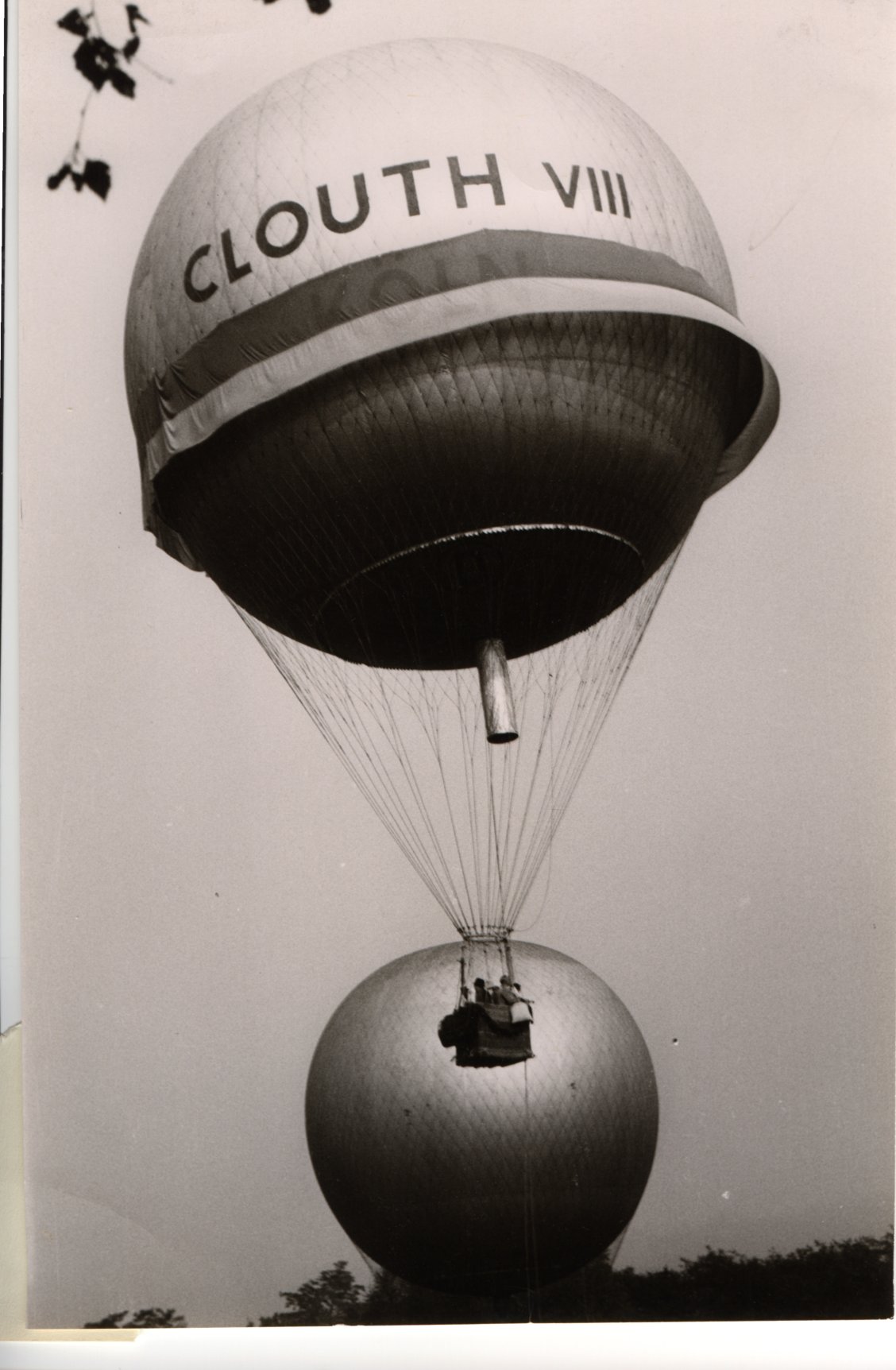



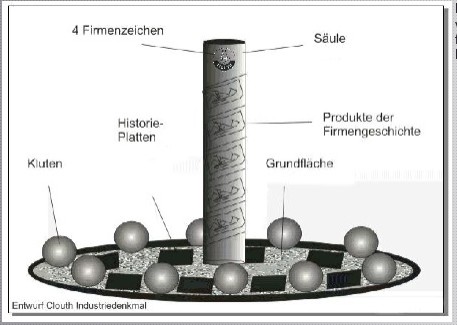
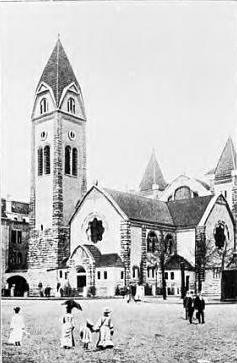

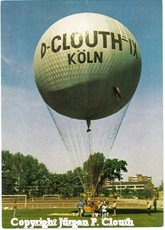

.jpg)
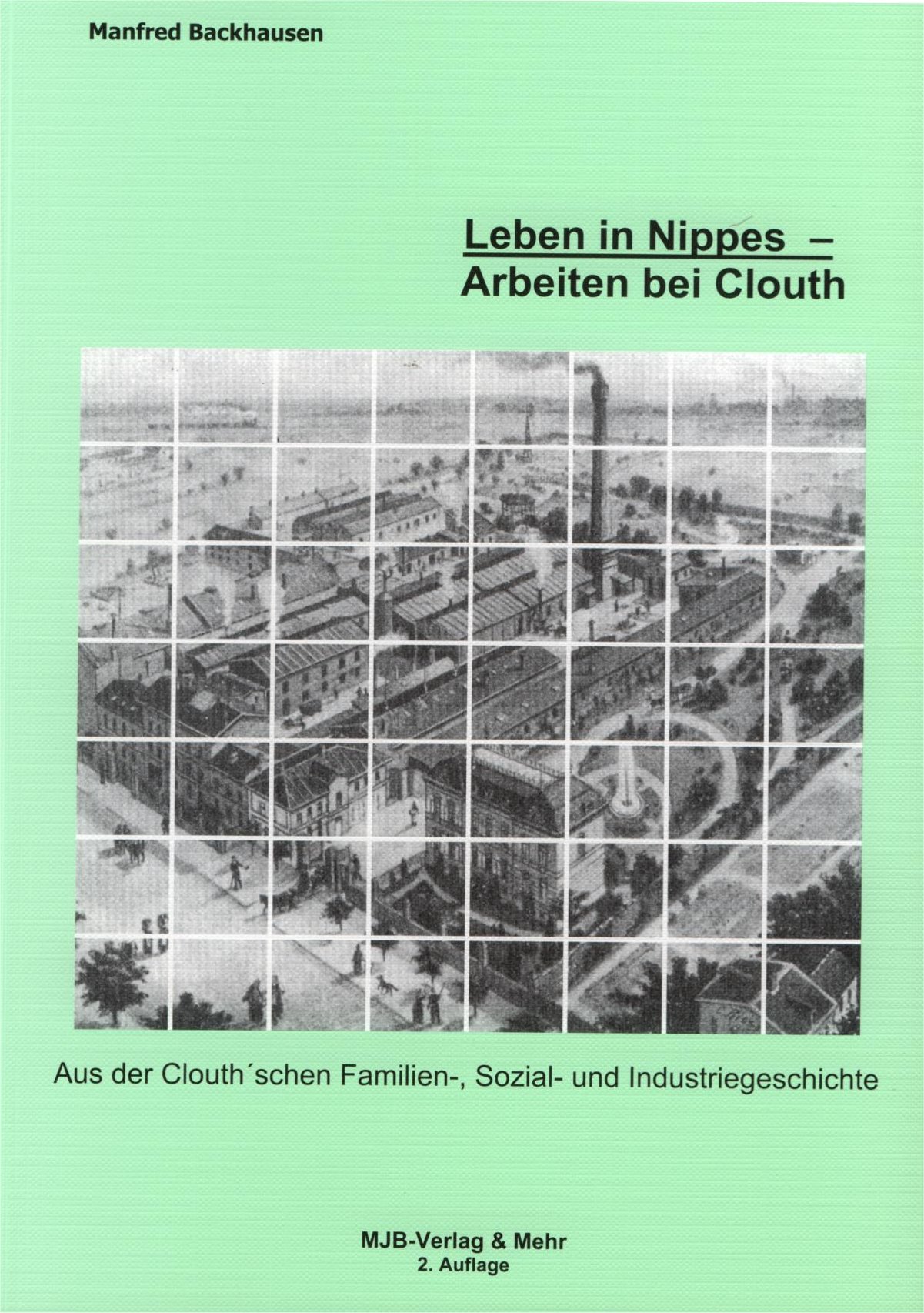
.jpg)



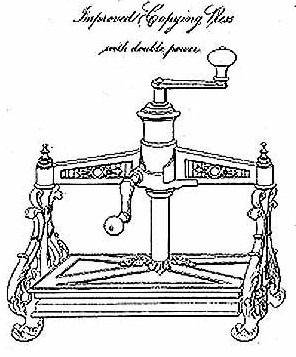
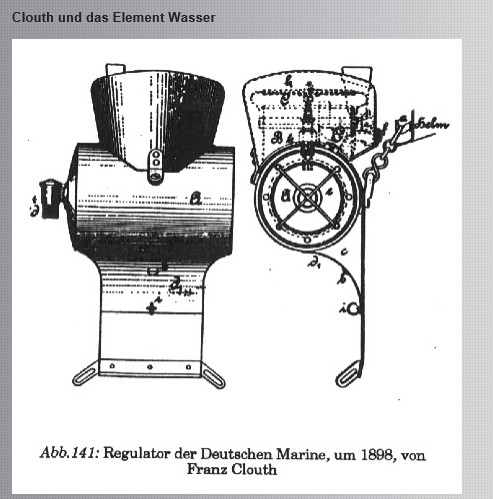



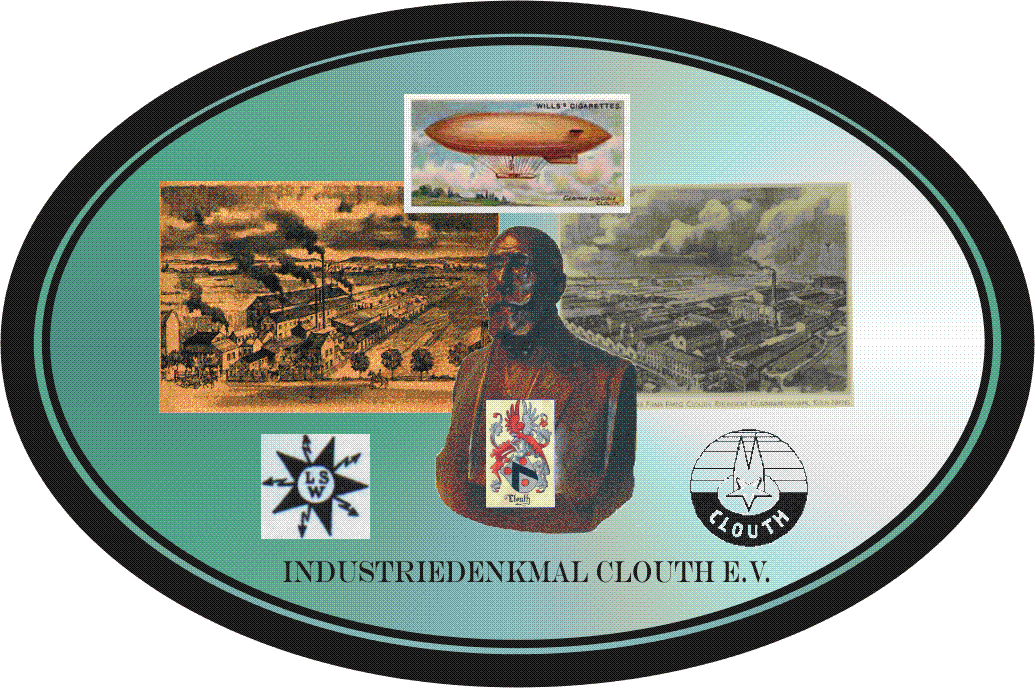




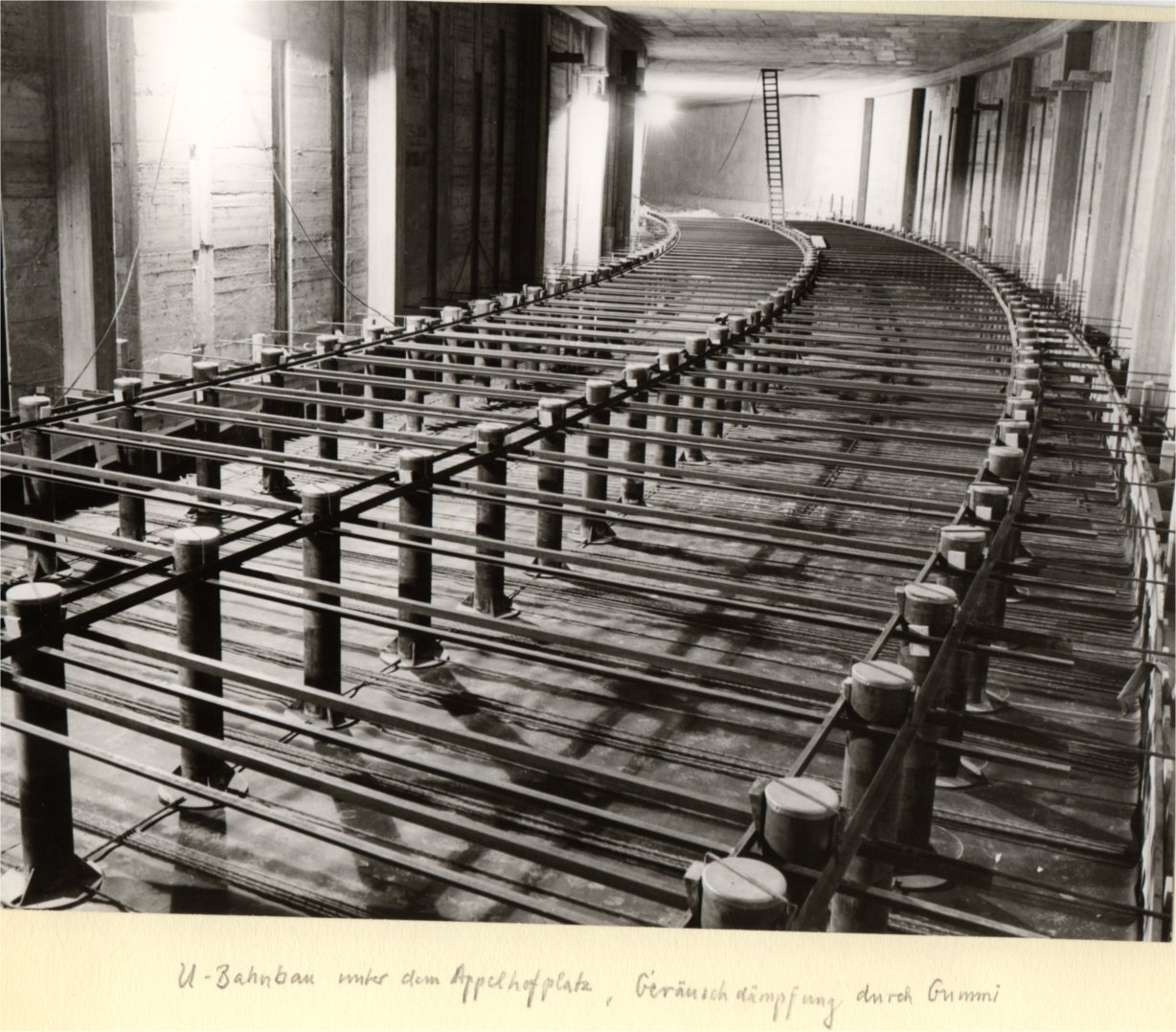
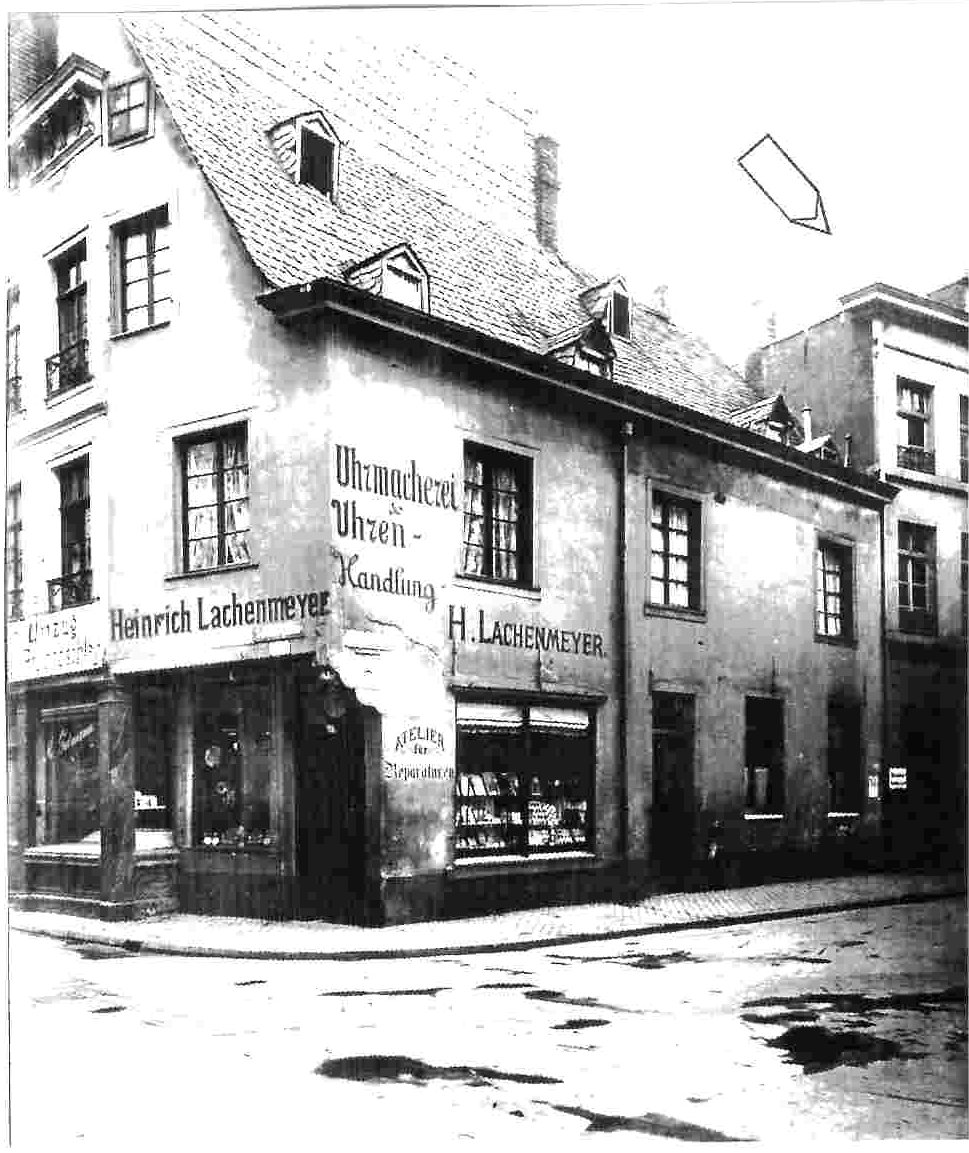

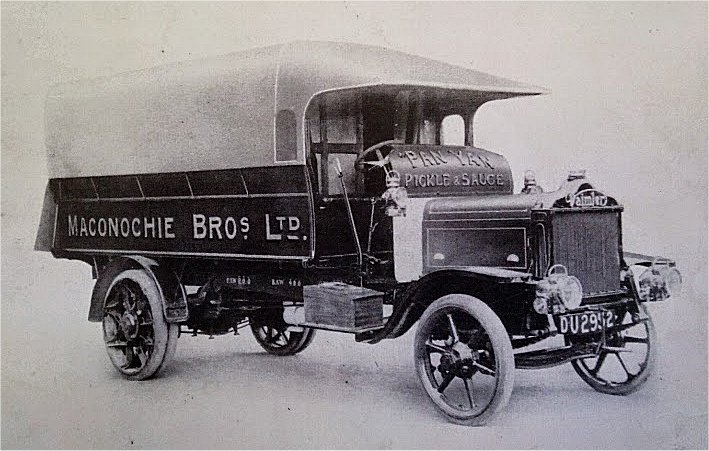
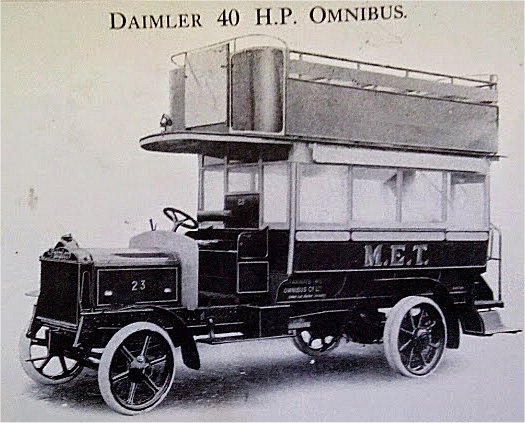


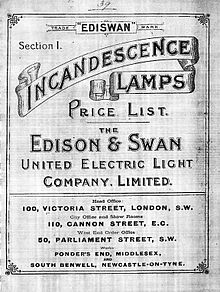




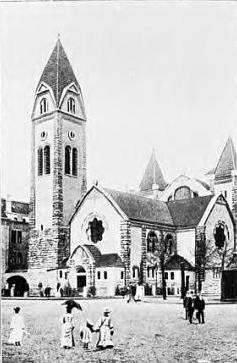
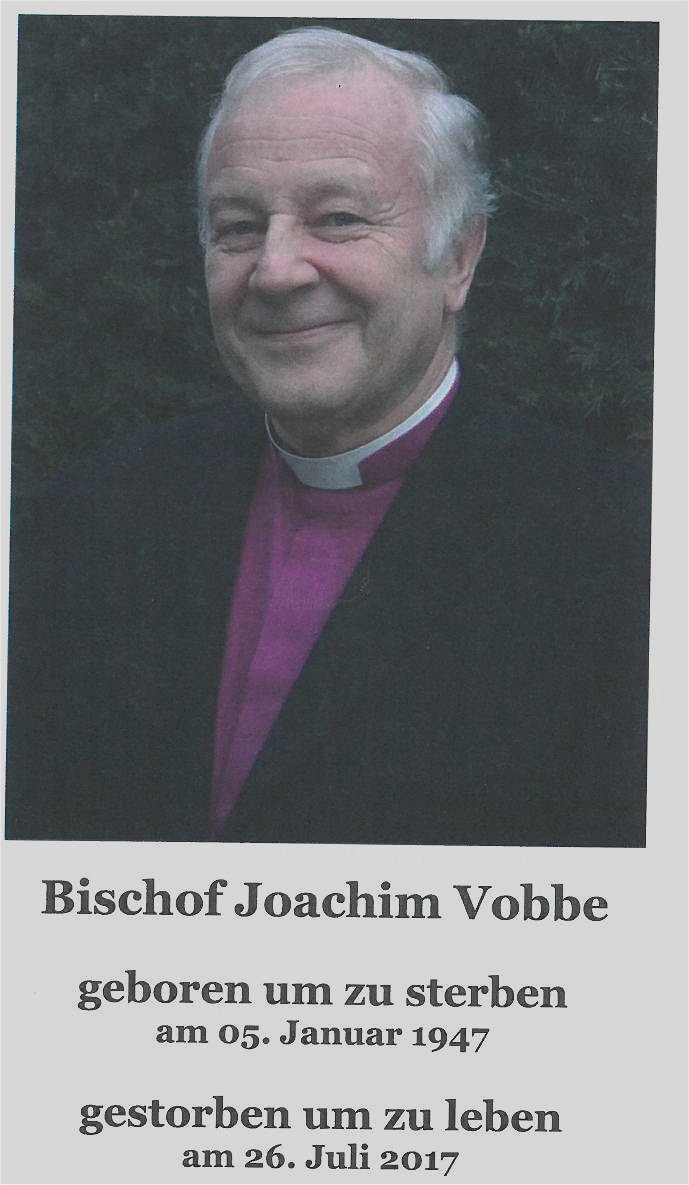
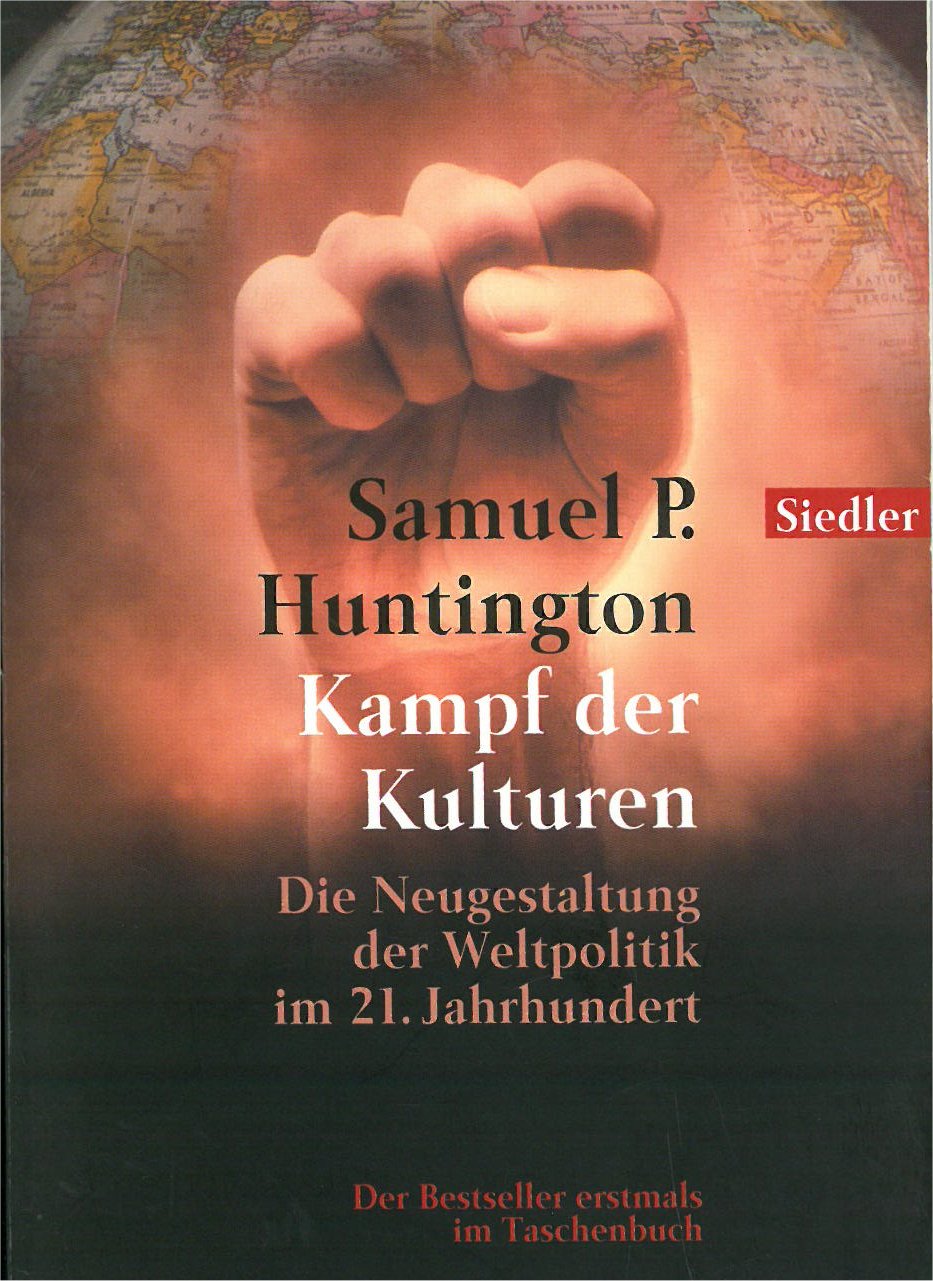
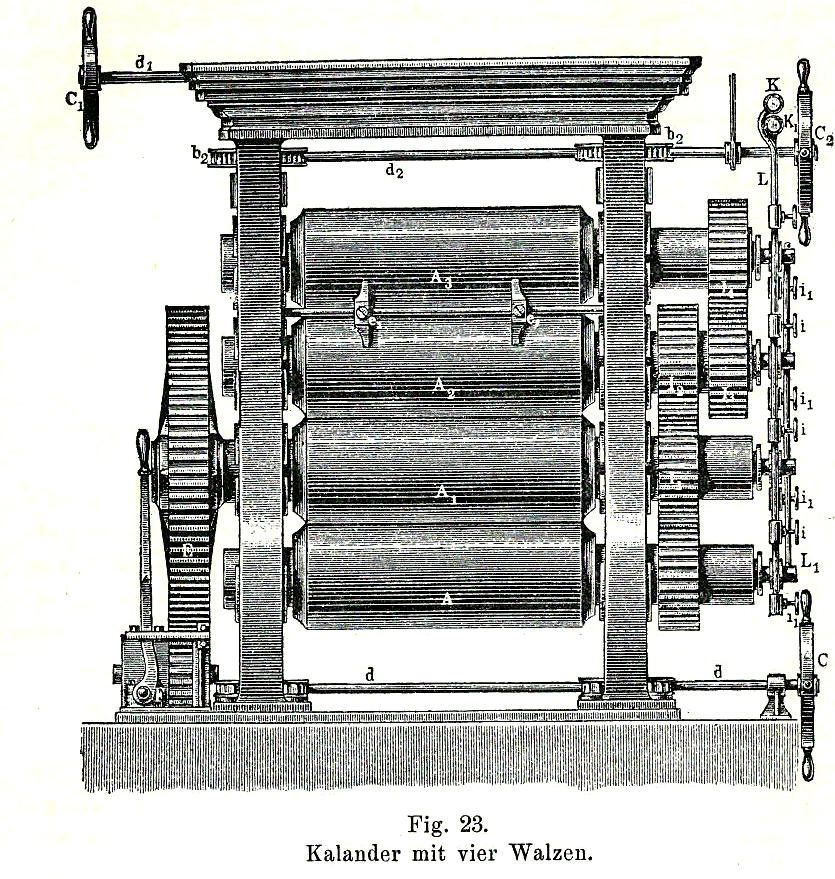
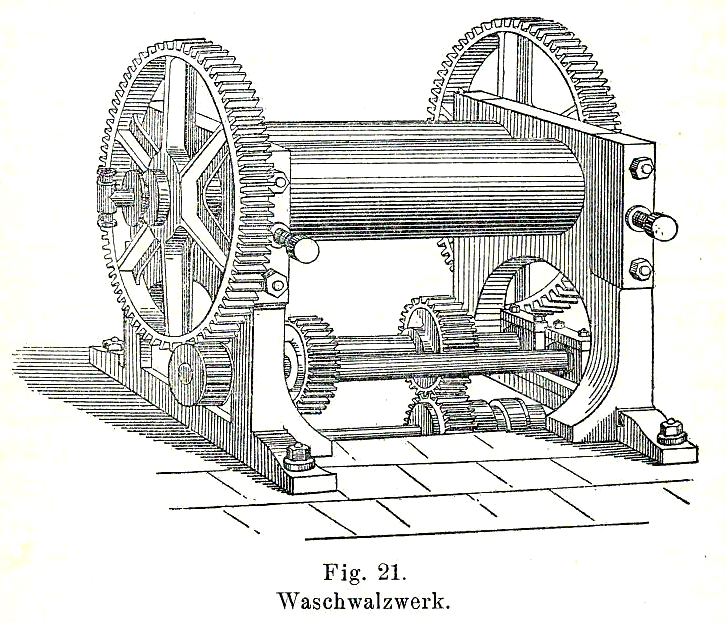

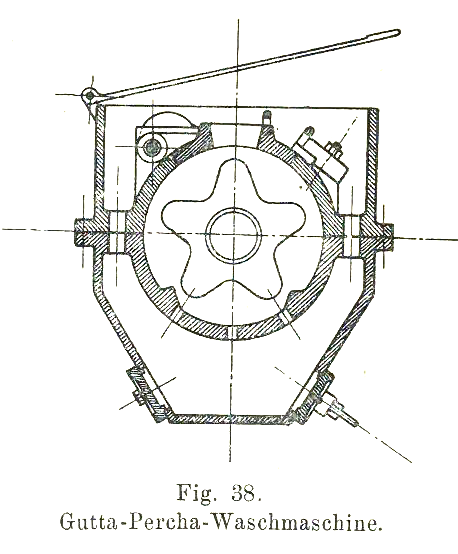
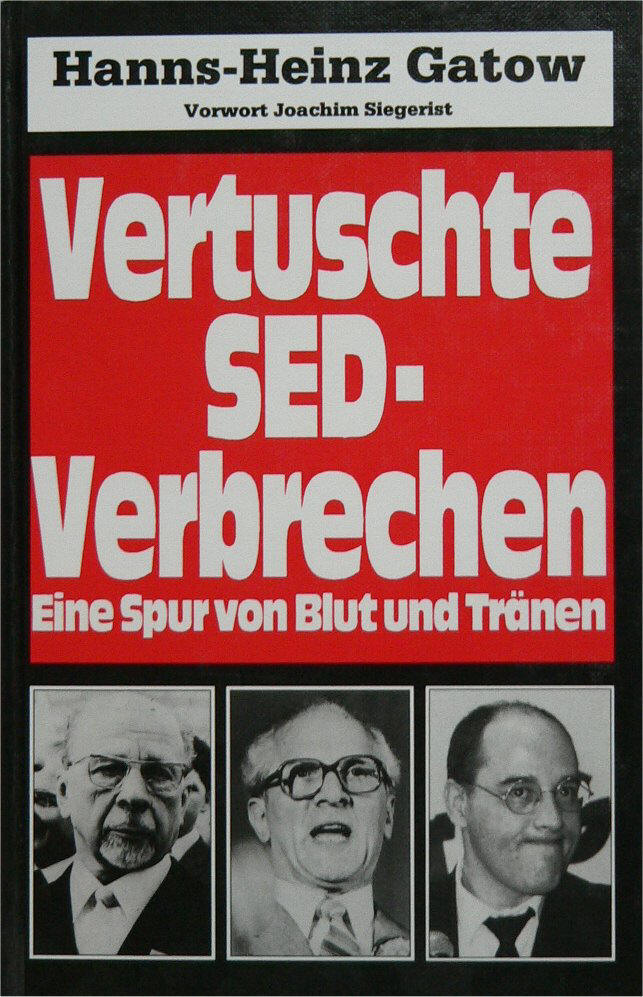
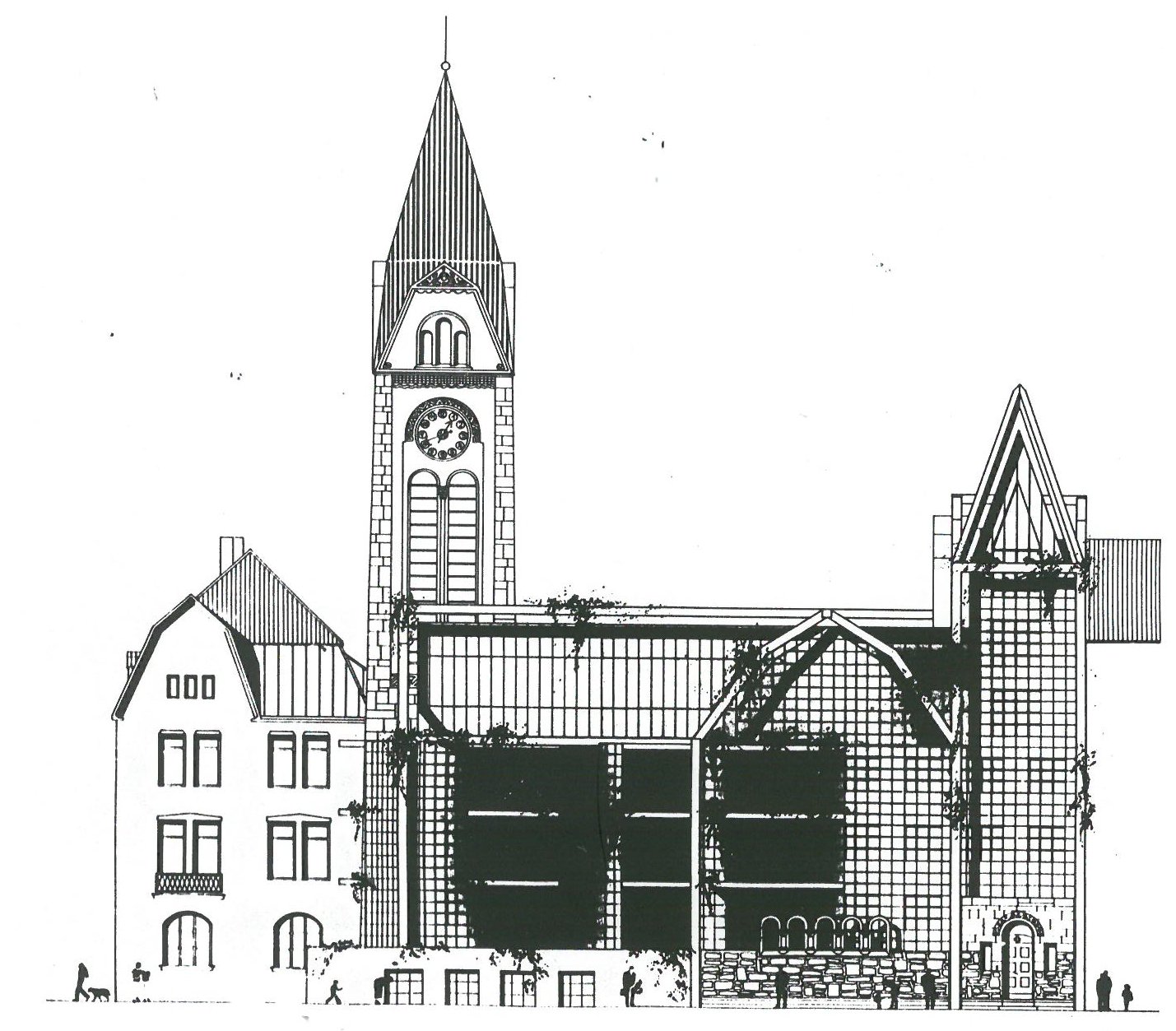


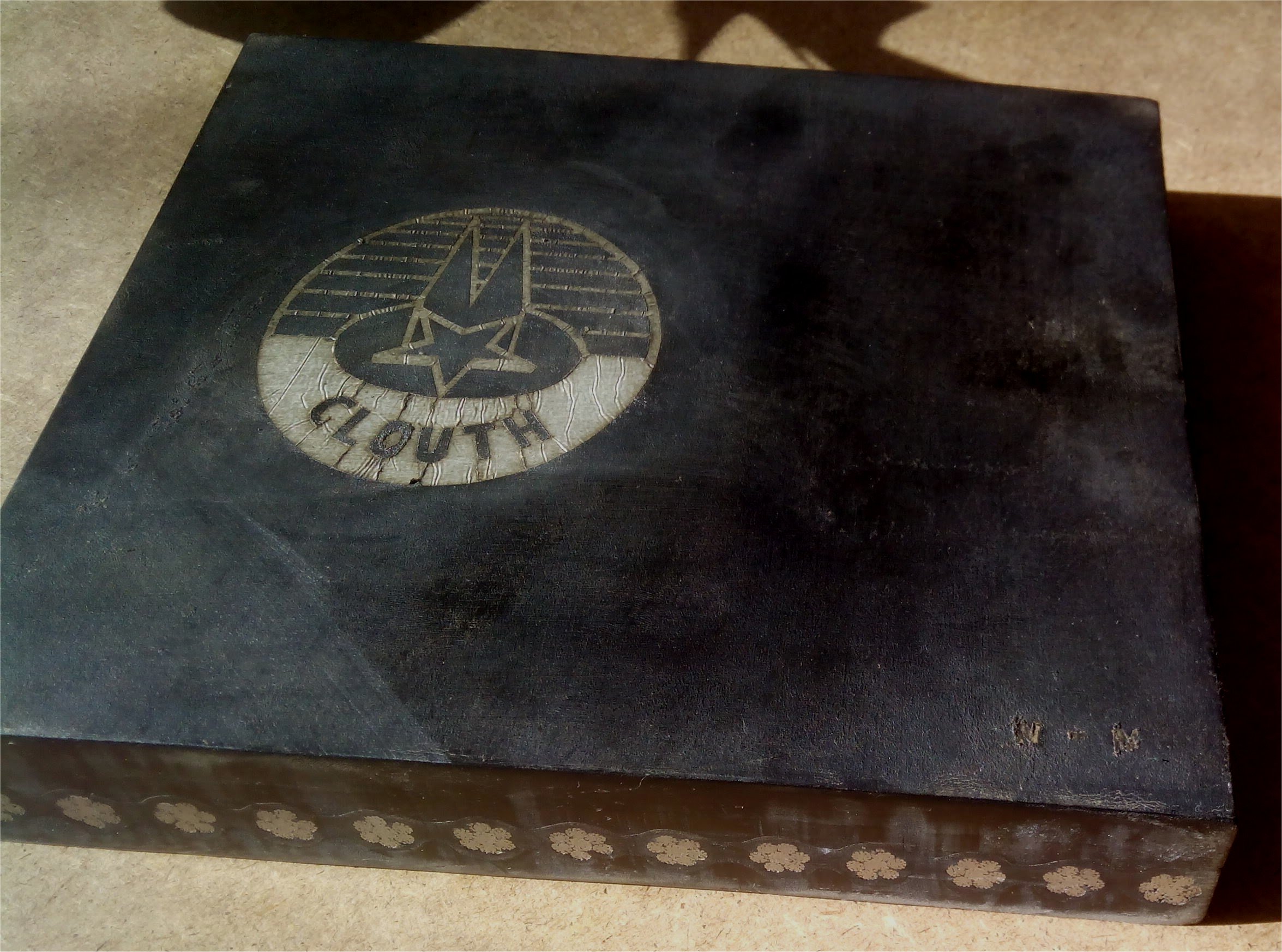



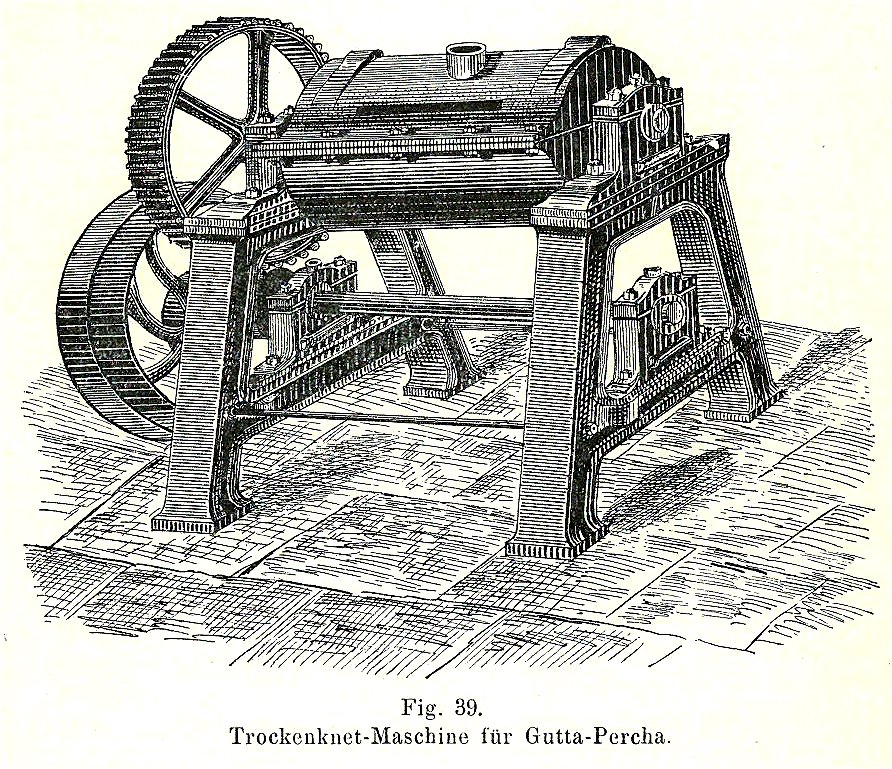
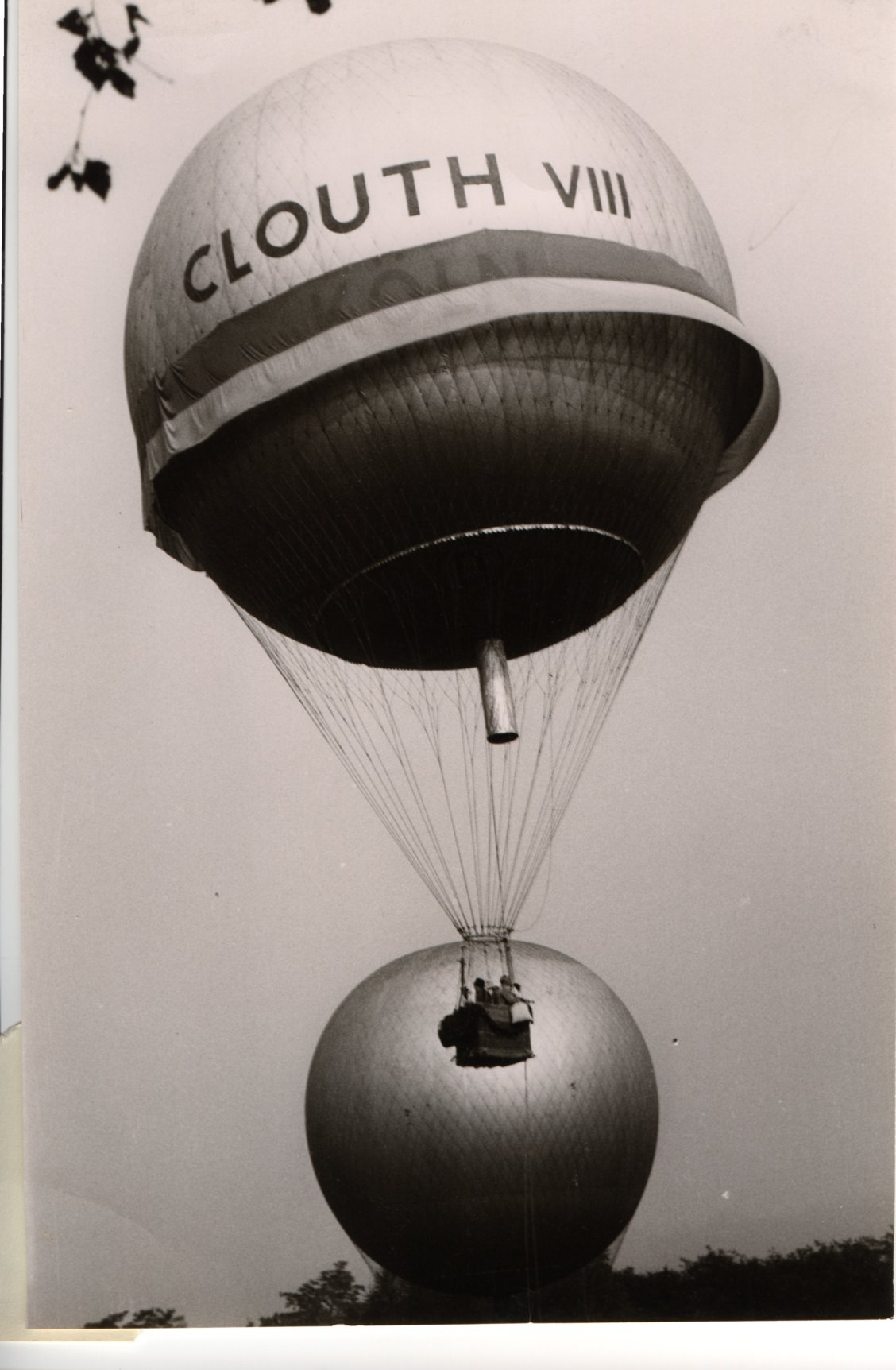

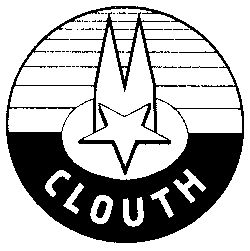




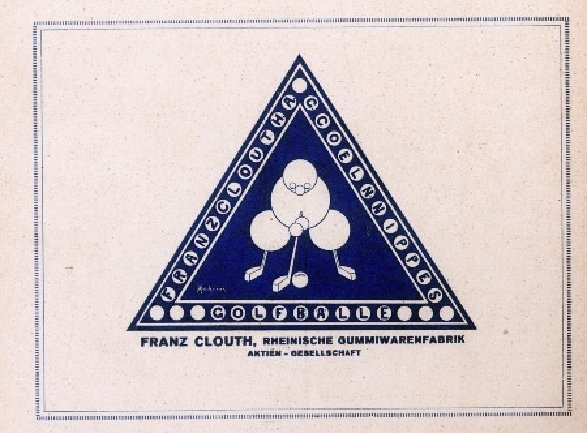


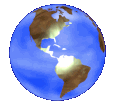
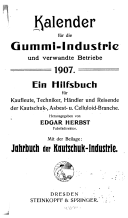
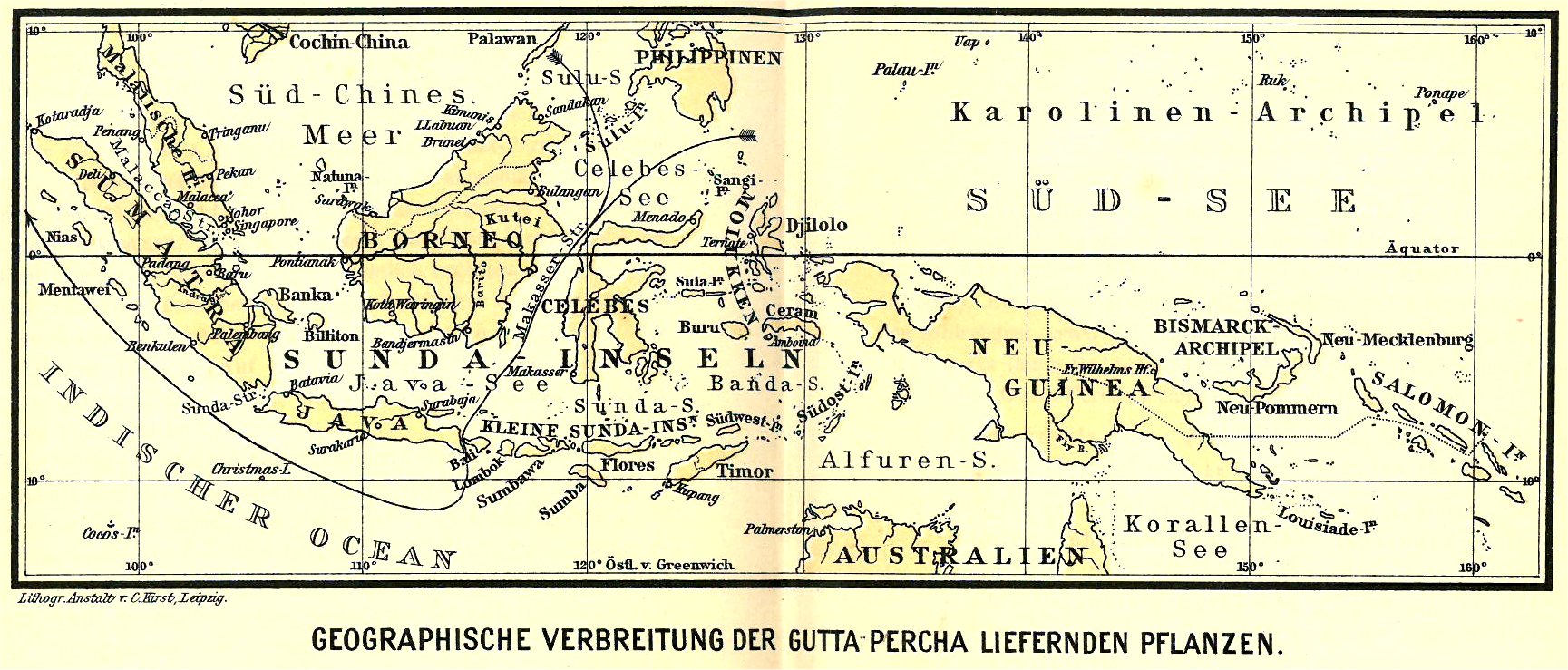
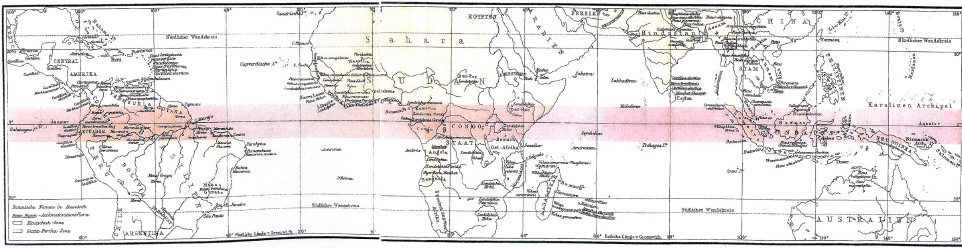
 Die
beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien
gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine
Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg
akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon
Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser
Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei
der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild
wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen
geringeren Waschverlust.
Die
beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien
gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine
Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg
akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon
Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser
Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei
der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild
wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen
geringeren Waschverlust.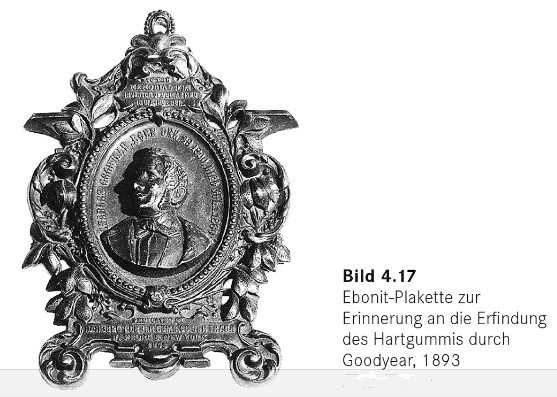 Der
erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische
Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für
Der
erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische
Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für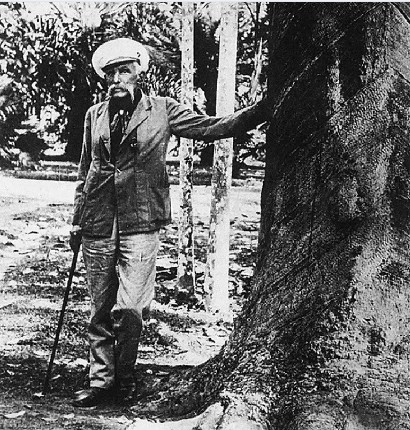 Das
für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der
Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach
Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des
Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen
Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen
begannen.
Das
für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der
Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach
Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des
Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen
Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen
begannen.
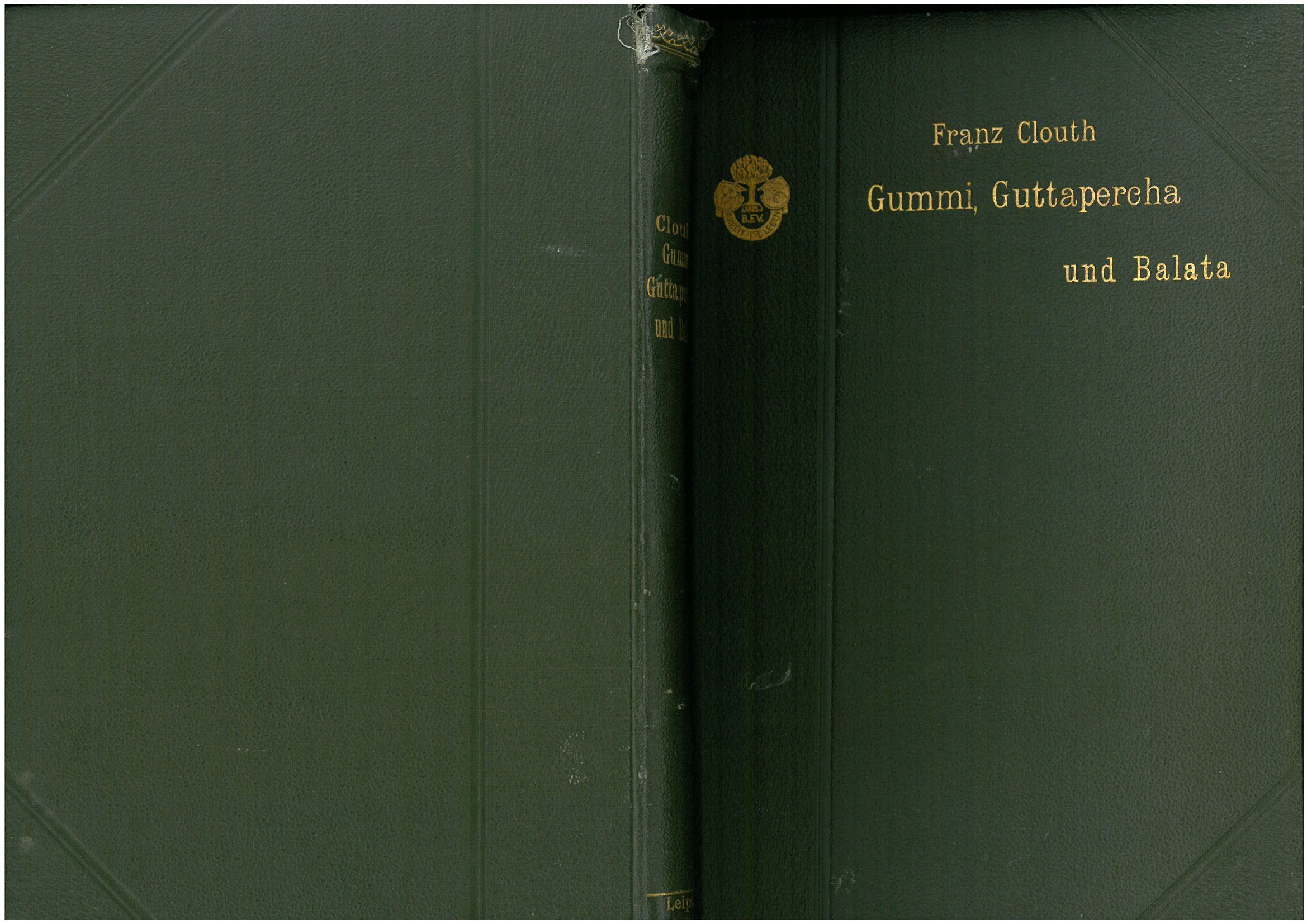 Etwa
um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes
Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war
ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der
schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk
erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch
Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.
Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen
der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,
die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.
Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein
Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit
bekanntzumachen.
Etwa
um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes
Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war
ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der
schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk
erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch
Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.
Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen
der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,
die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.
Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein
Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit
bekanntzumachen.